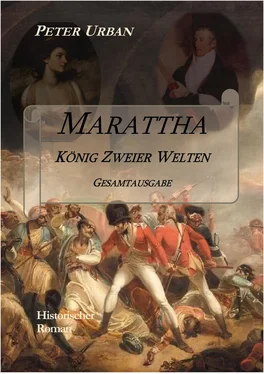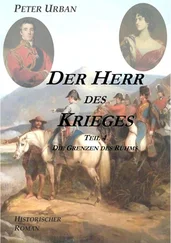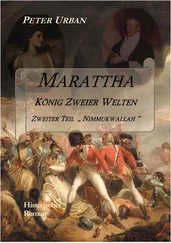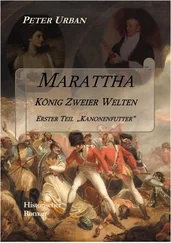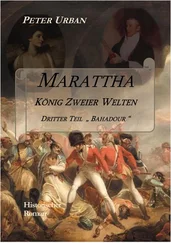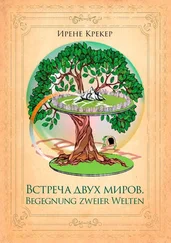Wesley war mit seinem Leben zufrieden und glücklich, den Weg nach Indien gewählt zu haben. Das Klima, mit dem John Sherbrooke noch immer zu kämpfen hatte, machte ihm nicht im geringsten zu schaffen, und der märchenhafte Orient, den er nun tagtäglich mit eigenen Augen zu sehen bekam, schien ihm noch um ein Vielfaches reizvoller und interessanter als die Geschichten in seinen Büchern.
Alles ging ihm leicht von der Hand. Er stand um vier Uhr morgens auf und befasste sich mit seinen Männern, mit dem Studium des Kriegsschauplatzes und mit den unerwarteten, aber aufregenden Aufgaben, die Sir John Shore ihm übertrug. Trotz der vielen Aufgaben und der zusätzlichen Arbeit, die er sich selbst auferlegte, blieb ihm noch reichlich Zeit, die Gegend zu erkunden, neue Bekanntschaften zu schließen und alte aufzufrischen. Sein Körper schien überhaupt keiner Ruhepause zu bedürfen, und je mehr er sich aufbürdete, umso ausgeglichener wurde er.
Manchmal stieg er auf sein Pferd und verschwand aus dem Umkreis der Stadt, ohne jemandem zu sagen, warum und wohin er unterwegs war. Meist trieb es ihn hinaus zum Dakshinewar-Tempel, einem hinduistischen Gotteshaus, das Kali geweiht war. Dort stand er dann abseits der indischen Pilger auf einem Hügel und betrachtete das bunte, fremde Treiben mit Kinderaugen. Manchmal zog es ihn ans linke Ufer des Hoogley und in den Botanischen Garten, den gelehrte Männer aus England für die Ostindische Kompanie angelegt hatten, um die Pflanzenvielfalt Bengalens auf engem Raum zu sammeln und zu katalogisieren. Von Zeit zu Zeit wagte er sich sogar bis nach Diamond Harbour hinunter, an die Mündung des Hoogley. Oft ritt er alleine; ab und an erlaubte er John Sherbrooke, ihn zu begleiten.
Doch mit Sherbrooke durch die Gegend zu streifen war nicht unproblematisch. Der Oberstleutnant maß Indien an europäischen Maßstäben. Er hatte Angst davor, mit den Einheimischen in zu engen
Kontakt zu kommen. Er traute sich nicht, bei irgendeinem Straßenhändler seinen Magen mit einem »curry« zu füllen, oder für ein paar Annas heißen Tee mit Milch, Zucker, Kardamom und Kaneel zu trinken. Er fürchtete sich vor Krankheiten, vor der Dunkelheit und davor, sich in diesem weiten, fremden Land zu verirren.
In Indien schien sich fast alles zu ändern. Zu Hause in England – und während das 33. Regiment in Dublin stationiert gewesen war – war John Sherbrooke stets der unternehmungslustigere, selbstbewusstere und forschere Offizier gewesen. Arthur dagegen war ein Arbeitstier gewesen: Er hatte die Soldaten gedrillt, hatte sich mit den Lieferanten und den Horse Guards herumgeschlagen und sich nicht getraut, in seiner abgetragenen Uniform bei irgendwelchen gesellschaftlichen Anlässen zu erscheinen, während Sherbrooke dank seiner einflussreichen Familie und seinem prallen Geldbeutel die politischen Aktivitäten übernahm. Jetzt war es Arthur, der antichambrierte, lavierte und Kontakte knüpfte, der einlud und eingeladen wurde und von Tag zu Tag sicherer und selbstbewusster wurde.
In Indien schien es niemanden zu stören, dass er nur ein einfacher junger Oberst war, und im Unterschied zu all jenen, die sich schon längere Zeit in den drei britischen Besitzungen Westbengalen, Madras und Bombay aufhielten, konnte er neben einer gründlichen militärischen Ausbildung und Fronterfahrung während des Krieges gegen Frankreich überdies mit aktuellem Wissen aufwarten, was die politischen Verhältnisse in England und ganz Europa betraf. Während man ihn in Dublin nicht einmal nach der Uhrzeit gefragt hatte, erkundigte man sich in Kalkutta nach seiner Meinung zu hochexplosiven Themen, bei denen der Einsatz nicht mehr und nicht weniger war als die Vorherrschaft Albions im asiatischen Teil der Welt.
Er ging in Fort William ein und aus, als würde er zu Sir Johns Familie zählen. Der Generalgouverneur hatte sich nach ihrem ersten Treffen die Zeit genommen, den jungen Mann aus der Reserve zu locken, indem er ihn immer stärker in politische Fragen einband, die die Regierung der drei britischen Stützpunkte im allgemeinen und Bengalens im besonderen betrafen. Um so mehr Aufgaben er Wesley auf die Schultern lud, um so besser schienen dessen soldatische Leistungen zu werden, und um so offener und umgänglicher wurde er. Selbst der Resident der Ostindischen Kompanie, William Hickey, verlangte täglich mit Wesley zu sprechen. Er war nicht so ehrgeizig wie die meisten anderen jungen Offiziere, die es nach Indien zog, aber er war ein kluger Kopf und benützte seinen gesunden Menschenverstand und die gründliche Allgemeinbildung, die er sich in langen, einsamen Nächten angeeignet hatte. Wenngleich er einem Gegenüber stets mit Respekt begegnete, konnte er seine Meinung überzeugt vorbringen und furchtlos vertreten.
Arthur war nun seit drei Monaten mit seinem Regiment in dieser neuen Welt und fühlte sich ihr bereits tief verbunden. Irland, seine lieblose Familie und seine unglücklichen Jugendjahre hatte er bereits verdrängt und vergessen. An dem Tag, an dem die Caroline den Hafen von Portsmouth verlassen hatte, hatte er den heiligen Schwur geleistet, nie mehr zurückzublicken. Während seine Offiziere sehnsüchtig nach Hause schrieben, sinnierte Arthur über den Vorteil, Zugochsen vor Geschütze zu spannen. Und wenn ein Schiff aus England in die Hoogley-Mündung einfuhr, konnte man sicher sein, Arthur nicht im Büro des Hafenmeisters zu finden und nach dem Postsack zu schielen.
Während John Sherbrooke sich an einem Spätnachmittag Anfang Mai gemeinsam mit Major West aufmachte, in den Hafen zu reiten und nach Briefen aus der Heimat zu fragen, sattelte Arthur seinen Hengst, um Miss Charlotte Hall einen Besuch abzustatten. Er sah die junge Frau oft und verbrachte viel Zeit mit ihr. Doch wenngleich man hinter Arthurs Rücken über eine Romanze zwischen ihm und Charlotte tuschelte und bereits Wetten abschloss, ob und wann er ihr einen Antrag machte, waren die Treffen so harmlos, dass Lady Hall den jungen Offizier sogar mit ihrer Tochter allein ließ.
Niemand hätte es ihm geglaubt, doch sein einziges Interesse an Charlotte galt ihrer ausgezeichneten Kenntnis der Landessprachen. Immer wenn er Zeit hatte, packte er seine Bücher in die Satteltaschen, ritt nach Chowringee und verbrachte Stunden damit, wie ein Schuljunge vor einer Schiefertafel zu sitzen, an die Charlotte Worte in Hindustani schrieb, die Arthur dann artig wiederholte, bevor er sie sorgfältig in sein kleines Notizbuch notierte.
Die beiden hatten ein sehr gutes Verhältnis, lachten viel zusammen und amüsierten sich – aber mehr auch nicht: Die Frau in Charlotte schien Arthur ebenso wenig zu interessieren, wie sie sich für seinen roten Rock und seine breiten Schultern interessierte. Man hätte glauben können, sie wären Bruder und Schwester.
Charlotte war so ganz anders als Katherine Pakenham zu Hause in Irland oder Henrietta Smith in Kapstadt. Sie hatte ihrer Brille wegen bereits in Kindertagen viel Spott ertragen müssen, doch statt sie zu verschüchtern, hatten der Spott und die Ablehnung sie selbstsicher und stolz gemacht. Charlotte trat ganz anders auf als die meisten jungen Mädchen in ihrem Alter: Sie kokettierte nicht und schmeichelte nicht, sie war selbständig, aufrichtig, mitunter sogar ruppig, und sie schien weder ängstlich noch schutzbedürftig zu sein.
Vor allem war sie überaus gebildet und intelligent: Weil ihr die meisten gesellschaftlichen Vergnügungen trotz ihres hohen gesellschaftlichen Ranges verschlossen geblieben waren, hatte sie die Zeit damit verbracht, zu lernen und ihren Verstand zu schulen. Sir Edwin Hall hatte den Lerneifer seiner Tochter noch gefördert, indem er sie von teuren Privatlehrern aus Europa unterrichten ließ. Außerdem war es ihr zur Gewohnheit geworden, alleine – oft in Landeskleidung – die neue Welt zu erkunden und die Einheimischen zu beobachten.
Als Arthur an diesem Nachmittag bei den Halls eintraf, erwarteten ihn keine Schiefertafel und kein Sprachunterricht. Noch bevor er sein Pferd in Sir Edwins Stall abgesattelt hatte, tauchte eine schmächtige Gestalt in Reithosen, einem weiten Hemd und einer bunt bestickten ärmellosen Weste neben ihm auf. Die langen Haare wurden von einem sorgsam geschlungenen Turban aus dunkelblau gefärbter Baumwolle verborgen. Nur an der kleinen runden Brille konnte man erkennen, dass es sich um die Tochter des Hauses handeln musste. Mit einer forschen Bewegung warf sie dem Kommandeur des 33. Regiments ein Bündel Kleider vor die Füße.
Читать дальше