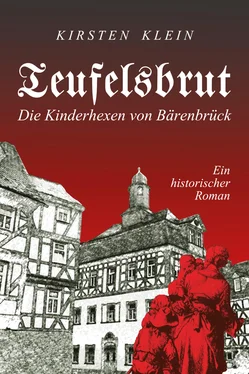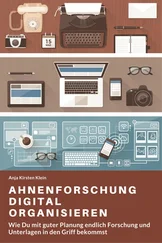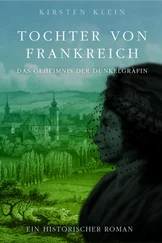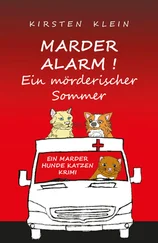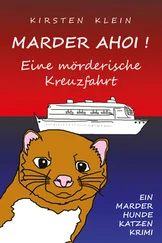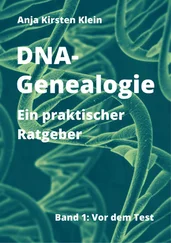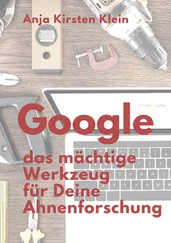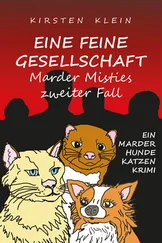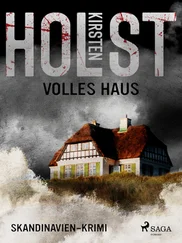Maries Augen schweiften über die Wiese. Michael öffnete den Mund, um gegen ihr Geplapper anzusprechen, aber irgendetwas ließ ihn innehalten. Zu seinem eigenen Erstaunen lauschte er gebannt den Worten der Kleinen – er, der sich mit seinen vierzehn Jahren endlich den anderen Knaben bei ihren Zusammenkünften anschließen durfte.
Die unerwartete Aufmerksamkeit bestärkte Marie. Ein lustiges Treiben sei hier gewesen, ereiferte sie sich, viele Leut’ – so viele, dass man die Wiese nicht mehr gesehen habe.
„Leute?“ Barbara zögerte. „Aus Bärenbrück?“
Marie nickte und plapperte weiter. Die Schustersfrau habe sie gesehen und den Lukas, der in der alten Stadt wohne, ganz nah am Fluss – und noch viele andere. Getanzt hätten sie alle, um ein großes Feuer herum, worin Fleisch am Spieß gebraten worden sei.
Das Kind sprang auf und tanzte über die Wiese. Alle sahen ihm zu. Auch Schafe und Ziegen hoben die Köpfe.
Anna drückte sich an Barbaras Seite und erschrak, als sie spürte, wie selbst die Neunzehnjährige zitterte. „Mich fröstelt“, meinte sie, rieb sich die Arme und bedachte Anna mit einem entschuldigenden Blick. „Es ist eben noch recht frisch hier draußen.“
Anna nickte scheu. Als Barbaras Augen unversehens Martins begegneten, wandte sie sich abrupt ab und fröstelte nur noch mehr, fragte sich, was ihr solch einen Schrecken einjagte. Es war nicht allein jene seit einiger Zeit stets gegenwärtige Verlorenheit im Blick des Jungen. Da war noch etwas anderes. Aber ehe Barbara darüber nachdenken konnte, erforderte wieder Marie ihre Aufmerksamkeit. Die Kleine erstarrte in tänzerischer Pose, als sei ihr etwas Wichtiges eingefallen, und deutete auf den Fluss. „Da bin ich getauft worden – genau da!“, rief sie aus. „Aber das Wasser war ganz rot.“
„Das hast du einmal so gesehen, als die Sonne untergegangen ist und sich im Wasser gespiegelt hat“, meinte Barbara beschwichtigend.
„Nein, es war blutig.“ Marie duldete keinen Widerspruch. „Meine Großmutter hat mich dem Teufel vorgestellt. Der hat mich geritzt und mit meinem Blut getauft.“
Wie sollte dieses ahnungslose Ding auf dergleichen kommen – wenn es nicht so gewesen war? „Und – hast du dem Heiland abschwören müssen?“ Michaels Stimme fieberte.
Marie schüttelte gelassen den Kopf. „Nein, das hab’ ich nicht getan. Dafür bin ich noch nicht verständig genug, hat meine Großmutter gemeint.“
„Dann ist es noch nicht zu spät für dich – vielleicht.“ Barbara sah den Kindern an, dass ihre Worte verrieten, wie ernst sie Maries Geschichten nahm. „Ach was, das hast du dir doch alles nur zusammengesponnen“, fügte sie schnell hinzu. „Erzähl’ niemandem mehr davon, hörst du? Und lustig kann das schon gar nicht gewesen sein.“
Marie spürte die verhohlene Neugier der Großen. „Oh doch, doch, furchtbar lustig war’s. So viel Freud’ darf ich sonst nie haben.“
„Wenn es so lustig ist, will ich auch mal dabei sein. Ich erzähle es keinem.“
Barbara fuhr ihrem Bruder über den Mund. „Michel, hör’ nur, was du da sagst.“
„Du hast mir nichts zu sagen“, wies der Junge seine Schwester zurecht. „Mir können sie so leicht nichts anhaben. Dir würde ich es freilich nicht raten.“
„Michel“, wiederholte Barbara, „auch wenn du schon vierzehn bist und die anderen Knaben dich aufgenommen haben – das Böse soll man nicht herausfordern. Dem kann auch ein ausgewachsenes Mannsbild anheim fallen.“
„Ich werd’ ihm standhalten.“
Barbara erschrak über die Entschlossenheit in Michaels Stimme und bereute, dass sie offensichtlich seine aufkeimende Mannesehre angegriffen hatte. Nun musste er erst recht darauf bestehen und durfte sich vor den Mädchen, besonders vor der erst Fünfjährigen, keine Blöße geben. Insgeheim beschloss Barbara, zu Haus nochmals auf ihn einzuwirken.
„Wirst schon sehen“, sprach Michael in ihre Gedanken hinein, „wie ich mit dem Teufel umspringe.“ Dabei rannte er auf einen Ziegenbock zu, fasste ihn an den Hörnern und zerrte ihn im Kreis herum.
Barbara entzog sich seinem Blick, der Zustimmung heischte, und sah zum Frühlingshimmel. So hell, so klar leuchtete er – jetzt, nachdem der Winter hoffentlich vertrieben war. Lautlos sandte sie ein Stoßgebet hinauf.
Die Hütekinder auf der anderen Seite mieden das direkte Ufer, denn angeblich hatte die Glutach bisher nur unter ihnen Opfer gefordert. Kaum einer glaubte dabei an einen Zufall, zumal Ermittlungen ergeben hatten, dass Unglücksfällen stets Streitigkeiten zwischen Kindern beider Seiten vorausgegangen waren. Obendrein lag das Judengässle im alten Stadtteil, auf südwestlicher Seite. Sogar Erwachsene gingen nicht nah am Ufer entlang, obwohl Kinder beliebtere Opfer böser Wünsche waren und deshalb öfter ertranken – nach allgemeiner Überzeugung. Nordwestlich verlief die Mauer ohne Tor, und erst innerhalb der Stadt, östlich der Spitalkirche, führte der schmale Fischersteg zum anderen Ufer hinüber.
So blieb dem von Osten kommenden Besucher oder Durchreisenden der Weg durch die Armut nicht erspart, es sei denn, er schlug einen Bogen zum nördlichen Tor. Dann konnte er durch die Weinberge spazieren, den Duft frischen Grüns atmen und seinen Durst auf den Rebensaft anregen. Wem die Wahl blieb, seine Tageszeit dermaßen lustwandelnd zu verbringen, der gehörte sowieso auf die Sonnenseite.
Gottlob Lammer war auf der Sonnenseite ansässig, zwischen den Palästen der Patrizier. Auch er sah oft auf die Bewohner der armseligen Häuserzeile am nördlichen Ufer der Glutach herab, die immerhin im Schatten der patrizischen Anwesen lag – allerdings hauptsächlich von der Kanzel aus. Pfarrer Lammer war davon überzeugt, dass vor allem diese Menschen, wie jene auf der anderen Seite, obrigkeitlicher Aufsicht bedurften und unter ihnen wiederum in besonderem Maße die Kinder, welche noch schwach und formbar waren, also begehrte Objekte des Teufels. In diesem Bewusstsein hatte Lammer bereits kurz nach seinem Amtsantritt vor knapp zwanzig Jahren den ehemaligen Kornspeicher am Fuße des Pfarrhauses zu einer Elementarschule umbauen lassen. Das hatte sein Durchsetzungsvermögen hart gefordert, waren doch die Einschnitte des erst ein Jahr zuvor beendeten Krieges in Bärenbrück wie überall sonst tief und nur allmählich zu heilen. Die Leute konnten sich nicht für die Schule begeistern, denn dann mussten sie ja täglich mehrere Stunden die Mitarbeit ihrer Kinder entbehren. Natürlich wollte jeder mithelfen, die Kleinen zu gottesfürchtigen Christen zu erziehen, was laut Lammer nur werden konnte, wer den Katechismus fleißig lesen und auswendig aufsagen lernte. Außerdem hatten viele noch miterlebt, was einer Stadt drohte, wenn das Böse in ihren Gassen erstmal Fuß gefasst hatte und nach dem griff, worin ihre Zukunft lag – nach den Kindern.
Wo also einst Heu und Feldfrüchte lagerten, beschloss Lammer, künftig in Gottes Sinne menschlichen Geist und Seele unter seinen Augen reifen zu lassen.
Zuerst unterrichtete Gottlob Lammer selbst, doch als verantwortungsbewusster Hirte durfte er sich nicht nur den Lämmern seiner Herde widmen. Bei den Knaben vertrat ihn inzwischen fast ständig Johannes Kurzhals, ein etwas zur Melancholie neigender, aber tüchtiger junger Gelehrter. Zur Unterrichtung der Mädchen lenkte Gott Lammers Augenmerk bald auf Reinhild Rotnagel, eine patrizische Jungfer, die durch ihre fast unweibische Gelehrsamkeit einen zweifelhaften Ruhm errungen hatte und dem Heiratsalter entronnen war. Was jedem möglichen Heiratswilligen zu suspekt war, erschien Lammer einer Herde Schulkinder gerade angemessen.
Jungfer Rotnagel fügte sich in das Lehramt, und über die Jahrzehnte hinweg hatte sich kaum etwas in Bärenbrücks Elementarschule verändert, einschließlich des Kampfes, den Lammer um jeden Schultag mit den Eltern führen musste. Er begann auch in diesem Frühling, sobald das Vieh wieder auf die Weide durfte und die Felder bestellt werden mussten.
Читать дальше