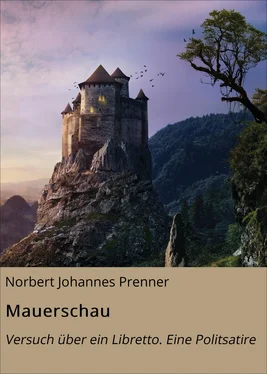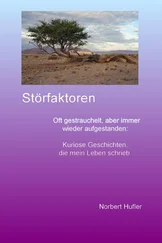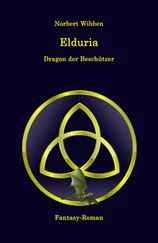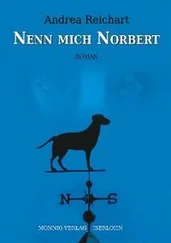Da wurde ihr seitens übergeordneter Großbühnenregie eine Atempause verordnet, damit sie wegen ihres rasanten Emporsprießens nicht kollabiere. Die großen Vorhänge gegen Osten hin waren ja bereits teilweise zur Seite geschafft und auf die Vorteile für das Publikum ausreichend hinge-wiesen worden. Wenn sie auch nicht gleich erkennbar waren, so waren sie durchaus nicht für alle von gleicher Bedeutung gewesen. Bloß einige Wenige profitierten davon, hieß es aus den Reihen der Analysten, und die könnten es sich leisten, niedrigere Eintrittspreise zu bezahlen und würden überdies auch noch großzügig unterstützt werden. Leidtragend wäre das Publikum aus den billigen Reihen, so hieß es, und es wäre überaltert, ebenso wie das aus den Logen und im Parkett. Rückläufig wäre man, und neues Publikum sollte hereingelassen werden, Qualitätspublikum versteht sich. (Wer konnte damals schon ahnen, dass das Land eines Tages völlig überrannt werden würde?)
Das Problem war, man hatte zu viele Unbeschäftigte in der Statisterie, daher durfte man in der Öffentlichkeit nicht einfach so darüber reden. Als es jedoch da-rum ging, der Grande Opéra ein neues Statut zu verordnen, welches kurze Zeit später publik geworden war, ging ein Raunen durch die Reihen des Publikums, denn es wäre zu umfangreich. Von Sprachverwirrung war die Rede, ein Sprachdschungel wäre es. Den Vertretern der Chordirektion, der Laiensänger und den Leuten aus der Publikumsvertretung wurde obendrein vorgeworfen, sie würden auf der heimischen Operettenbühne ganz anders agieren als auf jener der Grande Opéra. Und dann kam es, wie es eben kommen musste – noch kaum am Leben und beinahe, nun ja, eine Totgeburt sozusagen / Stillstand des Lebensprozesses / vorzeitiger Exitus. Derselbe wurde sofort genauestens amtlich registriert. Requiescat in pace! Fünfhundert Seiten stark / so etwas wäre nicht zu kapieren, schrien die Theaterkritiker. Dieses Statut war also tot, an das sich Choristen und Darsteller, allen voran die Regie und Chor wie an ein Seil, welches rettend vom Schnürboden gehangen war, geklammert hatten, um daran jene Ideen festzumachen, die alle hätten einigen sollen. Was war nun zu tun? Fürwahr ein schwerer Schlag für die Ersten, die in dieser An-gelegenheit eine wichtige Rolle gespielt hatten. Für die erste Hälfte der Zweiten eigentlich auch, die gespalten waren und mit den Ersten vernabelt waren. Die zweite Hälfte der Zweiten, die schon immer Bedenken gegen die internationale Großbühne hegte, rieb sich vergnügt ihre vom Beifallgeklatsche wunden Händchen. Die Dritten und Vierten mimten Betroffenheit die sich in Grenzen hielt.
Die Schuld am Scheitern des „Esprit de lois“ lag an der Entscheidung aus der Comédie, war zu vernehmen, also dort, wo die Hähne angeblich lauter krähten als anders wo. Die Nachricht vom Tod des Statutes trieb den Keil der Uneinigkeit nur noch tiefer in die Wunden kollektiven Bühnenunbewusstseins, nämlich auch zwischen die unterschiedlichen Altersgruppen der Publikumsgenerationen. Die Jungen sahen erwartungsgemäß immer alles etwas positiver und reagierten mit Coolness. Aus Sicht des älteren wie auch des Seniorenpublikums assoziierte man eher negative Phänomene und befürchtete in diesem Zusammenhang die Einschränkung bisheriger Vergnügungen und mehr Verschwendung, was wiederum die Skepsis gegenüber Fremdpublikum nährte. Sofort richteten sich geistige Kreuzzüge unerbittlich gegen alle Bedroher abendländischer Operettenkultur. Da wollte man schon lieber unter sich sein, im Süden besser am Untersichsten. Ja, schon, ein bisserl dabei sein, aber doch nicht gleich so, von überall nur ein wenig naschen, auf keinen Fall aber etwas hergeben müssen, das kam über-haupt nicht in Frage.
Und während einige vehement forderten, das Publikum müsste sich radikal verändern, verfielen andere jammernd in konservativ Nostalgisches. Überdies stand da noch eine Frage im Raum: Was - was bitte schön sollte denn erinnert werden, um sich als Operettenländler mit der Grande Opéra identifizieren zu können? Ein Ort und eine Münze waren dafür herzlich wenig. Vielleicht sollte man im christlichen Schauspiel danach suchen? War dies etwa bisher überbewertet worden? Aber nein, denn was wäre die Operettenbühne ohne ihre teleologische Vorstellung? Was wäre sie ohne christliches Gotteslob, ohne Marienvesper und Requiem?
Bisher war alles, was auf heimischem Bühnenboden entstanden war, stets in biologistischer Manier auf erklärbare Weise gewachsen, zurechtgestutzt, emporgeschossen, ausgerissen und neu angepflanzt worden und niemals zuvor hatte etwas über Nacht gekeimt, so aus dem Nichts heraus, wie – wie – na, wie eben eine Zauberbohne. Beobachtern und Kennern einzelner Szenen war nicht entgangen, dass das Wissen und Bewusstsein um Vorführungen aus der Vergangenheit im Publikum langsam zu verblassen drohte, und damit verschwand die Symbolik wie auch der Mythos, um nur noch zu nostalgischer Lebenswelt von Freizeitunterhaltung abzugleiten, in all´ ihrem Schick, welcher sich jenseits der Lebenspraxis anzusiedeln begonnen hatte. Emotional-symbolische Stabilität hatte sich zu Ökonomisch-Politischem hin verlagert, Operette drohte zu Regietheater zu verkommen. Danach also war an eine weitere Vergrößerung des Zuschauerraumes nicht mehr zu denken und dem Publikum war dies noch weniger ein Anliegen als zuvor. Alles Event-hafte drum herum reflektierte ohnehin nur viele Fragen und inhalts-lose Floskeln, jedoch keine konkreten Antworten auf die Frage nach kollektivem Bewusstsein. Die alten Metaphern der Freiheit, Gerechtigkeit und Mitspracherecht genügten nicht mehr, um die Identität anspruchsvollen Theaters zu definieren.
Alle Leute fragten sich, ob es nicht noch mehr gäbe? – Es herrschte Ratlosigkeit. Bühne durfte nicht zum Publikumsschlager verkommen, nein, sie sollte – ganz richtig – mehr sein! Die Grande Opéra litt entsetzlich unter Wachstumsschmerzen, und einige monierten, sie wäre in einer – Krise. Sie sei in keiner Krise, dementierte die Regie. Möglicherweise etwas zu rasch gewachsen. Man müsste das Tempo ihrer Entwicklung hinterfragen! Das alte Vereinigungsstatut sei zwar tot, jedoch die Reflexionen über ein neues müssten fortgesetzt werden. Eine Klausur wurde beschlossen um darüber zu beraten, wie man künftig vorgehen wollte. Diese müsste wohl ein Jahr dauern. Schon war von „Grande Museé“ die Rede. In einem kryptischen Ballspieltopos sinnierte die Regie kunst-voll über eine Nachspielzeit, weil es noch nicht zum Elferschießen gekommen sei. Derweil fanden Volksfeste für Wunderkinder aus der Vergangenheit und Gegenwart statt, die eine Zeit lang für Ablenkung sorgten.
Der Komet
Da plötzlich geschah es, dass ein Komet in die Operettenbühne einschlug, der, völlig unerwartet, eine tragende Säule der Publikumsvertretung mit voller Wucht ins Herz traf und sie aus den Angeln hob. Zunächst schien es, als hinterließe die Katastrophe nur Helden, die dem unglaublichen Angriff aus dem Nichts mit stolz geblähter Brust trotzen. Einer alten Familientradition zufolge sollte an eine dieser Brüste, vom Bühnenmeister höchst persönlich angeordnet, ein, wenn auch nur virtueller Orden montiert werden, den zu verdienen es weiland galt, seine Tapferkeit vor dem Feind wie auch eigenstrategisches Denken unter Beweise gestellt zu haben, was, wie sich kurz daraufhin herausstellte, in diesem besonderen Fall ganz und gar nicht als derart qualifizierend nachempfunden werden konnte. Und siehe, wiederum kurze Zeit später nahm man von der Ordensverleihung bereits wieder Abstand, ja, beschuldigte den designierten Träger sogar der Mitschuld an dem interplanetaren Desaster, der überdies, wie vom Erdboden verschluckt, von der Bühne verschwunden war. Damit sich so etwas in Zukunft nicht mehr wiederholen sollte, wurden Kontrollinstanzen ins Leben gerufen, welche die Kontrolleure kontrollieren sollten.
Читать дальше