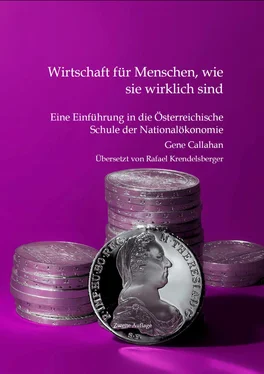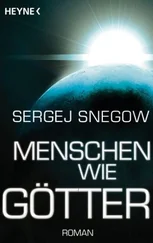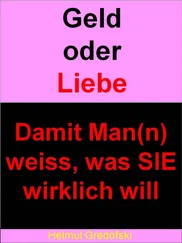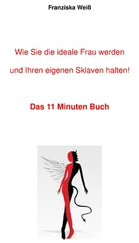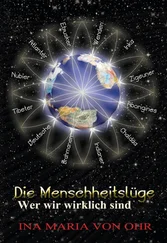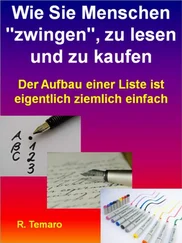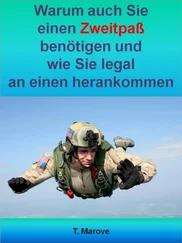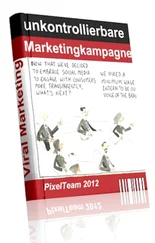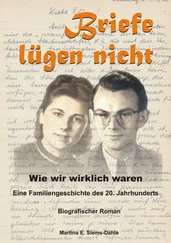1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 Also entscheidet sich Rich und teilt seine Zeit auf. Sagen wir, dass er jeden Tag die ersten vier Stunden damit verbringt, Essen zu sammeln, die nächsten zwei schöpft er Wasser und die nächsten vier arbeitet er an einem Unterstand. Den Rest des Tages ruht er aus.
Alle der oben angeführten Handlungen haben das Ziel, Unzufriedenheit zu beseitigen. Das Essen stillt direkt seinen Hunger, das Wasser seinen Durst und der Unterstand deckt sein Bedürfnis nach Schutz vor Wind und Regen. Sogar seine Freizeit ist eine Handlung mit dem Gedanken an ein Ziel: Erholung. Solange Rich körperlich dazu im Stande ist, mit der Arbeit fortzufahren, besteht die Entscheidungsmöglichkeit, aufzuhören und auszuruhen.
Wir werden den Punkt betrachten, an dem Rich seine Entscheidung trifft, weil er die wesentliche Erkenntnis illustriert, mit der Carl Menger das Wertproblem löste, das die klassische Ökonomie geplagt hatte.[2] Stellen Sie sich vor, dass Rich versucht, Pfosten für seinen Unterstand miteinander zu verbinden. Er hat gegessen, er hat Wasser und mit dem Unterstand geht es ganz nett vorwärts. Darüber hinaus fühlt er sich langsam ein bisschen erschöpft.
Wann wird er dann mit der Arbeit aufhören? Das wird an dem Punkt geschehen, wenn die Befriedigung, die Rich von der nächsten „Einheit“ an Arbeit erwartet, niedriger ausfällt als die Befriedigung, die Rich von der ersten „Einheit“ an Ausruhen erwartet. Diese Tatsache wird schon alleine durch die Existenz des Auswählens vorausgesetzt. Auswählen bedeutet, etwas zu reihen. Daher wird Rich arbeiten, solange er den Gewinn, den er aus der nächsten Arbeitseinheit erwartet, dem Gewinn vorzieht, den er aus der nächsten Ruheeinheit erwartet.
Die „Einheit“, um die es hier geht, ist einfach das Zeitintervall, in das Rich seine Arbeit gedanklich unterteilt. Die nächste Einheit könnte zum Beispiel darin bestehen, den nächsten Satz Pfosten zusammenzubinden oder eine Kokosnuss zu pflücken. Die Einheit wird sehr wahrscheinlich eine Aufgabe sein, die es nicht wert ist, begonnen zu werden, wenn sie nicht fertiggestellt wird. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn Rich eine Kokosnuss pflückt, sie dann aber zu Boden fallen lässt und nach Hause geht, ohne sie in seine Tasche zu geben. Die Menge an Zeit, die Rich als Einheit betrachtet, wird von Aufgabe zu Aufgabe und von Tag zu Tag verschieden sein, selbst wenn sie dieselbe Arbeit betrifft – sie ist subjektiv. Was zählt, ist die spezielle Aufgabe, die er gerade in dem Moment als nächste Handlung betrachtet, wenn er Feierabend macht.
Rich ist gerade dabei, mit dem Zusammenbinden der Pfosten zu beginnen, als er ein leichtes Stechen im Rücken spürt. „Hm“, fragt er sich, „Zeit zum Ausruhen?“ In diesem Moment trifft er eine Wahl, und zwar zwischen der Befriedigung, die er meint, aus dem Zusammenbinden des nächsten Bündels an Pfosten zu gewinnen und der Befriedigung, die er glaubt von einigen Minuten an Ausruhen zu erhalten. Weil Bevorzugung an einen konkreten Akt der Auswahl zwischen speziellen Mitteln gebunden ist, die auf einen speziellen Zweck abzielen, wählt die ökonomische Entscheidung nicht zwischen Abstraktionen. Rich wählt nicht zwischen „Arbeit“ und „Freizeit“ an sich, sondern zwischen einer besonderen Arbeit und einer speziellen Dauer von Freizeit, und das unter speziellen Umständen.
Diese Erkenntnis löst das Wertparadoxon, das die klassischen Ökonomen verhext hatte. „Warum“, so fragten sie sich, „wenn Wasser um so viel mehr wert ist als Diamanten, zahlen Menschen so viel für Diamanten und so wenig, wenn nicht gar nichts, für Wasser?“ Die katastrophale Arbeitswerttheorie, die versuchte, den Wert einer Ware mit der Menge an Arbeit gleichzusetzen, die in das Gut eingegangen war, wurde entwickelt, um dieses Manko zu beheben. Karl Marx baute einen Großteil seines Gedankengebäudes auf der Arbeitswerttheorie auf.
Was den klassischen Ökonomen entging, ist die Tatsache, dass niemand jemals zwischen „Wasser“ und „Diamanten“ wählt. Das sind lediglich abstrakte Begriffe, mit denen wir die Welt kategorisieren. In der Realität trifft auch niemand eine Wahl zwischen „allem Wasser in der Welt“ und „allen Diamanten in der Welt“. Wenn ein handelnder Mensch wählt, dann ist er mit einer Auswahl zwischen konkreten Mengen von Gütern konfrontiert. Er hat die Wahl zwischen, sagen wir, einem Fass Wasser und einem Zehn-Karat-Diamanten.
„Warten Sie“, möchten Sie hier einwenden, „ist das Wasser nicht immer noch nützlicher als der Diamant?“ Die Antwort lautet: „Das hängt davon ab.“ Es hängt vollständig von der Bewertung der Person ab, die vor der Entscheidung steht. Ein Mensch, der gleich neben einem Bergbach voll von klarem sauberen Wasser lebt, wird ein Fass Wasser nicht hoch schätzen (wenn überhaupt), wenn ihm eines angeboten wird. Der Bergbach versorgt ihn mit mehr Wasser als er verwenden kann. Der Nutzen der zusätzlichen Wassermenge ist für ihn gleich null (vielleicht ist er sogar negativ, weil ihn das Wasserfass ärgert, das dann ständig im Weg steht). Aber dieser Bursche hat vielleicht keine Diamanten, also könnte die Möglichkeit, einen zu erwerben, für ihn verlockend sein. Es ist klar, dass der Mann Diamanten höher einschätzen wird als Wasser.
Wenn wir die Lebensumstände desselben Menschen ändern, könnte sich seine Bewertung vollständig ändern. Wenn er die Sahara mit einem Diamanten in der Tasche durchquert, ihm aber das Wasser ausgeht und er am Rande des Verdurstens steht, wird er höchstwahrscheinlich den Diamanten sogar für ein Glas Wasser hergeben (wenn er ein Geizhals ist, könnte er den Diamanten immer noch höher bewerten als das Wasser, selbst wenn er dabei das Risiko eingeht, an Durst zu sterben).
Der Wert von Gütern ist subjektiv – genau dieselbe Menge Wasser beziehungsweise Diamant kann von verschiedenen Personen verschieden bewertet werden und sogar von derselben Person zu verschiedenen Zeiten verschieden bewertet werden. Um es mit Menger auszudrücken:
„Wert ist daher keine inhärente Eigenschaft von Gütern, sondern die Wichtigkeit, die wir der Befriedigung unserer Bedürfnisse zuschreiben […] und die wir konsequenterweise auf ökonomische Güter […] übertragen als den Ursachen der Befriedigung unserer Bedürfnisse (Grundsätze der Volkswirthschaftslehre).“
Viele Mittel können für mehr als nur einen Zweck eingesetzt werden. Rich könnte Wasser für viele Verwendungen einsetzen. Zuerst wird er Mittel, die mehr als einem Zweck dienen können, der Verwendung zuführen, die er für die wichtigste hält. Das ist keine Tatsache, die aus Beobachtungen unzähliger Handlungen abgeleitet wurde, sondern eine logische Notwendigkeit. Wir können sagen, dass die erste Verwendung für Rich die wichtigste war, und zwar genau deshalb, weil er sich dazu entschlossen hat, dieses gefühlte Bedürfnis zuerst zu stillen.
So lange wie es Richs Ziel ist zu überleben, wird er den ersten Kübel Wasser, den er schöpfen kann, zum Trinken verwenden. Nur dann, wenn er sicher ist, dass er genug Wasser hat, um nicht zu verdursten, wird er es in Betracht ziehen, es zum Kochen zu verwenden. Nachdem jeder Kübel Wasser für einen weniger wichtigen Zweck eingesetzt wird, hat also für Rich jeder weitere Kübel einen niedrigeren Wert als einer der vorher errungenen. Der Nutzen jedes zusätzlichen Kübels nimmt für Rich ab. Wenn er eine Wahl treffen muss, dann ist es jeweils das nächste Stück, das erworben wird oder das erste, das aufgegeben werden muss, das von Belang ist. Ökonomen nennen dies die marginalen Einheiten und bezeichnen das Prinzip als das Gesetz des abnehmen den Grenznutzens.
Die Spanne, um die es geht, ist weder eine physikalische Eigenschaft des betrachteten Ereignisses, noch kann sie objektiv berechnet werden. Die Spanne ist die Grenzlinie zwischen Ja und Nein, zwischen Auswählen und Zur-Seite-Legen. Die marginale Einheit ist diejenige, über die Sie entscheiden: Werden Sie heute eine zusätzliche Stunde arbeiten? Sollten Sie auf einer Party bleiben und sich noch einen Drink genehmigen? Werden Sie einen weiteren Tag in diesem Hotel an Ihren Urlaub anhängen?
Читать дальше