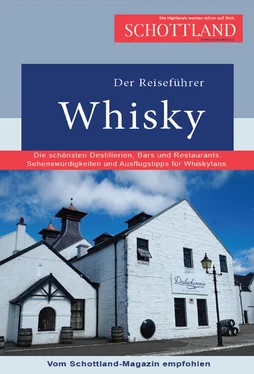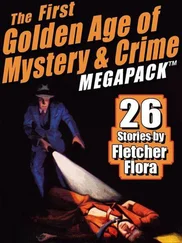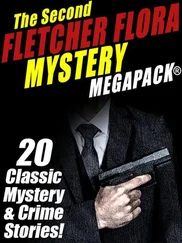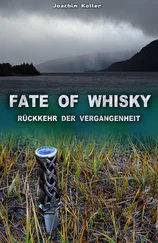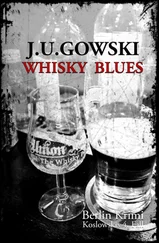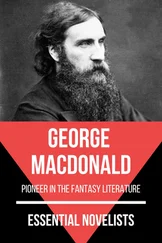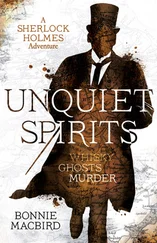Außerdem waren die Pubs in vielen schottischen Städten oft wenig auffällig im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses untergebracht und damit von den kleinen Ladengeschäften rechts und links kaum zu unterscheiden.
Auch die Trinkgewohnheiten waren andere. Für die Engländer waren Kneipen ein wichtiger sozialer Treffpunkt. Die Schotten dagegen sahen in den Pubs lange Zeit nicht mehr als einen Verkaufsraum. Viele schottische Pubs nennen sich heute noch „Bar“ (wie etwa Bennets Bar in Edinburgh) und erinnern damit an diese Zeit.
Da die Schotten außerdem lieber härtere Sachen, sprich Whisky tranken, musste anders als in England auch noch Platz für die Whiskyfässer geschaffen werden. Ein besonders schönes Beispiel dafür, wie sich größere Mengen Whisky in einem Pub dekorativ verstauen lassen, ist das Abbotsford in Edinburgh. In vielen Pubs wie dem Feuars Arms in Kirkaldy wurden Extra-Wasserhähne eingebaut, weil die Schotten ihren Whisky nun einmal gerne mit einem Schuss Wasser mischen.
Die schottischen "Pubpaläste"
Der Wettbewerb der Wirte untereinander war hart, und so entstanden um 1900 in den großen Städten wahre Pubpaläste („palace pubs“). Die edle Ausstattung mit Chrom und Holzschnitzereien sowie das Licht, das von zahllosen Spiegeln reflektiert wurde und durch bunte Glasscheiben auf die dunkle Straße fiel, sollten Kunden anlocken. Ein Beispiel dafür ist das Ryrie´s in Haymarket Terrace in Edinburgh.
Ein typischer palace pub ist auch das Cafe Royal. In der Central Bar in Leith von 1899 sind die Wände mit edlen Fliesen verziert. So ist es nicht verwunderlich, dass die Schotten stolz auf ihre Pubkultur sind. „Über die große Mehrheit der schottischen Pubs gibt es jede Menge Geschichten zu erzählen“, sagt Paul Waterson, Chef des Branchenverbands SLTA.

Manche Kneipenbesitzer gingen mit der Zeit und richteten ihre Pubs nach der neuesten Mode ein. Das Portland Arms in der Shettleston Road in Glasgow sowie Frews Bar in der Strathmartine Road in Dundee wurden in den 30er Jahren eröffnet und sind schöne Beispiele für den Art Deco-Stil, der damals modern war. „The Grill“ in der Union Street in Aberdeen ist von 1926 und zeigt, wie die Traditionen aus dem 19. Jahrhundert auf modernere Art umgesetzt wurden.
Alkoholgegner sorgte für eine weitere Variante in der schottischen Kneipenkultur. Sie wetterten heftig gegen die „pub palaces“, die in ihren Augen eine zu große Versuchung vor allem für die „working class“ darstellten. Im schwedischen Göteborg gab es zu dieser Zeit Kneipen, die viel schlichter eingerichtet waren. Dieser Stil wurde nach Schottland importiert. „The Gothenburg Pubs“ setzen sich vor allem in den kleinen Bergarbeiterstädten in Lothian und Fife durch, und die Dean Tavern in Newtongrange sowie das Goth in Armadale sind bis heute erhalten geblieben.
Einer der kleinsten Pubs in Schottland steht in Craigellachie beim River Fiddich. Der Fiddichside Inn ist sehr schlicht eingerichtet. Er stammt aus dem Jahr 1842 und war eine Anlaufstelle für die Arbeiter, die mit dem Bau der Bahnlinie für die Morayshire Railway beschäftigt waren. Ähnlich gut erhalten ist die Railway Tavern in Kincardine. Das Gebäude ist aus dem 18. Jahrhundert und lag direkt an der Route, auf der die Farmer ihr Vieh auf den Markt trieben. Von außen ist der Pub kaum erkennbar. „J Dobie Licensee“ steht auf einem kleinen Stein über der Eingangstür gemeißelt. Das muss als Hinweis reichen, dass dies nicht etwa ein Wohnhaus steht, sondern ein Pub.
Allerdings sorgen sich viele Briten inzwischen um die einheimischen Pubs. Trotz ihres unverwechselbaren Charakters sind viele britische Pubs von Schließung bedroht. Durchschnittlich 18 Kneipen pro Woche sperren auf immer zu.
Diesen Text drucken wir mit freundlicher Genehmigung des Schottland-Magazins.
http://www.schottland.co
PLEITEWELLEN UND AUFSCHWUNG
Die schottischen Brennereien haben eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Pleitewellen auf Aufschwung wechselten sich ab. Derzeit blicken die Whiskymanager wieder optimistisch in die Zukunft.

Wie viel Whisky trinken die Chinesen in fünf Jahren? Wie entwickelt sich der französische Markt bis 2025? Oder: Werden die Verbraucher rauchigen Whisky in zehn Jahren noch genau so nachfragen wie heutzutage?
Solche Fragen stellen sich die Manager in den schottischen Destillerien. Denn ihr Whisky lässt sich nicht von heute auf morgen herstellen und verkaufen. Mindestens drei Jahre dauert es, bis der Whiskyausgangsstoff „Spirit“ im Fass gereift ist und sich überhaupt Scotch Whisky nennen darf. Doch die meisten Whiskys werden nicht schon nach drei Jahren auf den Markt gebracht, sondern bleiben weitere fünf, zehn, manchmal 20 Jahre in den Lagerhäusern der Brennereien.
Daher ist das Whiskymachen ein Geschäft mit der Zukunft. Dem langen Warten stehen umfangreiche Investitionen in Produktionsanlagen oder sogar in den Bau neuer Brennereien gegenüber. Solche teuren unternehmerischen Entscheidungen verlangen von den Managern manchmal fast hellseherische Fähigkeiten - und das geht auch mal gehörig schief.
„Boom and Bust“
Der Boom und der Niedergang gehören daher im Whiskygeschäft zusammen. Rückblickend erlebte die Industrie in den vergangenen 150 Jahren zwei Mal einen gehörigen Boom und ebenso große Pleitewellen.
Der erste große Boom setzte im späten 19. Jahrhundert ein, als die Nachfrage nach Blended Whisky sprunghaft anstieg. Neue Produktionsanlagen wurden gebaut und nicht weniger als 33 Brennereien wurden allein in den 1890-er Jahren neu eröffnet. Allein in der Whiskyregion Speyside entstanden in den 1890-er Jahren rund 20 neue Brennereien.
Investoren fanden sich reichlich, die Whiskyherstellung galt als sichere Wertanlage. Dabei zeichnete sich die Überproduktion bereits ab: In den Jahren 1891 und 1892 lagerten rund 7,6 Millionen Liter in den schottischen Lagerhäusern. In den Jahren 1898 und 1899 hatte sich der Bestand bereits auf über 49 Millionen Liter erhöht.
Im Jahr 1899 platzte diese Blase. Die Firma Pattison´s in Leith bei Edinburgh meldete als erstes Unternehmen Insolvenz an. Ihre Schulden beliefen sich auf die damals ungeheuere Summe von einer halben Million Pfund. Die Pattison´s-Pleite setze einen Domino-Effekt in Gange. Die Investoren verloren das Vertrauen in die schottische Whisky-Industrie. Zahlreiche Brennereien gerieten in Schieflage und mussten schließen.
Zahlreiche Schließungen
Die kommenden Jahre waren düster. Hohe Steuern drückten auf die Nachfrage. In den USA, dem bislang wichtigsten Exportmarkt, ließ sich wegen der Prohibition kaum noch Whisky verkaufen. Es folgten die Weltwirtschaftskrise und der Erste Weltkrieg.
Die Zahl der Schließungen war zwischen den Weltkriegen am größten. Der britische Whiskykenner Alfred Barnard nennt in seinem Standardwerk „The Whisky Distilleries of the United Kingdom“ von 1887 insgesamt 129 Brennereien in Schottland. Mitte der 30-er Jahre waren davon noch rund 40 tätig. Und für kurze Zeit rutschte die Zahl der produzierenden Betriebe sogar in den einstelligen Bereich.
Schuld an dem Rückgang waren aber nicht nur die Steuern und das wirtschaftliche Umfeld, sondern auch die Unternehmen selbst. Besonders der Whiskykonzern „Distillers Company Ltd“ (DCL) kaufte für wenig Geld Pleite-Brennereien auf und legte sie konsequent still. Auf diese Weise wollte DCL die Zahl der Wettbewerber für die Zukunft gering halten. Die Aufkäufe führten dazu, dass auf dem schottischen Whiskymarkt in kurzer Zeit eine Konsolidierung einsetzte.
Читать дальше