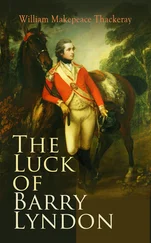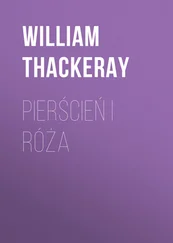„Ich lasse sie nicht beschimpfen“, begehrte Dobbin auf und sprang von seiner Bank hoch.
„Nun, wirst du gehen?“ krähte der Hahn der Schule.
„Leg den Brief hin“, erwiderte Dobbin; „kein Gentleman liest fremde Briefe.“
„Hm, wirst du nun bald gehen?“ fragte der andere.
„Nein, habe ich gesagt. Hör auf, sonst verdresche ich dich“, brüllte Dobbin, sprang auf ein bleiernes Tintenfass zu und sah so bösartig aus, dass Mr. Cuff innehielt, seine Rockärmel wieder herabstreifte, die Hände in die Hosentaschen steckte und hohnlächelnd davonging. Von da an ließ er sich nie wieder mit dem Krämerjungen ein, obgleich wir ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen müssen, dass er hinter Mr. Dobbins Rücken stets mit Verachtung von ihm sprach.
Einige Zeit nach diesem Vorfall geschah es, dass Mr. Cuff an einem sonnigen Nachmittag in der Nähe des armen William Dobbin auftauchte, der unter einem Baum auf dem Spielplatz lag und, abgesondert von den übrigen Schülern, die ihren verschiedenen Vergnügungen nachgingen, ganz einsam und beinahe glücklich sein Lieblingsbuch „Tausendundeine Nacht“ durchbuchstabierte. Würden die Menschen doch bloß Kinder sich selbst überlassen; würden doch die Lehrer nur aufhören, sie einzuschüchtern; würden die Eltern doch bloß davon ablassen, die Gedanken ihrer Kinder zu lenken und ihre Gefühle zu beherrschen – Gefühle und Gedanken, die allen ein Geheimnis sind (denn was wissen wir schon voneinander, von unseren Kindern, unseren Erzeugern, unseren Nachbarn, und wie unendlich viel schöner und heiliger sind doch wahrscheinlich die Gedanken der armen Knaben oder Mädchen, die ihr lenkt, als die der dummen und lasterhaften Person, die sie erziehen soll). Ach, würden nur, wie gesagt, Eltern und Lehrer ihre Kinder ein bisschen mehr sich selbst überlassen – der Schaden wäre unerheblich, wenn auch dabei weniger als in praesenti erreicht würde.
William Dobbin hatte also einmal die Welt vergessen, war mit Sindbad dem Seefahrer im Tale der Diamanten oder bei dem Prinzen Namenlos und der Fee Peribanu in jener prächtigen Höhle, wo der Prinz sie fand und wohin wir wohl alle gern eine kleine Reise machen würden – als das gellende Geschrei eines kleinen Jungen ihn aus seinen angenehmen Träumen schreckte. Er blickte auf und sah Cuff einen weinenden kleinen Knaben bearbeiten.
Es war der Bursche, der die Sache mit dem Krämerkarren verkündet hatte; aber Dobbin war nicht nachtragend, schon gar nicht gegenüber Jüngeren und Kleineren.
„Wie konntest du es wagen, die Flasche zu zerbrechen?“ schrie Cuff das Kerlchen an und schwang einen gelben Kricketstab über seinem Kopf. Der Kleine hatte den Auftrag erhalten, über die Mauer, die den Spielplatz umgab, zu steigen, und zwar an einer besonderen Stelle, wo die Glasscherben entfernt und in den Ziegeln bequeme Löcher angebracht worden waren; er sollte eine Viertelmeile laufen, eine Flasche Rum mit Zitrone auf Kredit kaufen und allen draußen herumlungernden Spähern des Doktors zum Trotz wieder in den Spielplatz zurückklettern; als er diese Heldentat gerade vollbrachte, war er ausgeglitten, die Flasche war zerbrochen und das Getränk ausgelaufen. Er hatte sich die Hose zerrissen und erschien nun wieder vor seinem Auftraggeber – ein zitternder, schuldlos schuldiger armer Wicht.
„Wie konntest du es wagen, die Flasche zu zerbrechen?“ schrie Cuff. „Du nichtsnutziger Pfuscher. Du hast das Zeug getrunken und erzählst nun, die Flasche ist zerbrochen. Hand her, Bursche!“
Dumpf schlug der Stab auf die Kinderhand nieder. Ein Stöhnen folgte. Dobbin blickte auf. Die Fee Peribanu war mit dem Prinzen Achmed in die innerste Höhle entflohen; der Vogel Rock hatte Sindbad den Seefahrer weit aus dem Diamantentale in die Wolken entführt – da lag die Wirklichkeit wieder vor dem ehrlichen William: ein großer Junge schlug grundlos auf einen kleinen ein.
„Die andere Hand her, Bursche!“ brüllte Cuff seinen kleinen Schulkameraden an, dessen Gesicht ganz schmerzverzerrt war. Dobbin flog am ganzen Körper, als er sich in seinen abgeschabten, engen Kleidern aufrichtete.
„Hier hast du noch was, du verflixter Kerl!“ rief Mr. Cuff, und abermals schlug der Stab auf die Hand des Kindes. (Entsetzen Sie sich nicht, meine Damen, jeder Schuljunge hat das getan. Auch Ihre Kinder werden es höchstwahrscheinlich tun und selbst erdulden müssen.) Wiederum sauste der Stab herab, und Dobbin sprang auf.
Seine Beweggründe kenne ich nicht. In der Schule sind Foltermethoden ebenso gestattet wie in Russland die Knute, und es ist eines Gentlemans unwürdig, sich zu widersetzen. Vielleicht empörte sich Dobbins törichtes Herz wider diese Tyrannei; vielleicht kochte in ihm auch noch ein Rachegefühl, und es verlangte ihn, sich mit dem glänzenden und tyrannischen Raufbold zu messen, der in der Schule allen Ruhm, alles Gepränge auf sich konzentrierte, für den allein die Fahnen geschwenkt, die Trommeln gerührt, Ehrenbezeigungen gegeben wurden. Welchen Beweggrund Dobbin auch gehabt haben mag, er sprang jedenfalls auf und schrie: „Halt, Cuff; schlag das Kind nicht länger, oder ich werde...“
„Oder du wirst was?“ fragte Cuff, verwundert über die Unterbrechung. „Los, Hand her, du kleine Bestie.“
„Ich prügle dich, wie du noch nie in deinem Leben geprügelt worden bist“, erwiderte Dobbin auf Cuffs Frage; und der kleine Osborne blickte, luftschnappend und in Tränen aufgelöst, verwundert und ungläubig auf, als er diesen erstaunlichen Kämpen mit einem Male zu seiner Verteidigung auftreten sah; Cuffs Erstaunen war kaum geringer. Man stelle sich unseren seligen Monarchen Georg III. vor, als er die Nachricht vom Aufstand der nordamerikanischen Kolonien hörte, man stelle sich den ehernen Goliath vor, als der kleine David vor ihn hintrat und ihn herausforderte – dann hat man die Gefühle vor Augen, die Mr. Reginald Cuff beherrschten, als er zu diesem Duell gefordert wurde.
„Nach der Schule“, antwortete er nach einer Pause selbstverständlich, mit einem Blick, als wolle er sagen: Mach dein Testament und teile in der Zwischenzeit deinen Freunden deine letzten Wünsche mit!
„Wie du willst“, meinte Dobbin, „Du musst mein Sekundant sein, Osborne.“
„Gut, wenn du meinst“, erwiderte der kleine Osborne; denn bekanntlich hatte sein Vater eine Equipage, und so schämte sich der Kleine ein wenig seines Kämpen.
Ja, als die Stunde des Kampfes nahte, schämte er sich beinahe, „Drauf, Feige!“ zu rufen; und während der ersten zwei oder drei Runden dieses berühmten Kampfes stieß nicht ein einziger der Knaben den Schlachtschrei aus, denn am Anfang ließ der versierte Cuff, ein verächtliches Lächeln auf dem Gesicht, leicht und spielerisch, als sei es nichts, die Schläge auf seinen Gegner niederhageln und schickte den unglücklichen Kämpen dreimal hintereinander zu Boden. Jedes Mal erhob sich ein lautes Hurragebrüll, und alle stritten sich um die Ehre, dem Sieger ein Knie zu bieten.
Was werde ich erst für eine Tracht kriegen, wenn das vorüber ist, dachte der junge Osborne, während er seinem Mann hochhalf. „Es wäre doch das Beste, du würdest aufgeben“, redete er auf Dobbin ein; „er hat mich doch nur ein bisschen verprügelt, Feige, und daran bin ich schon gewöhnt, weißt du.“
Aber Feige, der am ganzen Leibe zitterte und aus dessen Nüstern Wut sprühte, schob seinen kleinen Sekundanten beiseite und trat zum vierten Male an. Da er keine Ahnung hatte, wie er die gegen ihn gerichteten Schläge parieren könnte, und da Cuff die drei ersten Male angegriffen hatte, ohne seinem Gegner Gelegenheit zum Schlag zu geben, beschloss Feige, nun seinerseits den Kampf mit einem Angriff zu eröffnen; da er Linkshänder war, brachte er nun diese Faust ins Spiel und schlug einige Male mit aller Kraft zu – traf einmal Mr. Cuffs linkes Auge und ein anderes Mal seine schöne römische Nase.
Читать дальше