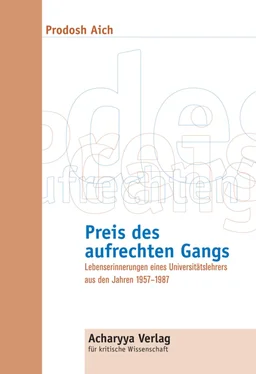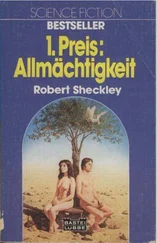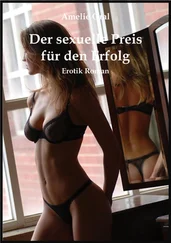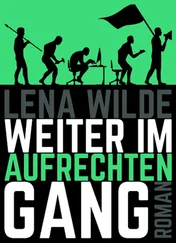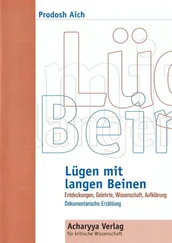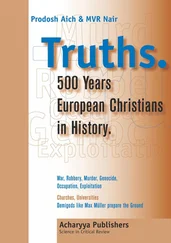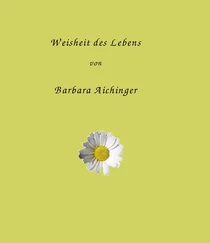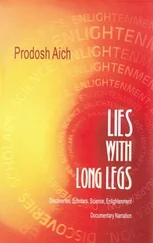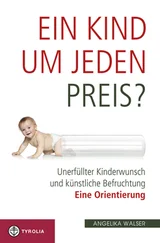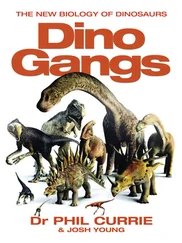1 ...6 7 8 10 11 12 ...48 Wir diskutieren über das Unesco–Projekt, wann immer die Zeit dafür da ist. Erwartet wird sicherlich – darüber sind wir uns einig – eine Bestandsaufnahme der vielfältigen Betreuungsmaßnahmen für die ausländischen Studierenden und auch eventuelle Verbesserungsvorschläge. Mir ist klar, daß es um die afrikanischen und asiatischen Studierenden und nicht um die ausländischen Studierenden im Allgemeinen geht. Sie und ihre Schwierigkeiten sind im öffentlichen Gespräch. Sie fallen äußerlich auf. Sie werden diskriminiert. Vielfältig. Die Diskriminierung, Arten der Diskriminierung, deren Folgen – nicht nur für das Studium – sind das Problem und nicht die richtigen Betreuungsmaßnahmen. Ihre Lebenssituation in diesem Land müßte beschrieben werden. Wer sonst als die betroffenen Studierenden könnten uns genauer sagen, wie ihre Lebenssituation ausschaut, was sie dabei empfinden, welche Erwartungen sie haben.
Meine Überlegungen diskutiere ich auch im Vorstand des ISSF. Auch darüber, ob es nicht sinnvoller wäre, die 5000,- US-$ für die Beschreibung der Aufenthaltssituation der afrikanischen und asiatischen Studierenden zu verwenden, als für die Reise– und Spesenkosten des Unesco–Referenten, für Veranstaltungen mit kleinem Imbiß und Umtrunk einiger ISSF–Hochschulgruppen zu verplempern. Der Vorstand unterstützt mich. Also warum nicht eine fundierte Befragung dieser Studierenden?
Ich nehme das freundliche Angebot von René König in Anspruch. Ich berichte über das Anliegen von Unesco, über den Stand der Diskussion im ISSF und frage ohne Umschweife, ob er, ob sein Institut, unsere Befragung wissenschaftlich betreuen würde. Seine Antwort ist ein unmißverständliches „Nein“ . Noch bevor ich meine Enttäuschung überspielen kann, fügt er hinzu:
„ Beratende Unterstützung ja, aber keine Betreuung. Nehmen Sie die Veranstaltungen und Beratungen in Anspruch. Entwerfen Sie ein Erhebungsinstrument. Das Institut kann und wird für Sie diese Arbeit nicht machen.“
Beim Verabschieden bemerkt er, daß er das Gelingen des Projekts begrüßen werde. Ich nehme die Herausforderung an. Dies ist der Stand im Januar 1959.
Das sozialwissenschaftliche Arbeiten lerne ich an diesem Unesco–Projekt, das sich schließlich zu einer wissenschaftlichen Untersuchung mausert. Das nichtuniversitäre Forschungsinstitut für sozialpolitische Fragen, das „Institut für Selbsthilfe und Sozialforschung e.V.“, ist unweit der Gebäude der WiSo–Fakultät. Dort ist eine von IBM angeleitete Lochkartensortiermaschine der 2. Generation. Nur zum Sortieren und Auszählen. Diese Maschine reicht aus – wenn auch zeitaufwendig –, Tabellen in absoluten Zahlen zu erstellen. Dann die Prozente mit dem Rechenschieber. Diese einfache Aufbereitung des Materials reicht für die Berichte aus, die die Auftraggeber von diesem Institut erwarten. In diesem „Institut für Selbsthilfe und Sozialforschung“ ist immer Bedarf an Hilfskräften, an Tagelöhner. Ich habe häufig in diesem Institut gearbeitet. Bald bin ich kein Tagelöhner mehr. Ich lerne schnell. Interviewen, Schlüssellisten erstellen, kodieren, lochen, sortieren, zählen, Tabellen schreiben, Prozente ausrechnen, also praktisch alle Arbeiten, die zwischen dem Abschluß der Feldarbeiten und dem Schreiben des Ergebnisberichts anfallen.
Der Direktor des Instituts, Otto Blume, ist ein vielbeschäftigter, aber doch umgänglicher Mensch. Er ist auch Habilitationskandidat bei jenem Gerhard Weisser, der Hans Albert aus der Habilitationsmisere geholfen hatte. Gerhard Weisser hat einen guten Ruf. Als Sozialdemokrat achtet und kooperiert er beispielsweise mit Oswald von Nell–Breuning, einem an der katholischen Morallehre orientierten Sozialpolitiker. Er ist auch der Vorsitzende der Friedrich–Ebert–Stiftung. Und Otto Blume ist der Vertrauensdozent für die Stipendiaten in Köln, also auch mein Vertrauensdozent.
Noch vor dem Ende des Wintersemesters 1958/1959 erkundigt sich Blume, ob ich an einer festen Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter interessiert wäre. Nicht in seinem Institut, sondern als Mitarbeiter von Gerhard Weisser. Die ausschließliche Aufgabe wäre englischsprachige sozialpolitische Literatur zu „Entwicklungsländern“ zu sichten, zu bibliographieren, zu lesen und darüber ausführliche Zusammenfassungen anzufertigen. Auf Deutsch, versteht sich. Der Arbeitsplatz wird im vierten Stock in einem angemieteten Haus neben den Hauptgebäuden der Universität sein.
Im 2. Stock des gleichen Hauses ist das Institut für Soziologie und im Parterre ist das Seminar für Ethnologie. Weisser leitet neben seinem Seminar für Sozialpolitik noch die Institute: Institut für Genossenschaftswesen, Institut für Wohnungswirtschaft, Institut für Verwaltungswissenschaft, mit insgesamt ca. 18 wissenschaftlichen Mitarbeitern. König hat nur 2 Institute mit ca. 8 Mitarbeitern.
Meine Frau und ich diskutieren immer wieder, ob es für uns, auch für sie nicht sinnvoller wäre, sich um eine Stelle in Bonn zu bemühen, als sich in Düsseldorf für die Deutsche Bank abzurackern. Mit einem erfolgreichen Studiensemester, mit einigen Nebeneinkünften, mit dem bewilligten Stipendium und schließlich mit der Aussicht auf eine Stelle bei Weisser im Rücken überrede ich meine Frau bei der Deutschen Bank so rechtzeitig zu kündigen, daß sie bereits im Mai 1959 nach Bonn zieht. Ob diese Überredung für sie richtig und günstig gewesen ist, wird für immer ungeklärt bleiben. Unmittelbar nach dem Umzug hat sie eine Magenschleimhautentzündung. Die Ärztin von nebenan verordnet meiner Frau viel Ruhe, geriebene Äpfel und Erdbeeren mit Schlagsahne. Ihr Umzug nach Bonn wird für mein Studium und für unser späteres Leben ausschlaggebend sein.
Unsere Heirat hat uns beiden nicht wenig Ärger eingebracht. Ich spreche nicht von alltäglicher Diskriminierung. Schlagartig verliert meine Frau alle ihre Bekannten und Freunde an der Kölner Universität. Wie konnte sie einen farbigen Ausländer heiraten? Sie bewirbt sich in den Ministerien, erhält aber keine Stelle, obwohl sie mit dem Thema „Die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete der sozialen Sicherheit“ ihren Doktorgrad mit „Sehr Gut“ im Juli 1957 erworben hatte. Der Hauptreferent war der Verfasser des „kleinen Heyde“, des Standardlehrbuchs in Sozialpolitik seinerzeit, Ludwig Heyde, nachdem der eigentliche Betreuer, der Versicherungswissenschaftler Walter Rohrbeck, verstorben war. Der Koreferent war der eigentliche Erfinder der sozialen Marktwirtschaft, Alfred Müller–Armack. Auch der Leiter der Abteilung der staatsbürgerlichen Abteilung der Friedrich–Ebert–Stiftung, Günter Grunwald, reagiert unfreundlich, als ich die Stiftung über unsere Heirat informiere. Ärger für mich auch an der Kölner Universität. Darüber später mehr.
Die Magenschleimhautentzündung meiner Frau klingt dank des Essens indischer Gewürze nach wenigen Monaten ab. Trotz ihres neuen Stresses in Bonn. Wirkliches Abschalten, sich erholen, kann sie möglicherweise im Bridge–Klub. Bevor sie nach Bonn umgezogen ist spielte ich nur ab und an bei kleinen Klubturnieren mit. Der Bonner Bridge–Klub ist was Besonderes. Es ist eigentlich kein Klub, obwohl er als solcher beim Deutschen Bridge–Verband eingetragen ist. Der Bonner Klub ist praktisch eine Privatveranstaltung eines deutsch–englischen Ehepaares namens Clare in deren Privathaus. Mr. F. C. Clare, ein Korvettenkapitän der englischen Armee im ersten Weltkrieg, blieb in Deutschland hängen und lebte von seiner Pension. Zu der Zeit spielt Deutschland Skat. Clare spielt aber Bridge und findet zu Recht Bridge viel interessanter als Skat. Er bringt seiner Frau ebenso Bridge bei wie seinen Freunden. So entsteht der Bridge–Klub in Bonn noch vor dem Deutschen–Bridge–Verband. Ich hatte das Privileg, als sein Partner zu spielen.
Als meine Frau nach Bonn zog, lebte Herr Clare nicht mehr. Frau Clare übernahm das Vermächtnis, besaß alle Arbeitsunterlagen und unterrichtete weiter. Sie spielt selbst keine Turniere mehr, sie leitet Turniere: wöchentlich einmal in ihrem Privathaus, Hochkreutz 5, Bad Godesberg, ein monatliches Turnier jeweils in der „Lese“ in Bonn und in der Stadthalle in Bad Godesberg und ein Jahresturnier in Bad Neuenahr. Sie sieht es gern, daß ich ihr bei der Ausrichtung und Ausrechnung der Monats– und Jahresturniere helfe. So ist auch meine Frau, quasi selbstverständlich, zum Bridge gekommen. Sie hat bei Frau Clare gelernt, zunächst mit anderen Anfängern die Wochenturniere gespielt, später mit mir alle Klubturniere. Wir sind auch deshalb ein gerngesehenes Paar im Klub, weil wir uns am Bridgetisch nicht zanken.
Читать дальше