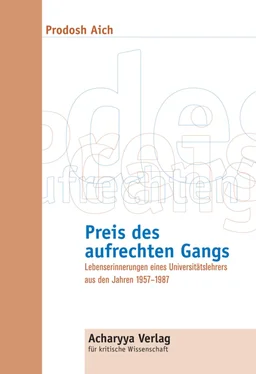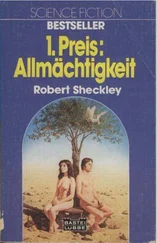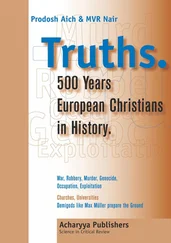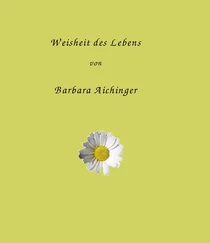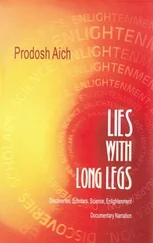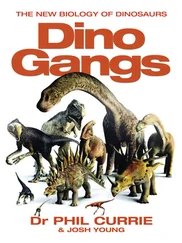1 ...7 8 9 11 12 13 ...48 Die Bridge–Spieler sind merkwürdige Menschen. Bildungsprivilegiert, wohlhabend, freundlich, sonst mit guten Manieren, nicht aber am Bridge–Tisch. Am Bridge–Tisch sind sie unfair, unfreundlich, unehrlich, ja, ekelig. Nun, Bridge ist kein leichtes Spiel. Es erfordert Intelligenz, schnelle Intelligenz im Gegensatz zum Schach. Und im Bridge kann geblufft werden. Am Bridgetisch wird aus einer spielerisch intellektuellen Herausforderung doch eine Angelegenheit des persönlichen Ansehens. Leider!
Bridge ist ein 52–Karten–Spiel. Am Tisch sind vier Spieler. Die sich gegenübersitzenden Spieler bilden jeweils ein Paar. Die Karten werden gemischt und ausgeteilt. Noch habe ich nie dieselbe Verteilung von Karten in der Hand gehabt. Es ist also jedes Mal etwas anderes, obwohl jeweils nur 13 Karten zu halten sind und es letztlich jeweils nur um 13 Stiche geht. Gereizt wird um einen „Kontrakt“, die Ankündigung, wie viel von den 13 Stichen eine Partnerschaft bei welcher Trumpffarbe machen will, ohne die übrigen 39 Karten zu kennen. Jede Partnerschaft ist bemüht, durch die Reizung die eigene Hand über spezifische „Kartensprachen“ zu beschreiben, damit abgeschätzt werden kann, wie viel Stiche unter welcher Voraussetzung die 26 Karten einer Partnerschaft machen kann. Es ist keine leichte Aufgabe, und es gibt viele Möglichkeiten für Mißverständnisse und des Fehlermachens. Und im Turnier geht es um Punkte, wobei dieselben Austeilungen an allen Tischen gespielt werden. Wenn ein Paar schlechter gespielt hat als die übrigen Paare, ist natürlich der nichtdominante Partner schuld, bei gemischten Paaren der weibliche Partner und bei Ehepaaren die Frau schuld. Es ist unglaublich, aber wahr. Dies ist einer der Gründe, warum Ehepaare ungern Bridge–Turniere spielen. Der unerklärliche Ehrgeiz ist einer sonst harmonischen Partnerschaft nicht förderlich. Wir fielen also auf, weil wir uns nicht, wie zwischen Bridge–spielenden Ehepaaren üblich, zankten, ganz gleich, wie das Ergebnis war. So waren wir im Klub sehr gern gelitten. Für uns war das Bridge–Spielen gute Erholung. Beim Gewinnen freuten wir uns, ohne Neid bei den anderen zu erwecken, und wir haben in Bonn häufig gewonnen. Auch in der stressigsten Zeit haben wir die Bridge–Turniere im Bonner Klub regelmäßig gespielt, nicht zuletzt auch, um Frau Clare bei der Ausrechnung behilflich zu sein.
1959 ist für mich ereignisreich. Die Methodenseminare des ersten Semesters in Köln lehren mich, daß ich mich intensiver mit den methodologischen Fragen befassen müßte, als dies in den „Seminaren“ möglich ist, sollte aus dem „Unesco–Projekt“ eine wissenschaftliche Untersuchung werden. In den Seminaren werden nicht eigene Untersuchungen herangezogen. Warum? Weil die Lehrenden selbst keine Untersuchungen durchgeführt hatten. Statt also in den Methodenseminaren zu sitzen, lese ich selbst, um ein optimales Untersuchungsinstrument zu konstruieren. Die intensiven Diskussionen mit meiner Frau sind dabei hilfreicher als Gespräche mit den Mitarbeitern von König. Ich habe 1959 überhaupt viel lesen müssen.
Der Anfrage von Otto Blume über eine Zusammenarbeit mit Weisser folgt dann eine Einladung Weissers. Er bestellt mich an einem Samstag- Nachmittag ins Hotel Dresen in Bad Godesberg. Unsere erste Begegnung. Ich habe nur Gutes über ihn gehört. Ich bin gespannt und natürlich aufgeregt. Das Gespräch ist eine Mischung aus Informationsübermittlung und Prüfung. Er fragt mich aus, ohne eine Atmosphäre einer Prüfung aufkommen zu lassen. Jetzt erst begreife ich, warum Weisser für das Gespräch ein Hotel ausgewählt und mich nicht in sein Arbeitszimmer bestellt hat. Ich erfahre auch, daß er intensiv über die Grundprobleme der Wirtschaftsordnung in den „Entwicklungsländern“ nachdenkt. Ja, damals hießen diese Länder schon so. Davor hießen sie „Unterentwickelte Länder“. Er würde gern genau wissen wollen, wie der Diskussionsstand über dieses Problem im englischen Sprachraum ist. Er denkt auch über eventuelle Veröffentlichungen seiner Gedanken in diesem Bereich nach. Ich bestehe die Prüfung. Im Juli 1959 trete ich die Stelle an. Ich beginne also auch noch Sozioökonomie auf Englisch zu lesen und fertige fleißig deutsche Zusammenfassungen an.
Meine Frau meint, daß es mit den Zusammenfassungen nicht getan wäre. Ich müßte eigentlich Aufsatzentwürfe vorlegen und sie nach der Besprechung mit Weisser dann auch ins Englische übersetzen, wenn ich die Stelle behalten wollte. Jeder deutsche Mitarbeiter würde das wissen. Ich bin zum „ghost writing“ nicht bereit.
Weisser lädt regelmäßig seine Mitarbeiter zum „Jour fixe“ ein. Die Ehefrauen der Mitarbeiter auch. Es ist eine nette und nützliche Einrichtung. Nach einem solchen Treffen fragt mich meine Frau auf dem Nachhauseweg, was denn zwischen Weisser und mir vorgefallen sei, daß Weisser sich veranlaßt gesehen hat, ihr zu sagen, daß ich ein wildes Fohlen sei, er aber mich schon noch zähmen würde.
Eigentlich war nichts Direktes vorgefallen. Aber möglicherweise mittelbar doch. Als Stipendiat ohne monatliches Stipendium der Friedrich–Ebert–Stiftung war ich zu einer Großveranstaltung in der Heimvolkshochschule in Bergneustadt eingeladen. Auch Politiker und Journalisten. Die Heimvolkshochschule in Bergneustadt liegt abgeschieden vom Ort. Abends sitzt man deshalb, nach getaner Arbeit in der hauseigenen Kellerbar. Diskutiert werden dabei meist andere aktuelle Fragen. Der Leiter der staatsbürgerlichen Erziehung der Stiftung, Günter Grunwald – ein Intimus des SPD–Schatzmeisters Alfred Nau, wie ich später leidvoll erfahren werde –, ist in der Kellerbar mitteilungsbedürftig. Er ist gerade aus Indien zurück. Dienstreise, versteht sich. Auch Dienstreiseeindrücke sind bekanntlich trügerisch. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Schon gar nicht in der Kellerbar einer Heimvolkshochschule. Aber Grunwald will seine Eindrücke von mir bestätigt haben. Ich bin genervt. Als er auch noch die herumkriechenden Schlangen zum Thema machte, die er während seines kurzen Aufenthaltes gesehen haben wollte, und ich noch die Gefährlichkeit der „frei umherlaufenden Schlangen“ bestätigen sollte, rutscht mir heraus, daß er – was das Antreffen von Schlangen angeht – eigentlich mehr Glück gehabt hätte als ich in meinem 22jährigen Leben in Indien. Schallendes Gelächter in der Runde. Rotangelaufenes Gesicht bei Günter Grunwald. Das Thema ist beendet, aber ich habe mir einen dauerhaften Feind geschaffen. Und wie schon erwähnt, Gerhard Weisser ist Vorsitzender der Stiftung.
Es könnte auch das mehrtägige „Berlinseminar“ Anlaß für die Bemerkung Weissers gewesen sein. Aber ein mittelbarer Anlaß. Es war mein erstes Stipendiatenseminar. Es war grauenvoll. Kalter Krieg pur und plump. Jeder Stipendiat ist verpflichtet, einen Seminar– und Erfahrungsbericht an den Leiter der staatsbürgerlichen Erziehung zu schicken. Eher zufällig unterhalte ich mich über das primitive Niveau des Seminarprogramms mit Otto Blume, dem Vertrauensdozenten für die Stipendiaten in Köln. Er möchte gern meinen Seminarbericht lesen, bevor ich ihn nach Bonn schicke. Er liest ihn und ermahnt mich, den Bericht nicht so abzuschicken, selbst wenn meine Kritik zutreffen sollte. Nun, ich würde die Kritik nicht so formuliert haben, wenn ich selbst nicht davon überzeugt gewesen wäre. Auch ich habe meine Vorstellung von demokratischer Erziehung und Meinungsfreiheit. Ich schicke den Bericht ohne „diplomatische“ Korrekturen. Und wie gesagt, Gerhard Weisser ist Vorsitzender der Stiftung.
Wie auch immer. Die Finanzierung der Stelle läuft aus. Die Friedrich–Ebert–Stiftung hat angeblich dafür nach 10 Monaten keine Mittel mehr zur Verfügung. Ich habe für Weisser nie schreiben müssen. Ich habe für ihn nie geschrieben. Er hat nie Kritik an meiner Arbeit geäußert. Nur das Verhältnis der Friedrich–Ebert–Stiftung zu mir ist vergiftet. Das ist sicherlich keine uninteressante, aber vielleicht an anderem Ort zu erzählende, Geschichte. Ich habe nicht häufig das monatliche Stipendiumsgeld in Anspruch nehmen müssen. Dennoch hat es regen Schriftverkehr gegeben. Zunächst mit Grünwald, später nur mit Nau, Weisser und Willi Eichier. Am 28. März 1961 wurde mein Stipendium wieder einmal storniert. Nicht endgültig. Endgültig eigentlich am 4. Mai 1961. Die Begründung von Nau bei der Stornierung:
Читать дальше