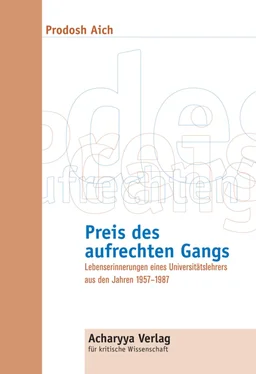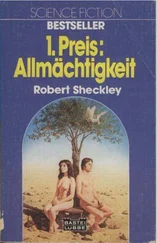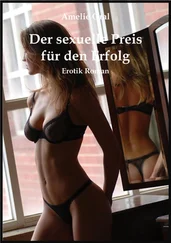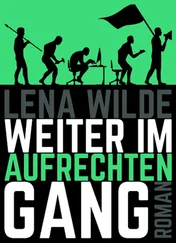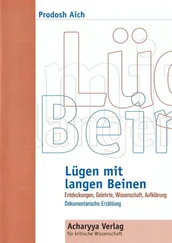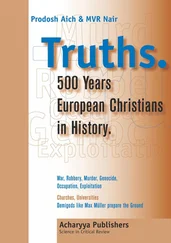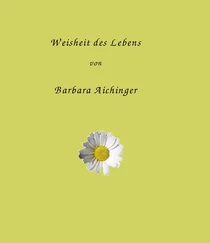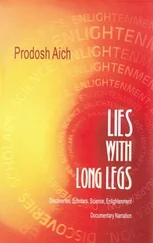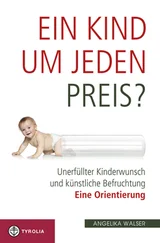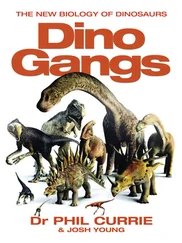Zwischenzeitlich ist die Veröffentlichung der ersten Untersuchung auch als meine Promotionsarbeit gesichert. Sie soll als Band 10 in der Reihe „Beiträge zur Soziologie und Sozialphilosophie“ herausgegeben von Prof. Dr. René König im Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln erscheinen. In dieser Reihe ist die Habilitationsarbeit von Peter Heintz als Band 7 erschienen. Scheuch, Rüschemeier und Daheim haben vor mir promoviert. Ihre Promotionsarbeiten sind nicht in dieser Reihe, nicht als Buch publiziert. Der Verleger Dr. Witsch gratuliert mir in Gegenwart von König, weil ich als erster ein Autorenhonorar in dieser Reihe bekomme. Meine Promotionsarbeit erscheint im November 1962 unter dem Titel „Farbige unter Weißen“ mit einem Vorwort des Herausgebers. Darin heißt es zu Beginn:
„ Wenn etwas den Nutzen der empirischen Sozialforschung augenfällig demonstrieren kann, so ist es die vorliegende Untersuchung ... Dabei stellt sich ganz eindeutig heraus, daß die in der Öffentlichkeit sehr stark unterstrichenen Schwierigkeiten der Studenten aus Entwicklungsländern zum Teil eine ganz geringfügige Rolle spielen, evtl. sogar nur individuell bedingte Ausnahmen darstellen, so daß hinter diesen meist vorschnell verallgemeinerten Klischees eine Fülle von unerwarteten neuen Problemen sichtbar wird, die die Problematik des ‚Auslandsstudenten‘ deutlich sichtbar werden läßt. Damit ist ein sehr ernsthaftes Thema angeschnitten, zu dessen Behandlung der Verfasser weit mehr gibt als nur eine Vorbereitung.“
In wenigen Wochen ist die erste Auflage verkauft. Sie ist ein Medienereignis. Vom „Kölner Stadt–Anzeiger“ bis zum „Spiegel“. Vom Fernsehen zu Illustrierten. Auch im europäischen Ausland. Berichte, Interviews, Veranstaltungen. Edward A. Shils, einer der Soziologiepäpste, Wanderer zwischen den Universitäten in Cambridge und Chicago, fragt mich über den Verlag Kiepenheuer & Witsch an, ob ich bereit wäre einen Aufsatz von 10000 Worten für die Zeitschrift „Minerva“ zum gleichen Thema wie im Buch zu schreiben. Honorarangebot: 200,- US-$.
Sauer ist nicht nur das Auswärtige Amt. Viele „farbige“ Studierende sind erbost. Vor allem bei dem Befund, daß sie eigentlich ihr Land nicht repräsentierten, weil ihr sozialer Hintergrund sie als eine überprivilegierte kleine Minderheit ausweist. Die Emotionen reichen von Beschimpfungen bis zu anonymen Morddrohungen. Auch König wird nicht von Morddrohungen verschont. Die philosophische Fakultät organisiert eine öffentliche Veranstaltung. Es geht hoch her, leider nicht immer einer Veranstaltung der Universität würdig. Mit Medienpräsenz und Polizeischutz. Der Historiker Theodor Schieder wird Jahre später bei seinem Abschied in den Ruhestand vom „Kölner Stadtanzeiger“ gefragt, was seine erfreulichste und schlimmste Erfahrung an der Kölner Universität gewesen sei. Seine schlimmste Erinnerung soll diese fast gewalttätige und emotionalisierte Veranstaltung unter Polizeischutz gewesen sein.
Dem Medienrummel folgen Einladungen zu Vorträgen, Rundfunksendungen, Rundfunk– und Fernsehdiskussionen und Aufsätze. König und ich treten meist gemeinsam auf: der Lehrer und sein – wie König es zu formulieren pflegt – „hochentwickelter unterentwickelter Schüler“. So werde ich auf eine joviale Weise auch von König vermarktet. Er rechnet fest damit, daß der Antrag beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) bewilligt wird. Wie sehr er damit rechnet, belegt ein kurzes Schreiben, das er mir am 4. Januar 1963 geschrieben hat:
„ Mein lieber Herr Aich, anbei die Adresse von Mrs. Sabine Braun in Bombay, die früher als Fräulein Sabine Nipperdey bei uns studiert hat. Falls Sie Ihr Projekt in Indien verwirklichen können, wäre Frau Braun sehr daran interessiert, an Ihrem Projekt teilzunehmen. Sie hat bei uns eine vorzügliche Diplomarbeit geschrieben, so daß Sie in ihr eine wirkliche Hilfe hätten. Mit allen guten Wünschen und herzlichen Grüßen bin ich stets Ihr René König.“
Nipperdey ist der bekannte Arbeitsgerichtspräsident und Arbeitsrechtler an der Universität Köln. Nicht nur König und ich sind „ins Geschäft“ gekommen, sondern auch einige andere bestallte Soziologen. Aber für mich sind die Honorare für die folgenden Monate das einzige Einkommen. Interviews im Fernsehen und der „lnternationale Frühschoppen“ machen mein Gesicht bekannt. So werde ich in einer Gaststätte der Heidelberger Innenstadt von dem damals jüngsten Soziologieprofessor aller Zeiten, Ralf Dahrendorf, beglückwünscht, durchaus neidvoll. „Farbige unter Weißen“ widersprach seiner bekundeten Überzeugung, als er noch wissenschaftlicher Assistent in Saarbrücken war: „ die Karrieren der Wissenschaftler werden mit dem Zentimetermaßstab bestimmt .“ Wenige Wochen vorher, anläßlich seines Vortrags auf Einladung Königs in Köln, schenkte er mir kaum Beachtung, als König mich ihm vorstellte. Natürlich mit seinem „jovialen“, latent rassistischen Spruch: unser „hochentwickelter Unterentwickelter“.
Horst Krüger, Schriftsteller, leitet auch die Abteilung „Kulturelles Wort“ beim Südwestfunk in Baden–Baden, nimmt eine „Nachtprogrammdiskus-sion“ über das Buch „Farbige unter Weißen“ auf. Teilnehmer sind auch K .W. Bötticher, René König und Helga Pross. Thema: Fördern wir unsere farbigen Studenten richtig? Horst Krüger will vor der Aufnahme, nicht nur scherzhaft, von mir wissen, wie man sich fühlt, wenn man gerade „ einen Bestseller gelandet“ hat!
Winfried Böll, mit dem ich viele gemeinsame Veranstaltungen auch vor diesem Buch bestritten hatte, merkt an, ich hätte „ einen gefährlichen Grad an Bekanntheit “ erreicht. All dies hätte mich nachdenklich machen müssen. Aber keine Spur davon. Meiner finanziellen Unsicherheit zum Trotz. Dieser Rauschzustand hält an. Die Ernüchterung stellt sich nicht einmal zur Halbzeit meiner „Gastprofessur in meinem eigenen Land“ ein, als die Untersuchung der „lndischen Universität“ beginnt, Gestalt anzunehmen.
Die Kehrseite dieser Erfolgsmedaille, dieses Rausches, ist aufschlußreicher. Wäre der Forschungsantrag zum Rückanpassungsprozeß „Künftige Elite oder wurzellose Intellektuelle?“ glatt durchgekommen, wie Winfried Böll mir noch vor „Farbige unter Weißen“ als Vertreter des Ministeriums zugesichert hatte, würde es weder einen Aufenthalt in Jaipur noch eine Untersuchung „Die Indische Universität“ gegeben haben. Ich würde gewissenhaft den Rückanpassungsprozeß beschrieben, eine Habilitationsarbeit über das Studium der „Farbigen unter Weißen“ und deren Folgen für die „beiden Welten“ geschrieben haben. Aber ich würde bestimmt nicht auf die Idee gekommen sein, mir die Frage zu stellen, wer die Ergebnisse meiner Untersuchungen mit Gewinn hätte verwerten können und wer die Verlierer gewesen sind. Ich wäre einem blond-blauäugig-weiß-christlichen Wissenschaftler gleich geworden, trotz meines nicht zu übersehenden fremdländischen Aussehens, und würde mich immer noch am Bauch gepinselt fühlen, wenn König und seinesgleichen mich als „hochentwickelten Unterentwickelten“ präsentieren würden.
Ich habe die Wirklichkeit hinter dem Medienrummel nicht wahrnehmen können. Dieser hat der Regierung der Bundesrepublik nicht gepaßt. Sie hätte jede Studie finanziert, die sicherzustellen versucht hätte, daß ausgewählte Personen aus den „Entwicklungsländern“ auf kostspieligen Studienplätzen nach ihrer Rückkehr in die Heimatländer Karriere machten und dennoch im Herzen blond-blauäugig-weiß-christliche Botschafter blieben. Den diplomatischen Wink mit diskretem Charme des Auswärtigen Amtes, ob mit einer Veröffentlichung des Unesco–Berichts nicht abgewartet werden sollte, habe ich nicht verstanden, trotz meiner Erfahrungen mit der Friedrich–Ebert–Stiftung oder mit der Deutschen Stiftung für Entwicklungsländer. Die BMZ war damals und ist heute noch lediglich eine Unterabteilung des Auswärtigen Amtes. Dort zählten nicht die thematische Sympathie eines sachkundigen Winfried Böll und auch nicht der Nutzen von Forschungsergebnissen für die praktische Arbeit einer Carl-Duisberg-Gesellschaft, sondern übergeordnete, öffentlich nicht zu Markte getragene Interessen.
Читать дальше