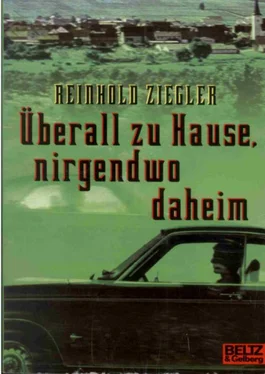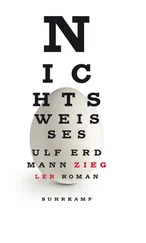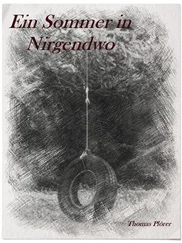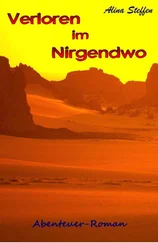»Und seit wann ist der Opa da?« fragte ich.
»Der Opa kam vor ungefähr zehn Jahren. Das ging nicht mehr mit ihm alleine da oben im Odenwald, da hat der Papa ihn irgendwann einfach mitgebracht.«
Das alte Haus, in das man den Alten stecken wollte, erwies sich schon damals als nahezu abbruchreif. Drei Wochen brauchte die Bäuerin, um zusammen mit dem fünfzehnjährigen Heiner wenigstens den oberen Stock einigermaßen bewohnbar zu machen – so lange wohnte der Alte mit im Neubau. Aber auch dann war er nicht zu bewegen umzuziehen, bis Martha seine Starrköpfigkeit schließlich überlistete, indem sie ihm das Haus notariell überließ. »Ich will endlich wieder ein eigenes Dach über dem Kopf«, hatte er gezetert, und er hatte es bekommen.
Die Pflege des eigenwilligen Alten aber rutschte mehr und mehr in die Verantwortung der heranwachsenden Luise. Sie war die einzige, die sich mit ihm verstand, die einzige, die er, ohne sie zu beschimpfen oder ihr zu misstrauen, sogar in eines seiner beiden Zimmer ließ, damit sie dort fegen und nach dem Rechten sehen konnte. Im dritten Zimmer, dort, wo nun auch
ich ein Zuhause angeboten bekam, hatte sich Lui selber wieder eingerichtet. Es war vor dem Umzug ihr Kinderzimmer gewesen, und sie war einfach Jahre später wieder eingezogen. »Ich spüre manchmal«, sagte sie, als sie ihre Geschichte zu Ende erzählt hatte, »dass mit dem Haus etwas Besonderes ist. Ich spüre, dass es wieder jung wird. Nicht nur du bist gekommen, es werden noch mehr kommen.« Sie stand auf. »Das Haus lebt wieder, du wirst es selber spüren – gute Nacht.« Es war schon dämmrig draußen. Lautlos verließ sie das Zimmer. »Ich bin’s, Opa«, rief sie leise auf dem Gang, dann hörte ich am Knarren der Tür, dass ich mit dem Alten allein war. Über mir im Karree des Dachfensters gingen die Sterne auf. Wirre Geschichten drehten sich in meinem Kopf, manchmal spürte ich ihre schwarzen Augen auf mir, manchmal hallte noch ihre Stimme im Raum. Erst das leise, gleichmäßige Schnarchen von Hippie unter meinem Bett half mir hinüber in den Schlaf.
Fünf Tage hatte ich noch, fünf Tage, eingeklemmt zwischen diesem ersten Abend mit Lui, in dem kleinen, muffigen Zimmer unter dem Dachfenster, und dem Schulanfang. Fünf Tage mit Lui. Sie wich nicht von meiner Seite, und, um ehrlich zu sein, ich machte auch wenig Anstrengungen, sie von dort zu vertreiben. Sie brachte mir euterwarme Milch zum Frühstück, fuhr mit mir im Goggo los, um mir die Stadt zu zeigen, erklärte mir das Dorf und ihre Welt bis zum Abend, wenn sie sich mit einem »Gute Nacht, Kadewe, bis morgen« verabschiedete. Ihre Augen leuchteten in meinem Kopf weiter, wie eine Bildröhre nachleuchtet in einem dunklen Zimmer. Dann lag ich wieder auf der Matratze, ließ mir heute, gestern und morgen durch den Kopf ziehen und dachte doch eigentlich nur an sie.
Sie sagte: »Ich hab gehört, du hast in Berlin eine Freundin.«
»Woher willst du das gehört haben?« fragte ich sie.
»Ich höre soviel«, sagte sie nur, das sagte sie oft, »ich höre soviel«, und ihre Augen waren seltsam fremd, wenn sie es sagte.
Ich nahm ihre sechzehn Jahre mal zwei und kam auf zweiunddreißig. Ich zählte meine eigenen Jahre und kam auf einunddreißig. Manchmal, wenn ich abends dalag und sie mir vorstellte, kam ich mir vor wie ein Kindsverführer.
Aber wir tauschten nicht nur verliebte Blicke, wir arbeiteten auch viel in diesen fünf Tagen, bevor für mich der Schulalltag begann.
Lui schien nicht besonders viele Pflichten auf dem Hof zu haben, sie war ständig bei mir und half, und jeder fand es in Ordnung, ihr Bruder Heiner vielleicht ausgenommen, aber den versuchte ich so gut es ging zu ignorieren.
Schon nach den ersten zwei Stunden, in denen wir begonnen hatten, das Erdgeschoß auszuräumen, türmte sich ein riesiger Haufen Unrat und Möbel, Abfälle und Gerümpel im Hof. Abends spannte der Bauer seinen Traktor vor den großen Anhänger, wir warfen alles drauf und fuhren es zusammen zur Müllkippe. Es war das erste Mal, dass ich auf einem Traktor mitfahren durfte, Lui merkte es und fühlte sich stolz und überlegen.
Das größte Problem aber war der verdammte Dünger in der Küche. Ich hab sie nicht gezählt, aber es müssen Hunderte von Säcken gewesen sen. Vierzig Kilo pro Sack, Heiner kam mir immer lächelnd mit der Last auf der Schulter entgegen, wenn ich schnaufend und dem Ende nahe zurück wankte, um den nächsten Sack auf meinen geschundenen Städterkörper zu laden. Der Nitrophoska-Gestank in der Küche blieb mir ewig erhalten, in den ersten Wochen meinte ich, ihn auf jedem Brötchen, in jedem Glas Bier zu schmecken, später nahm ich ihn nur noch wahr, wenn ich von draußen kam und meine Riechzellen sich resensibilisiert hatten. Wer immer mich besuchen kam, rümpfte die Nase.
Der Alte im Dachgeschoß war nicht bereit, auch nur eine müde Mark für sein Haus auszugeben. Ich brauchte zwei neue Fenster und musste den Türsturz austauschen lassen. Aber Lui reagierte schnell, informierte ihren Vater, und der sprang kommentarlos in die Bresche. Leute kamen vorbei, irgendwelche Freunde und Handwerker aus dem Dorf, und ein paar Tage später waren die Sachen in Ordnung.
Immerhin schafften wir es bis zum Montagmorgen der Lehrerkonferenz, die drei unteren Räume zumindest auszuräumen und zum Tapezieren vorzubereiten. Leer waren sie größer, als es am Anfang ausgesehen hatte, ich fing an, mein Leben in sie hineinzudenken, und begann mein Häuschen zu mögen.
Am Morgen vor der Lehrerkonferenz war ich von Aufregung wie durchgeschüttelt. Ich hatte seit Jahren keine Schule mehr von innen gesehen. Nur mühsam konnte ich mich zwingen, zwischen den fremden Kollegen auf einem der klebrigen roten Kunstledersessel still zu sitzen. Die vier Tische des Lehrerzimmers waren zu einer langen Tafel zusammengeschoben, am Kopfende thronte Rektor Ludwig Klein, ein unscheinbares, profilloses, faltiges Wesen kurz vor der Pensionierung, den niemand ernst zu nehmen schien, der aber beständig bemüht war, seine vermeintliche Wichtigkeit und Kompetenz durch langwierige Erläuterungen zu untermauern.
Sein Versuch, mich »in aller Kürze« den Kollegen vorzustellen, verlor sich in umständlichen Erklärungen, warum das Kollegium überhaupt vergrößert werden musste, so, als hätte er sich zu entschuldigen, dem eingeschworenen Kreis einen Fremdkörper wie mich hinzufügen zu müssen. Dann verirrte er sich in Geschichten aus der Schulgeschichte, schwelgte in Erinnerungen an damals, früher und »vor Ihrer Zeit, verehrte junge Kolleginnen und Kollegen«, bis ihn eine dieser jungen Kolleginnen mit einem etwas schnippischen »Wollten Sie uns nicht eigentlich Herrn Weber vorstellen?« wieder auf den Boden der Gegenwart zurückholte.
»Richtig, unser Herr Weber – vielleicht, wenn Sie selber ein paar Worte zu Ihrer Vorstellung sagen wollen?«
»Mein Name ist Karl-Dietrich Weber«, sagte ich knapp, »ich habe in München studiert, war dann auf der Warteliste und habe seitdem drei Jahre in Berlin gelebt – noch Fragen?« Ein junger Typ in Jeans, etwa mein Alter – ich hatte mich neben ihn gesetzt, weil er mir von allen der sympathischste zu sein schien -, fragte halblaut: »Steht dein Zelt immer noch auf dem Sportplatz?«
Ich grinste ihn wortlos an.
Die sogenannte Konferenz zog sich in die Länge. Nach über zwei Stunden stand endlich fest, dass »unserem Neuen« eine dritte Klasse anvertraut werden würde. Das war im Grunde alles, was ich wissen wollte. Der Typ neben mir fand im Verlauf der rektorlichen Verirrungen genügend Zeit, sich mir als Rainer Klee vorzustellen und mich aufs gemeinsame Lehrerbier nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung aufmerksam zu machen.
Endlich saßen wir im Ochsen, Rektor Klein hatte sich wegen dringender anderer Verpflichtungen entschuldigt, und niemand schien darüber besonders traurig zu sein. Ich hockte hinter meinem Weizenbier und lauschte. Feriengeschichten, Dorfgeschichten, Schulgeschichten, Maulzerfetzen über Rektor, Schulrat und Pfarrer, dann waren die Eltern dran – nach ein paar Versuchen gab ich es auf, von Rainer irgendwelche Hintergründe zu erfahren. »Zwanzig Jahre Waldweibersbach«, sagte er, »dann verstehst du alles!«
Читать дальше