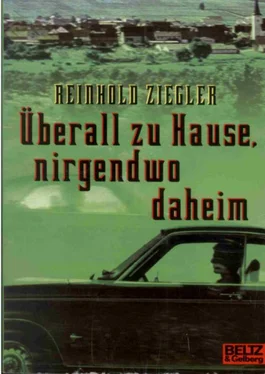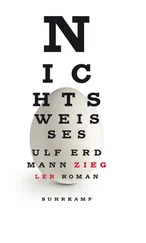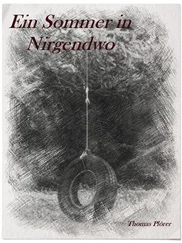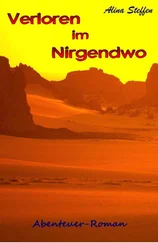»Und von Ihnen hört man«, sagte plötzlich eine der älteren Kolleginnen, »Sie haben Quartier bei Opa Alfred genommen?«
Schlagartig verstummte das Gespräch, alle Gesichter drehten sich zu mir.
»Es wurde mir sozusagen bürgermeisterlicherseits verordnet.«
»Und? Schon viel Spaß gehabt?« Alle sahen mich in spöttischer Erwartung an.
»Was soll sein?« fragte ich. »Der Alte hat sie nicht mehr alle. Hat Verkalkung oder Alzheimer, man muss ihm immer wieder sagen, wer man ist, und einfach nicht hinhören, was er so absondert, dann läuft alles bestens.«
»Na, viel Glück «, meinte jemand und fragte dann in die Runde: »Was ist eigentlich mit dem Rest der Familie?«
Nun waren plötzlich die Reusten zum Thema geworden, die alte Geschichte von Martha und Adolf kam wieder hoch, einige der Älteren hatten auch Heiner und Luise in der Schule gehabt, halfen den anderen auf die Sprünge. »Weißt doch, der Heiner, der jetzt beim FCW den Tormann macht, so ’n bisschen Stärkerer. Und die Luise war so ’ne merkwürdige, dunkle, die kam ganz nach ihrer Mutter, sie ist später auf die Realschule.« – »Ach die, ja klar, die immer mit der durchgedrehten Martina vom Bürgermeister zusammenhing. Die konnte ’ne ganze Klasse aufscheuchen, wenn sie mit ihrem komischen Gerede anfing. Die hab ich übrigens neulich mal gesehen, ist ein hübsches Ding geworden, vierzehn, fünfzehn muss die doch jetzt auch schon sein, oder?«
»Siebzehn«, sagte ich und wusste gar nicht, warum ich log. Einen Tag später dann, Dienstag morgen, stand ich vor meiner neuen Klasse. Erwartungsvolle Gesichter von achtundzwanzig Achtjährigen, denen ich groß an die Tafel schrieb: »Weber«.
Ich musste meine Tafelschrift wieder in den Griff kriegen, mein altes Problem, x-mal gerügt von Seminarleitern und Schulräten, ein Vorbild sollte ich sein, und mein Tafelanschrieb sah aus wie das verwahrloste Heft des schlechtesten Schülers. Ein kleiner Steppke meldete sich. »Meine Mama hat gesagt, dass Sie in einem Zelt wohnen, stimmt das?«
»Nein«, sagte ich, »ich wohne in der Hauptstraße 113, im Reustenhof, aber ich habe die erste Nacht in einem Zelt geschlafen, weil ich aus Berlin gekommen bin und nirgendwo ein Zimmer gefunden habe, ist das schlimm?«
Keine Antwort, nur allgemeines Kichern.
»Wer von euch hat schon einmal in einem Zelt geschlafen?« fragte ich.
Gott sei Dank gingen ein paar Finger hoch, ich ließ die Zeltschläfer erzählen. Von den Geräuschen berichteten sie, dem
Wind und dem Regen, dass einmal Wasser oben reingelaufen sei und dass sie manchmal Angst gehabt hätten, weil man ein Zelt nicht absperren kann.
Andere rührten sich jetzt langsam mit ihren Urlaubserinnerungen, einer trumpfte mit Kenia auf, neun Kinder berichteten, dass sie noch nie im Urlaub waren, weil sie Viecher daheim haben, die man nicht alleine lassen kann.
Einen kleinen Jungen konnte ich beim besten Willen nicht verstehen, so breit redete er den fränkisch-hessischen Dialekt. Ich versuchte ihm zu erklären, warum ich immer wieder fragen musste, was er gesagt hätte, schließlich sagte ich einen Satz auf englisch und fragte dann, wer mich verstanden hätte. Alle schüttelten kichernd den Kopf.
»Das war Englisch«, sagte ich. »Man kann eine andere Sprache nur mit dem sprechen, der sie auch versteht. Und wenn ihr euren Dialekt sprecht, dann kann ich euch nicht verstehen, weil ich ihn nie gelernt habe.«
Wieder kicherten alle.
»Kartoffeln heiße bei uns fei Krombeern«, rief ein Mädchen, »nur dass Sie’s glei wisse!«
»Gut«, sagte ich, »das merke ich mir. Und für euch habe ich auch ein Wort: Schrippe. Das ist aus Berlin und heißt Brötchen.«
Kennzeichen der Klasse war wohl ihr Kichern, stellte ich fest.
Ich machte mir einen Sitzplan, schrieb Schülerlisten, versuchte die Kinder auswendig mit ihrem Namen aufzurufen und verwechselte, zum kichernden Vergnügen der Kinder, immer wieder Eva mit Christine und Matthias mit Rolf.
Gegen elf wurde es im übrigen Schulhaus unruhig, die Kollegen ließen ihre Schäfchen springen. Auch ich ließ schließlich meine Drittklässler gehen, blieb einen Moment noch alleine im Klassenzimmer, setzte mich hinter mein Pult.
War das nun das, was ich gesucht hatte? Es war sicher anders, als Buchtitel und Preislisten durch den Computer zu jagen und Telefonate mit ungeduldigen Händlern zu führen. Aber was war vor Berlin? Sofort fiel mir diese letzte Klasse ein, die ich ein halbes Jahr lang im Seminar unterrichten musste. Kaputte Stadtkinder, die Mädchen Barbie-Imitationen, die Jungen Stallone-Fans. Geld und Mode, Killen und Kämpfen in den Köpfen von Dreizehnjährigen, und ich davor, mit dem vergeblichen Versuch, noch etwas anderes in diese Köpfe hineinzubekommen. Damals sind meine Illusionen zerbrochen, die Tage habe ich gezählt bis zu den Ferien, bis ich diese Brut nicht mehr sehen musste, einschließlich des allwissenden Seminarleiters, der für jede Situation eine theoretische Lösung hatte, aber genau wusste, warum er sich nicht selber vor die Klasse stellte.
Dann kam die Prüfung, die schlechte Staatsnote. Nach dem ersten Erschrecken war ich fast froh, dass sie mich nicht genommen hatten. Jemand anderes hatte die Entscheidung für mich getroffen. Ein Studium für die Katz, aber doch noch die Kurve gekriegt. Und dann, gegen meine eigentliche Überzeugung, die Warteliste. Versuchen musste man es, schon der Mutter wegen.
Und jedes Jahr aufs neue musste ich auf dem Wartelistenfragebogen meinen gewünschten Einsatzort angeben. Erste Wahl und Zweite Wahl. Erste Wahl war immer München, aber nicht im Stadtkern, sondern irgendwo ein paar Kilometer draußen. Aber genau das wollten alle anderen Kollegen auch, da gab es also keine freien Stellen. Also zweite Wahl irgendwo, wo die Chancen besser waren. Unterfranken, sagte jemand, kein Mensch will nach Unterfranken. Also füllte ich aus: Zweite Wahl: Unterfranken. Eigentlich war für mich der ganze Lehrerberuf nur noch zweite Wahl, aber auch in drei Jahren Berlin war mir keine bessere erste Berufswahl eingefallen.
Das Klassenzimmer sah kahl aus, erst als die bunten Ranzen nicht mehr da waren, fiel es mir auf. Ich könnte die Kinder ihr schönstes Ferienerlebnis malen lassen. Schönstes Ferienerlebnis, wahnsinnig originell, aber mir fiel nichts anderes ein. Und immerhin mal kein Aufsatz, sondern ein Bild, es könnte was Gutes dabei rauskommen. Das Meer bei St. Peter oder die Zebras in Kenia oder diese ulkige Geschichte von diesem, wie hieß er noch, ich würde es schon noch lernen, jedenfalls einer von denen, die nicht weggefahren waren. Er erzählte vorhin:
»Die Kuh will saufen, weil sie Durscht hat. Und geht zum Bach, guckt die Böschung runter, aber das Wasser ist viel zu weit weg. Also macht sie noch einen Schritt, guckt wieder runter, aber das Wasser ist immer noch zu weit weg. Da macht sie noch einen Schritt, aber da ist schon keine Weide mehr, sondern nur noch ein bisschen Gras über dem Lehm. Die Kuh rutscht mit beiden Beinen voran die Böschung runter, unten ist der Boden ganz nass und weich, und die Beine sinken ein, bis zum Bauch. Da steht sie, den Kopf ganz tief unten am Wasser. Jetzt könnt sie saufen, aber jetzt will sie gar nicht mehr und muht nur noch. Die Hinterbeine sind noch immer oben auf der Weide, und den Hintern streckt sie hoch zum Himmel. Und sie hat Angst und strampelt und sinkt davon immer tiefer ein. Sie schreit wie ein Ochs, weil sie so Angst hat, und der Bauer hört’s und muss drei Nachbarn rufen, weil er sie nicht alleine rauskriegt.«
Der Matthias hat das erzählt, richtig. Ich stellte mir seine Geschichte auf einem Bild an der Wand vor. Die vier Männer, wie sie gemeinsam die Kuh aus dem Bach ziehen. Zu dumm, dass ich ihnen nicht gesagt hatte, sie sollten am nächsten Tag ihre Malsachen mitbringen.
Читать дальше