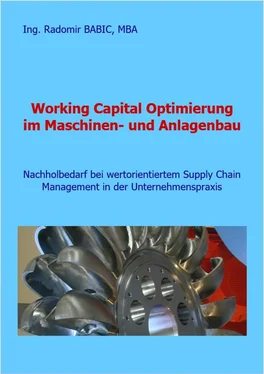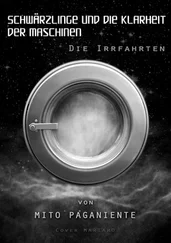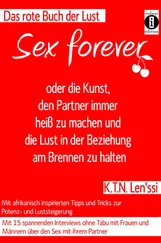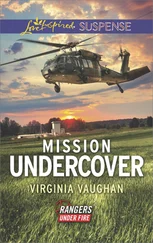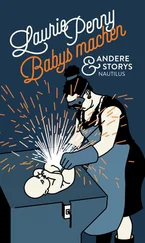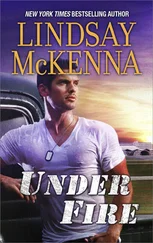bspw. … beispielsweise
CAPM … Capital Asset Pricing Model
CCC … Cash Conversion Cycle
CE … Capital Employed
CF … Cash Flow
C2C-Cycle … Cash to Cash Cycle
DCF … Discounted Cash Flow
d. h. … das heißt
Diagr. … Diagramm
DIH … Days Inventory Held
DII … Days in Inventory
DIO … Days Inventory Outstanding
DM … Direktes Material
DPO … Days Payables Outstanding
DSO … Days Sales Outstanding
DTC … Design to Cost
DTO … Design to Objectives
€ … Euro
EBIT … Earnings Before Interest and Taxes
EBITDA … Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
EK … Eigenkapital
et al. … und andere
etc. … et cetera
EVA … Economic Value Added
evtl. … eventuell
f. … folgende Seite
FCF … Free Cash Flow
ff. … fortfolgende Seiten
FK … Fremdkapital
F&E … Forschung und Entwicklung
ggf. … gegebenenfalls
ggü. … gegenüber
GuV … Gewinn- und Verlustrechnung
Hrsg. … Herausgeber
ICV … Internationaler Controller Verein
i.d.R. … in der Regel
IM … Indirektes Material
inkl. … Inclusive
IV … Immaterielles Vermögen
JIS … Just-in-Sequence
JIT … Just-in-Time
KPI … Key Performance Indicator
LuL … Lieferung und Leistung
Mio. … Millionen
MtO … Make-to-Order
MtS … Make-to-Stock
NOPAT … Net Operating Profit after Taxes
Nr. … Nummer
NWC … Net Working Capital
OFCF … Operating Free Cash Flow
RHB … Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
ROCE … Return on Capital Employed
QFD … Quality Function Deployment
s. … siehe
S. … Seite
SAV … Sachanlagenvermögen
SCM … Supply Chain Management
SG&A … Selling, General and Administrative Expenses
SHV … Shareholder Value
sog. … so genannt
u.a. … unter anderem
VDI … Verein deutscher Ingenieure
VE … Value Engineering
vgl. … vergleiche
VM … Value Management
vs. … versus
WA … Wertanalyse
WACC … Weighted Average Cost of Capital
WCM … Working Capital Management
WIP … Work in Progress
z. B. … zum Beispiel
Verzeichnis der Abbildungen
Abb. 1: Thema-Eingrenzung. 18
Abb. 2: Zuordnung Hypothesen - Forschungsfragen. 21
Abb. 3: Untersuchungsdesign. 22
Abb. 4: Aufbau der Arbeit 25
Abb. 5: Wertorientierte Kennzahlen. 29
Abb. 6: ROCE-Baum (alle Werte x 1.000) 30
Abb. 7: Grundkonzept der durchschnittlich gewichteten Kapitalkosten. 31
Abb. 8: Berechnung von G+V, WACC, EVA.. 33
Abb. 9: Finanzielle Werttreiber bei Economic Value Added (EVA) 34
Abb. 10: Shareholder Value. 36
Abb. 11: Zusammenhänge zwischen Free Cash Flow und WACC. 36
Abb. 12: Berechnung von Shareholder Value mit Terminal Value. 37
Abb. 13: Working Capital 2001–2010 in der Schweiz, in Deutschland und in den USA.. 39
Abb. 14: Zusammenhang von Return on Capital Employed (ROCE) und Working Capital 39
Abb. 15: Working Capital-Zyklus. 40
Abb. 16: Stellhebel im Working Capital Management 41
Abb. 17: Bandbreite des Working Capital-Umfangs. 42
Abb. 18: Kennzahlen/Indikatoren für Working Capital-relevante Prozesse. 43
Abb. 19: Net Working Capital 44
Abb. 21: Eigene Abbildung in Anlehnung an Losbichler 201l, Berechnung des C2C-Cycles. 46
Abb. 20: Einfluss der Änderung des C2C-Cycle auf den Cash Flow.. 47
Abb. 22: Reichweitenanalyse / Benchmarks. 49
Abb. 23: Auswahl empfohlener KPIs zur Working Capital-Steuerung. 50
Abb. 24: Wirkungen des Working Capital Managements (Quelle Losbichler, 2010) 51
Abb. 25: Wertsteigerungshebel und Geschäftswertbeitrag. 52
Abb. 26: Zusammenhang G+V, Bilanz und Cash Flow-Statement 54
Abb. 27: Cash Flow-Statement (Kapitalflussrechnung) 55
Abb. 28: Veränderung der liquiden Mittel, Cash Flow-Statement 56
Abb. 29: Index der Marktkapitalisierung 2005-2008. 57
Abb. 30: Reduzierung der Materialkosten - Einfluss auf EBIT. 58
Abb. 31: Wirkung von Einkauf und Supply Chain auf das operative Ergebnis (EBIT) 58
Abb. 32: Eigene Abbildung in Anlehnung an Heesen/Moser 2013: 218. 61
Abb. 33: Kostenbeeinflussbarkeit während Projektphasen. 61
Abb. 34: Working Capital reduzieren: Ansätze. 62
Abb. 35: Kernprozesse des Working Capital Managements. 63
Abb. 36: Typische Aufgaben und Schwachstellen im Working Capital Management 64
Abb. 37: Forecast-to-Fulfill-Teilprozessschritte (Quelle: Ernst & Young, 2013) 65
Abb. 38: Treiber und Zielsetzungen im Forecast-to-Fulfill-Cycle. 66
Abb. 39: Order-to-Cash-Teilprozessschritte. 69
Abb. 40: Treiber und Zielsetzungen im Order-to-Cash-Cycle. 70
Abb. 41: Purchase-to-Pay-Teilprozessschritte. 74
Abb. 42: Treiber und Zielsetzungen im Purchase-to-Pay-Cycle. 75
Abb. 43: Fehlsteuerung durch Ertragsoptimierung in den Abteilungssilos. 79
Abb. 44: Typische Zielkonflikte entlang der Wertschöpfungskette. 79
Abb. 45: Formen der organisatorischen Verankerung des WCM.. 81
Abb. 46: Verantwortung für die Bestandteile des Working Capital 82
Abb. 47: Prozessverantwortliche und Bilanz. 82
Abb. 48: Praxisbeispiel Projektablauf mit dezidiertem Experteneinsatz. 85
Abb. 49: 6-Phasen Vorgehensfahrplan zum Working Capital Management 86
Abb. 50: Verbesserungspotenziale vs. Schwierigkeitsgrad der Umsetzung. 87
Abb. 51: Treiber des Working Capital im Überblick und deren Wirkungsweise. 89
Abb. 52: Wirkungsweisen der Maßnahmen zur Optimierung des Cash Cycle im Überblick. 90
Abb. 53: Erweiterung der „Porter’schen Wertschöpfungskette“. 91
Abb. 54: Ableitung Superiority Index. 92
Abb. 55: Zielsetzung von Value Cash Velocity. 93
Abb. 56: Zielsetzung von Value Chain Velocity. 93
Abb. 57: Ableitung Stellhebel für Verbesserungen aus Treiberbaum und Fokusbereichen. 94
Abb. 58: Ansatz zur Erhöhung der „Cash & Value Chain Velocity“. 95
Abb. 59: Generelle Vorgehensweise zur Implementierung „überlegener Geschäftsmodelle“. 96
Abb. 60: Anwendung des Value Managements bei Entwicklungen. 98
Abb. 61: Die drei Werthebel des Value Managements. 99
Abb. 62: Wertanalytische Aufgaben im Maschinenbau mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. 101
Abb. 63: Konzept des Target Costing. 102
Abb. 64: Beispiel Materialkosten-Einsparung. 107
Abb. 65: Überprüfung von Hypothesen. 134
Autor
 |
Ing. Radomir BABIC, MBABerufliche Entwicklung vom Facharbeiter bis zur Führungskraft im technischen Umfeld des Maschinen- und Anlagenbaus, bei vier weltbekannten Unternehmen. Sein beruflicher Werdegang begann in Kroatien und folgte in Deutschland und Österreich weiter. Dabei arbeitete er in Produktentwicklung, Standardisierung, Konstruktion, Produktion, Qualitätsmanagement und Vertrieb/After Market Business. Mitarbeit in den interdisziplinären Teams bei den Innovations- und Prozessoptimierungsprojekten. |
Graz, 06. März 2016
Kontakt: radomir.babic@chello.at
Der theoretische Rahmen dieser Arbeit ergibt sich aus dem Konzept der wertorientierten Unternehmensführung. Wertorientierte Unternehmens-steuerungbasiert auf dem SHV-Ansatz, in dem die gesamte Unternehmenssteuerung auf die Ziele der Eigentümer (Shareholder) ausgerichtet ist. Shareholder sind vordergründig an einer langfristigen Steigerung des Eigenkapitalwertes interessiert, der auf unterschiedlichen Wegen ermittelt werden kann. In dieser Arbeit wurde an den Discounted Cashflow-Ansatz angeknüpft, bei dem der Wert des EK auf Basis der den Eigentümern zukünftig zufließenden Zahlungen bestimmt wird. So wurde der Fokus auf die Verfahren DCF und EVA® gerichtet.
Читать дальше