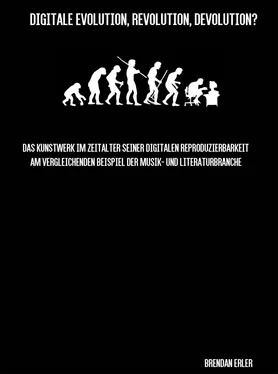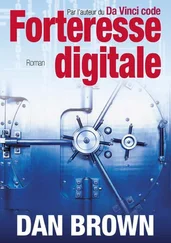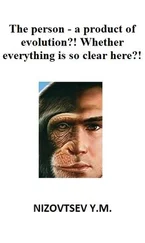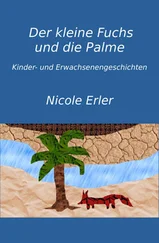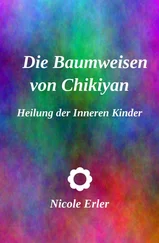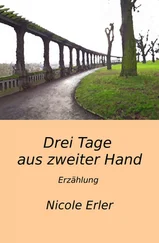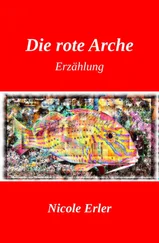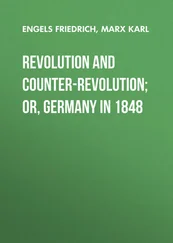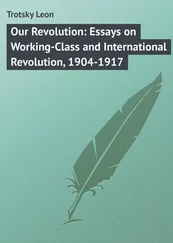Neben den Annahmen der Zentralität von Kultur und der strukturalistischen / handlungstheoretischen Verbindung aus Selbst- und Fremdbestimmung ist es das Verständnis von Kulturbegriffen und Vorstellungen als Ausdruck gesellschaftlicher Machtkämpfe, das die Cultural Studies für diese Arbeit besonders relevant erscheinen lässt. Neben den ursprünglichen, normativen Kulturbegriff gesellt sich Ende des 19. Jahrhunderts ein totalitätsorientierter, der alles umfasst, „was über Natur hinausgeht“ (Moebius 2009, 18). Die Schwammigkeit und gleichzeitige Homogenität dieser Vorstellung führte im 20. Jahrhundert zu weiteren Differenzierungen. Im differenzierungstheoretischen Kulturbegriff bildet Kultur „ledigilich ein Subsystem unter vielen“ (ebd., 19). Aus dem cultural turn entsteht dann der bedeutungs- und wissensorientierte Kulturbegriff, zu dem auch die Cultural Studies zu zählen sind, und dessen Grundannahme lautet, dass „weder die kulturellen Codes und Sinnsysteme noch die Praktiken, mit denen die symbolische Ordnung entweder ausgedrückt, realisiert oder (re-)produziert wird, eine überzeitliche Dauer oder universell gültige Merkmale aufweisen“ (ebd.).[44] Während in normativen Konzeptionen die Kultur als Selbstvergewisserungs- und Abgrenzungsinstrument der (vornehmlich) bürgerlichen Gesellschaft fungiert, stellen die Cultural Studies eben diesen Prozess der Ab- und Ausgrenzung und den Kampf um Deutungshoheit in der kulturellen Arena ins Zentrum der Aufmerksamkeit.
Übertragen auf diese Untersuchung stellt sich einerseits die allgemeine Frage, inwiefern der Angriff auf das Urheberrecht und das Konzepts des Autors als ein Angriff auf das kulturelle und gesellschaftliche Selbstverständnis der bürgerlichen Gesellschaft darstellt und daher dementsprechend emotionale Reaktionen evoziert. Andererseits hat der Vergleich von Musik- und Literaturdiskurs auch zum Ziel, zu untersuchen, ob sich in den Diskursen zur zunehmend digitalen Realität Unterschiede ausmachen lassen, die auf einen normativen Kulturbegriff zwischen minderwertiger Populärkultur und anspruchsvoller Hochkultur zurückzuführen sind. Ob sich also ein empfundener Angriff auf das bürgerliche Selbstverständnis in einer emotionaleren und grundsätzlicheren Reaktion auf das Eindringen der Digitalisierung in die „heiligen“ Hallen der Literatur im Vergleich zur „profanen“ Popmusik zeigt und bestätigt.
2.5 Urheberrecht und kulturelle Grundversorgung: Naturrecht oder Naturalisierung historisch-spezifischer Eigentumsverhältnisse?
Ein Kernargument liberaler Wirtschaftstheorie, welches immer wieder zum Schutz des geistigen Eigentums angeführt wird, ist die Notwendigkeit eines ausreichenden Investitionsschutzes. Wird die mit der Produktion von Gütern verbundene Anfangsinvestition nicht durch entsprechende Exklusivrechte geschützt bzw. dieser Schutz auch praktisch umgesetzt, so wird es zu einer Reduktion von Produktion und im Kultursektor zu einem Verlust kultureller Vielfalt kommen (vgl. z.B. Piolatto 2012, 31). Das ist eine eindeutig funktionale, utilitaristische Begründung des Werkschutzes, die damit deutlich dem Copyrightgedanken näher steht als der individualrechtlichen Begründung geistigen Eigentums: „Das Copyright ist ein reines Wirtschaftsrecht, das in erster Linie der Sicherung von Investitionen dient. Als Grund für die Gewähr des Rechts wird nicht die Verbindung zwischen Urheber und Werk, sondern der Belohnungsgedanke hervorgehoben. Belohnt wird derjenige, der, unter Einsatz gewisser finanzieller und/oder sonstiger Mittel, der Gesellschaft einen Dienst durch die verantwortliche Herstellung eines Wirtschaftsgutes mit einem gewissen Wert erbracht hat. Die Amortisierung solcher gemeinnützigen Investitionen soll durch das Copyright Law garantiert werden […] Der utilitaristische Grundgedanke des Copyrights entspricht also einer in erster Linie zweckorientierten Zielsetzung, die mit einer naturrechtlichen Begründung kaum vereinbar wäre“ (Kreutzer 2008, 38f.).
Wichtig ist einerseits die Tatsache, dass es sich beim Copyright um ein von Menschen gemachtes, positives Recht handelt, das mit seinem Werkschutz einen bestimmten Zweck im Sinne der Mehrung des gesellschaftlichen Wohlstandes erfüllt, im Gegensatz zur in Deutschland gängigen Vorstellung eines aus der Beziehung zwischen Schöpfer und Werk resultierenden vorstaatlichen Naturrechts als „Selbstzweck“, das den Urheber in den Mittelpunkt des Schutzes rückt. [45] Ein derartiges Naturrecht ist einerseits wie das Menschenrecht in der Theorie unveräußerlich und sakrosankt. Materielles wie geistiges Eigentum „nach John Lockes Vorstellung war aufgrund seiner Fundierung im Naturrecht vorstaatlich und vorsozial. Eigentum entsteht auch ohne und außerhalb von (politischer) Gesellschaft“ (Oberndörfer 2005, S. 29).
Andererseits immunisiert dieser Status als vermeintliches Naturrecht gegen jedwede Kritik und Reformanstrengung, ob gerechtfertigt oder nicht. Der Stempel des Naturrechts entzieht die Materie sozusagen dem Prozess politischer Willensbildung. „Getragen vom Zeitgeist der Spätromantik und der Aufklärung wurde das Urheberrecht rechtsphilosophisch so erklärt, dass es keiner Begründung oder Rechtfertigung bedarf. Es ist ein Naturrecht, das als ‘Geistiges Eigentum‘ bezeichnet wird“ (Kreutzer 2012). Das ist mindestens insofern fragwürdig, als Naturrechte überhaupt erst von politischen Gemeinschaften rückwirkend etabliert werden können und somit Ausdruck bestimmter politischer Konstellationen und historischer Situationen sind und damit per definitionem eben nicht vorstaatlich und unpolitisch, sondern Ergebnis politischer Auseinandersetzung. Auf diese Weise lassen sich bestehende Herrschaftsverhältnisse und möglicherweise problematische vergangene Aneignungsprozesse rechtfertigen. Die „Ideen, dass das Recht autonom und „Ausdruck einer Oberzeitlichkeit und Unveränderbarkeit sein müsse“ seien „höchst fragwürdig. Sie legen vielmehr die historische Interpretation nahe, dass die Juristen, die sich im Zusammenhang mit dem Phonographen dieser Vorannahmen bedienten, die Meinung vertraten, dass das Recht gleich bleiben sollte, gerade weil sich die Bedingungen geändert hatten“ (Dommann 2014, 102).[46]
Besonders deutlich wird dies an der Frage der „ursprünglichen Akkumulation“, also der Frage, wie es im Zuge der Transformation von einer feudalen in eine „bürgerlich-kapitalistische“ Gesellschaftsordnung zur Ungleichverteilung an Ressourcen / Kapital kam. Während die klassische Nationalökonomie dies mit dem Fleiß und der Arbeitskraft Einzelner erklärte, weil sich nur so die Trennung von Produktionsmitteln und Arbeitskraft rechtfertigen ließ, betont Marx die Gewaltsamkeit dieser „sogenannten ursprünglichen Akkumulation“, wie er sie spöttisch nennt, die dementsprechend besser als „Expropriation“ zu bezeichnen ist. Auch die damit einhergehende Vorstellung eines fairen Wettbewerbs in einem freien Markt ist ein Mythos. Vielmehr bedurfte es der vom Wirtschaftsliberalismus so verteufelten Hilfe des Staates, um den Kapitalismus überhaupt erst zu ermöglichen.
„Wie Marx eindrucksvoll zeigt, ist diese innere Landnahme von Anfang an ein hochpolitischer, auf Staatsintervention beruhender Prozess. Weder die Veränderung der Eigentumsverhältnisse und die Expropriation des Landsvolks, noch die Zurichtung und Disziplinierung der freigesetzten Arbeitskräfte für die neue Produktionsweise sind ohne Staatsintervention möglich. So wurden Gesetze, die ihren Ursprung in der Feudalzeit hatten, immer wieder genutzt, um einen allgemeinen Arbeitszwang zu etablieren und den Lohn politisch zu regulieren […] Der Kapitalismus war somit schon in seinen Anfängen keine selbstregulierte Marktwirtschaft, vielmehr fungierte der Staat als unentbehrlicher Geburtshelfer der neuen Produktionsweise“ (Dörre 2009, 37f.). In dem man die Quelle gegenwärtiger Ungleichheit in vergangener Leistung sucht, schützt man sich vor Kritik an der Ungerechtigkeit der aktuellen Verhältnisse. [47] Die Kritik am vermeintlich leistungslosen Schmarotzertum der Verwerter in Urheberrechtsdiskurs fußt wesentlich auf dieser Ur-Kritik am „Recht des Kapitals auf die Früchte fremder Arbeit“, welches Marx in seinen „Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie“ identifiziert.
Читать дальше