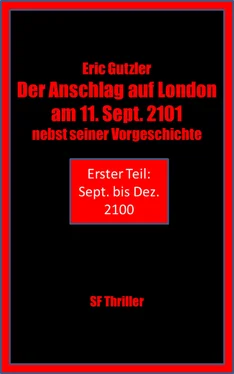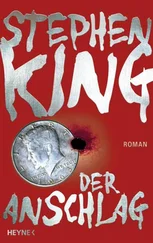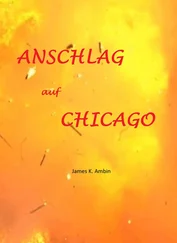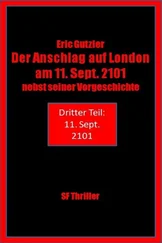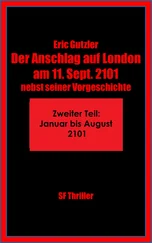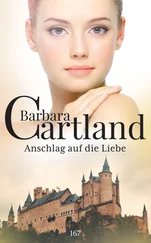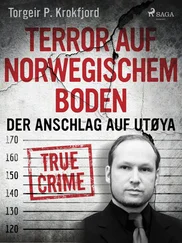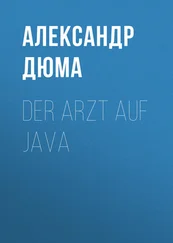Auch die Erzieher und Lehrer hatten keine Namen, sondern wurden mit dem Buchstaben T und einer anschließenden Zahl angesprochen. Nur der Direktor trug kein Zahlenschildchen und hieß der Direktor.
Vom Tagesablauf der ersten beiden Jahre im Camp besaß Solveig nur noch eine schwache Erinnerung an Schwimmkurse, Labyrinthspiele und Leseunterricht, weil die Zeit in der dunklen Zelle die anderen Ereignisse fast vollständig ausgelöscht hatte. Später war der Tagesablauf immer gleich: Der Tag begann nach dem Wecken um 6.30 mit einer halben Stunde Gymnastik und anschließendem Schwimmen. Danach wurde ein, wie sie später herausfand, muskelbildendes und wachstumbeschleunigendes Frühstück eingenommen. Der Unterricht begann um 8.00 und dauerte bis zum Mittag. Die Kinder erhielten Unterricht in Spanisch, ab dem dritten Schuljahr zusätzlich in Russisch und ab dem sechsten in Chinesisch. Der Wortschatz, den sie in den Fremdsprachen übten, war ein Alltagswortschatz; literarische Texte lasen sie nicht. Sie erhielten zunächst keinen Unterricht in Geschichte oder Geographie. Sie erfuhren nichts von Erdteilen, Ländern, Völkern und ihrer politischen oder religiösen Geschichte. Stattdessen wurden sie in Biologie, Chemie, Physik, Mathematik und Teilen der Medizin unterrichtet. Außerdem mussten sie ein Musikinstrument erlernen, wobei sie zwischen dem Klavier und einem Holzblasinstrument wählen konnten.
Nach dem Mittagessen und einer Freistunde begann ein dreistündiger Sportunterricht. Die eine Hälfte bestand aus einem Ausdauertraining, in der anderen Hälfte wurden Kampfsportarten geübt. Das Abendessen wurde um 18.30 eingenommen, um 20.00 war Bettzeit, und fünfzehn Minuten später wurde das Licht gelöscht.
Nach acht Tagen Schulunterricht verbrachten die Kinder immer zwei Tage im Freien. Das Gelände außerhalb der Gebäude war hügelig und bewaldet. Unter der Führung von zwei Lehrern marschierten die Kinder nach dem Frühstück los. Etwa zwei Stunden später bestimmten die Führer eine Waldlichtung oder eine Wiese am Waldrand als Lagerplatz. Danach mussten die Kinder Zelte aufschlagen und ein Feuer entfachen, auf dem das Essen gekocht wurde.
In den späteren Jahren, als Solveig zehn geworden war, durften die Kinder keine Zelte mehr mitnehmen, sie mussten sich ihre Schlafstelle im Freien einrichten – auch wenn es regnete oder manchmal schneite. Im Lauf der Jahre wurde an den Tagen im Wald auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln reduziert. Als Solveig zwölf war, mussten die Kinder ihre Nahrung im Wald suchen, Suppen aus Blättern oder Baumrinde bereiten, Fallen aufstellen oder versuchen, Tiere mit Pfeil und Bogen zu erlegen. Trotz dieser Einschränkungen fieberten die Kinder den beiden Tagen im Freien entgegen, weil diese Tage die einzige Unterbrechung der sonstigen Monotonie des Tagesablaufs und der strengen Kontrolle, der sie in der Schule unterworfen waren, bildeten.
An diesen Tagen im Wald konnten die Kinder jedoch nicht nach Lust und Laune herumstreifen, sondern sie erhielten Aufgaben, die sie entweder in Gruppen, paarweise oder allein lösen mussten. Manchmal wurden die Gruppen und Paare von den Führern eingeteilt, manchmal durften die Kinder ihre Gruppen selbst zusammenstellen. Die Führer beobachteten genau, welche Kinder einander wählten, sich zu Gruppen zusammenschlossen oder Paare bildeten, und stellten daher mitunter Gruppen zusammen, in denen Spannungen entstehen mussten, die die Durchführung der Aufgaben erschwerten und anderen Gruppen Vorteile verschafften. So wurde über jedes Kind ein Dossier angelegt, in dem über die Jahre festgehalten wurde, ob es einen durchsetzungsstarken Willen besaß oder ein Mitläufer oder ein Außenseiter war.
Die Spiele waren zunächst Versteck- und Suchspiele oder Schnitzeljagden, manchmal waren es Kampfspiele. Die Sieger erhielten keinen besonderen Preis, aber die Verlierer mussten den Siegern in den folgenden acht Tagen Dienste erweisen, die Betten machen, die Wäsche waschen, die Waschräume putzen und das Geschirr nach den Mahlzeiten abtragen. Im Lauf der Jahre wurden die Kampfspiele gewalttätiger. Die Parteien, die sich bekriegten, erhielten die Erlaubnis, Gefangene zu machen, die Gefangenen zu fesseln und im Wald liegen zu lassen. Als Solveig dreizehn war, wurden Gewehre ausgegeben, mit denen Hartgummikugeln verschossen werden konnten. Wurde ein Kind getroffen, galt es als tot und musste ausscheiden. Da die Kinder Bekleidung trugen, die mit kleinen Sendern ausgerüstet waren, wurden die Führer über jeden Treffer informiert.
Das Gebäude, in dem Solveig mit den anderen Kindern lebte, bestand aus vier Flügeln, die um ein größeres Haus gruppiert waren. In dem zentralen Gebäude befanden sich auf verschiedenen Stockwerken der Speisesaal mit der Küche, die Turnhalle und die Schwimmhalle. Ganz oben lagen die Räume der Erwachsenen, zu denen die Kinder keinen freien Zutritt hatten. Die Kinder hatten ihre Schlafsäle und Aufenthaltsräume in einem der Flügel. Die anderen drei Flügel standen in den ersten beiden Jahren leer. Während einer Fragestunde mit dem Direktor und den Lehrern stellte Solveig die Frage, wozu die anderen Häuser daseien.
„Ich habe eine Frage“, sagte Solveig.
Fragen durften nur in der Fragestunde und in der Anwesenheit aller Kinder gestellt werden.
„Welche Frage hast du, F 217?“ antwortete der Direktor.
„Wozu sind die leeren Räume da?“
Der Direktor blickte die anwesenden Lehrer an und zögerte einen Augenblick mit der Antwort: „Ihr seid die ersten. Eigentlich sollte hier schon ein weiterer Jahrgang aufgezogen werden, aber es gab einige … Schwierigkeiten. Im nächsten Jahr kommt eine neue Gruppe, die zieht in den zweiten Flügel, jedes Jahr kommt eine weitere Gruppe, in drei Jahren werden alle Räume bewohnt sein.“
Solveig meldete sich. Der Direktor sah sie an: „Hast du noch eine Frage, F 217?“
„Ja, ich habe noch eine Frage. Was geschieht mit uns im vierten Jahr?“
Der Direktor machte sich eine Notiz, dann blickte er auf: „In drei Jahren bauen wir ein neues Gebäude für vier weitere Jahrgänge. Ihr bleibt in eurem Gebäude wohnen.“
Neben dem Direktor und den Lehrern gab es noch eine Gruppe Erwachsener. Ihre Bezeichnung begann mit dem Buchstaben S. Die meisten S-Personen waren Frauen, die die Mahlzeiten zubereiteten oder bei Verletzungen und Erkrankungen Dienste verrichteten. Die S-Frauen waren bei den Kindern sehr beliebt, zum einen, weil das Essen im Gegensatz zur Monotonie des Tagesablaufs sehr abwechslungsreich und schmackhaft war, zum anderen, weil die S-Frauen sehr sanft und umgänglich waren und für viele Kinder zu einer Art Mutterersatz wurden. Auch Solveig hatte mit einer der S-Frauen Freundschaft geschlossen. S 483 war Anfang zwanzig, hatte dunkle Haare und eine sehr blasse Hautfarbe. Der enge Kontakt zwischen ihr und Solveig war entstanden, als das kleine Mädchen nach zwei regnerischen Waldtagen hohes Fieber bekommen hatte, aus dem sich eine Lungenentzündung entwickelte. Solveig wurde in die Krankenstation verlegt, wo sie eine Woche bleiben musste und von S 483 gepflegt wurde.
Nachdem Solveig Zutrauen zu ihrer Pflegerin gefasst hatte, fragte sie sie am Ende der Woche, ob sie ein Geheimnis wahren könne. Als S 483 ihr versprach, jedes Geheimnis, das man ihr anvertraue, für sich zu behalten, erklärte Solveig, dass sie einen richtigen Namen habe und sich daran erinnere, Solveig Solness zu heißen. Die Pflegerin sah sie kurz prüfend an und antwortete, sie habe davon gehört, dass einige Kinder des ersten Jahrgangs von draußen stammten. Sie erwartete jetzt, dass F 217 die Frage stellen würde, warum sie und die anderen Kinder in dem Camp seien. Doch stattdessen sagte Solveig: „Hast du auch einen richtigen Namen?“
„Nein“, sagte S 483 mit leiser Stimme, „ich habe keine Eltern und habe daher auch keinen Namen erhalten.“
Читать дальше