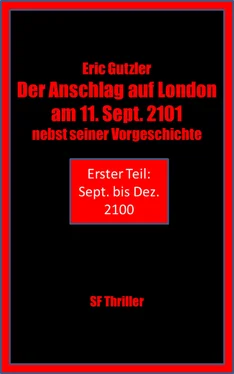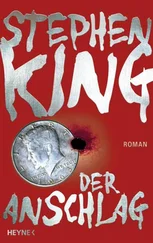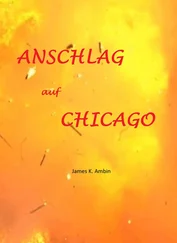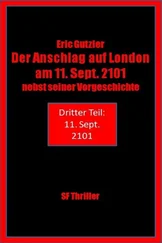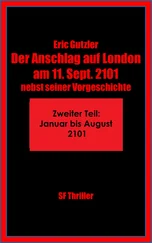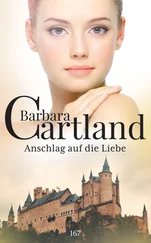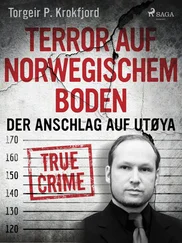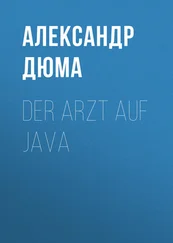„Welches Spiel meinst du denn?“
„Das Spiel mit den Steinen, die man zusammenfügen kann.“
Erst jetzt bemerkte ihre Mutter die zusammengesetzte Figur, sah ihre Tochter voller Staunen an: „Hat dir Papa dabei geholfen?“
„Nein, ich war allein im Zimmer. Aber es war ganz einfach. Die Steine sind nämlich unterschiedlich schwer, die schwersten kommen unten hin, die leichten oben.“
„Na, das wollen wir Papa erzählen“, antwortete ihre Mutter, nahm Solveig bei der Hand und ging mit ihr auf die Suche. Als sie ihren Mann im Gewächshaus gefunden hatte, sagte sie: „Stell dir vor, Solveig hat das Möbius’sche Band zusammengesetzt – ohne irgendeine Hilfe.“
Ein anderes Mal saß ihre Mutter vor dem niedrigen Tisch und sagte zu ihr: „Wir wollen jetzt gemeinsam ein Spiel spielen. Unter diesem Tuch liegen einige Gegenstände. Wenn ich das Tuch wegziehe, darfst du dir die Sachen ansehen. Dann bedecke ich sie wieder, und du sagst mir, woran du dich erinnerst. Magst du dieses Spiel spielen?“
Solveig nickte: „Ja gern, Mama.“
Noch als Erwachsene erinnerte sie sich, woran sie sich damals erinnerte hatte: an eine silberne Münze, eine rötliche Münze mit einem Loch in der Mitte, einen weißen Knopf, einen Ring, einen Ring mit einem Stein, ein Armband, eine Glaskugel, einen Würfel, eine weiße und eine schwarze Schachfigur, eine Spielkarte, einen grauen Stein, ein braunrotes Blatt, ein gestreiftes Schneckenhaus, ein kleines Messer, eine Pinzette, eine Batterie und eine Patrone.
„Toll hast du das gemacht“, sagte ihre Mutter, nachdem sie die Gegenstände genannt hatte, „von zwanzig Dingen hast du dich an achtzehn erinnert.“
„Was ist der Unterschied zwischen achtzehn und zwanzig?“
So hatte sie im Alter von dreieinhalb Jahren Zahlen kennengelernt, erst die von eins bis zwanzig, dann sogar bis fünfzig. Als ihre Eltern sahen, wie leicht ihr das Lernen fiel, sagte ihr Vater eines Abends zu ihr: „Die Kette, die du um den Hals trägst, hast du zu deinem dritten Geburtstag erhalten. Teil der Kette ist eine kleine Scheibe, die die Form einer Muschel hat. Obwohl die Scheibe ganz dünn ist, besteht sie aus zwei Hälften. Auf den Innenseiten sind dein Geburtstag, deine beiden Vornamen und unser Familienname eingraviert. Wenn du groß bist, wirst du herausfinden, wie sich die Muschel öffnen lässt. Ich habe dir auf diesem Blatt aufgeschrieben, was in der Muschel steht. Siehst du die Schrift?“
Als sie nickte, gab er ihr den Zettel: „Wenn du dir die Schrift mit deinem Namen einprägst, kennst du schon zehn Buchstaben. Wenn du willst, kannst du versuchen, die Buchstaben mit einem Stift abzumalen.“
„Wann wurde ich geboren, Papa?“
„Am 4. Juli 2077.“
Einige Zeit später traf Solveig ihren Vater in seinem Arbeitszimmer an. Er saß an seinem Tisch vor einem Bildschirm und schrieb. Als er seine Tochter erblickte, nahm er sie auf den Schoß und zeigte ihr die in der Tischplatte eingelassene Tastaturfolie: „Siehst du die weißen Buchstaben auf den schwarzen Feldern? Wenn du die Buchstaben erkennst, die du für deinen Namen brauchst, dann drücke sie kurz nach unten.“
„Da ist das S. Darf ich drücken?“
Er nickte. So drückte sie nacheinander die Buchstaben ihres Rufnamens, vergaß aber das g, weil es nicht gesprochen wurde. Als sie danach auch die Buchstaben des zweiten Vornamens und des Familiennamens in der richtigen Reihenfolge drückte, lobte ihr Vater sie sehr und zeigte ihr, wie man das Geburtsdatum eingab.
„Wenn du größer bist und richtig lesen und schreiben kannst, wirst du oft vor einem Bildschirm sitzen und eine Tastatur oder ein Mikrophon benutzen, um etwas aufzuschreiben. Das Wichtigste an diesem Gerät ist ein kleiner Speicher, in dem man Wörter, Zahlen, Bilder und Musik aufbewahren kann. Auf viele Fragen, die du einmal haben wirst, kannst du die Antworten in dem Speicher finden. Du musst nur wissen, mit welchem Schlüsselwort du die Auskünfte auffinden kannst."
Ein anderes Mal, als Solveig zu ihm gekommen war und gefragt hatte, ob sie noch einmal Buchstabentasten drücken dürfte, zeigte er ihr in einem Bildlexikon verschiedene Tiere, nannte deren Namen und fragte sie, welchen Namen sie schreiben möchte. Alle, Papa, hatte sie geantwortet, woraufhin er ihr die Schreibweise von Hund, Katze, Vogel und Maus zeigte. Sie übte diese Namen mehrmals, wollte danach aber nicht aufhören, bis ihr Vater wieder das Lexikon zur Hand nahm und ihr einen Elefanten, ein Krokodil und einen Schmetterling zeigte. „Die üben wir morgen. Einverstanden?“ Sie hatte genickt und war voller Stolz zu ihrer Mama gelaufen, um ihr vom Buchstabenspiel und einem grünen Krokodil mit ganz vielen Zähnen zu erzählen. In der Folgezeit fragte sie immer wieder nach dem Bildlexikon, bis ihr Vater ihr erlaubte, das Buch in ihr Zimmer mitzunehmen. Beim Blättern stieß Solveig auch auf die Abbildung einer Halskette und zeigte das Bild ihrem Vater, was ihn veranlasste, auf die Muschel und die Innenseiten zu sprechen zu kommen: „Nur wenige Menschen, nur unsere engsten Freunde kennen deinen zweiten Vornamen. Wenn dir einmal später, wenn du erwachsen bist, ein Mann sagt, er sei ein guter Freund deiner Eltern gewesen, dann frage ihn nach deinem zweiten Vornamen. Wenn er den nicht kennt, dann hüte dich vor ihm, denn er gehört nicht zu unseren Freunden. Merke dir das gut. Vergiss es nie!“
In ihrer letzten Erinnerung war es Nacht. Sie erwachte vom Geräusch eines Schusses. Schlaftrunken begann sie, nach ihrer Mama zu rufen. Doch statt ihrer Mutter kamen zwei Männer in ihr Zimmer, zerrten sie aus dem Bett und brachten sie fort. Ihre Eltern hat sie nie mehr gesehen. Wenn sie später an diese Nacht dachte, erinnerte sie sich nur an eine lange Fahrt in einem Lastwagen.
Nach jener Nacht lebte sie in einer Einrichtung, die vom Direktor als Internat, aber von den meisten Aufsichtspersonen eher abschätzig als Camp bezeichnet wurde. Sie hatte kein eigenes Schlafzimmer mehr, sondern schlief in einem Schlafsaal, in dem vierundzwanzig Betten in vier Reihen aufgestellt waren. In dem Schlafsaal schliefen nur Mädchen. In einem anderen Schlafsaal mit vierundzwanzig Betten schliefen nur Jungen. Tagsüber waren alle Kinder beisammen. Sie standen zur selben Zeit auf, sie aßen zusammen, wurden zusammen unterrichtet und trieben zusammen Sport. Die Kinder durften sich nicht mit einem Vornamen anreden, sondern mit den Nummern, die sie erhalten hatten und die sichtbar auf ihre Kleidungsstücke genäht waren. Solveig hieß F 217. Alle Mädchen hatten den Buchstaben F vor ihrer Nummer, alle Knaben den Buchstaben M. Als Solveig von den Aufsichtspersonen angehalten wurde, von sich nur mit der Bezeichnung F 217 zu reden, beharrte sie zu zunächst darauf, sie heiße Solveig Solness. Aber nach mehrtägigem Essensentzug und Unterbringung in einer Zelle ohne Fenster und ohne Licht gab das kleine Mädchen ihren Widerstand scheinbar auf. Tatsächlich jedoch rief sie abends nach dem Zubettgehen und dem Löschen der Lampen die Erinnerungen an ihre Eltern auf und bewahrte sie so über die Jahre. Vor allem das Gespräch, in dem ihr Vater die Innenseiten der muschelförmigen Scheibe erwähnt hatte, schien ihr besonders bedeutsam, weil ihr der Direktor die Halskette abgenommen hatte.
Als sie die anderen Kinder näher kennenlernte und mit ihnen sprach, musste sie feststellen, dass die überwiegende Zahl keine Vornamen kannte und sich nicht daran erinnerte, jemals einen Vornamen gehabt zu haben. Sie kannten nur die Zahlen, mit denen sie angeredet wurden und mit denen sie sich meldeten: F 198, F 207, M 546, M 560 usw. Nur zwei Jungen gaben einmal in einem geflüsterten Gespräch zu, einen Vornamen gehabt zu haben, den sie aus Angst nicht auszusprechen wagten. Einige Jahre später war einer dieser Jungen von einem auf den anderen Tag verschwunden. Bei einer Nachfrage erhielt F 217 nur die knappe Antwort, er sei in ein anderes Internat gebracht worden, wo man sich besser um ihn kümmern könne.
Читать дальше