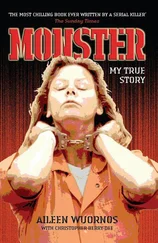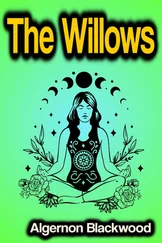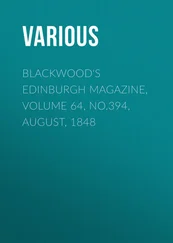1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Für einige Minuten blickte sie mir schweigend und aufmerksam ins Gesicht, Ihre Züge zuckten kaum merklich. Aus ihrem Verhalten schloss ich sofort, worauf sie hinauswollte. Sie war ungeschickt und weitschweifig an das Thema herangegangen, denn es war etwas, wovor sie sich scheute, unsicher, ob es dem Himmel oder der Hölle entstammte.
„Du bist wirklich wunderbar, George“, sagte sie schließlich, „und du hast für fast alles eine Theorie.“
„Vermutungen“, gestand ich.
„Und deine hypnotische Kraft ist sehr hilfreich, weißt du. Nun, wenn ... wenn du meinst, es wäre ungefährlich, und dass Providence nicht gekränkt wäre ...“
„Theresa“, stoppte ich sie abrupt, bevor sie bis zu dem Punkt gelangte, wo eine Absage sie verletzt hätte, „lass mich dir gleich sagen, dass ich ein kleines Kind nicht für das passende Subjekt eines hypnotischen Experiments halte. Und ich bin mir sicher, dass ein vernünftiger Mensch wie du mir zustimmen wird, dass so etwas absolut unzulässig ist.“
„Ich erhoffte mir nur eine kleine Empfehlung“, murmelte sie.
„Die besser von ihrer Mutter kommen sollte.“
„Wenn diese Mutter durch ihren Spott nicht bereits ihren Einfluss verloren hätte“, bekannte sie kleinlaut.
„Ja, du hättest sie niemals auslachen dürfen. Ich frage mich nur, warum du es getan hast?“
In ihre Augen trat ein Ausdruck, von dem ich wusste, dass er bei einem hysterischen Charakter stets der Vorbote von Tränen war. Sie schaute sich um, um sich zu versichern, dass niemand zuhören konnte.
„George“, flüsterte sie und in die Dämmerung jenes Septemberabends glitt ein Schatten zwischen uns vorbei, der eine Atmosphäre plötzlichen und unerklärlichen Schauderns zurückließ. „George, ich wünschte - wünschte, ich wäre mir wirklich sicher, dass das alles nur Fantasien sind, ich meine ...“
„Was meinst du?“, fragte ich mit einer Schärfe, die wohl nur mein eigenes Unbehagen verbergen sollte. Aber im selben Moment kam eine Flut von Tränen, die jede vernünftige Erörterung unmöglich machte. Die Angst der Mutter um ihr eigenes Fleisch und Blut brach hervor.
„Ich habe Angst, entsetzliche Angst!“, sagte sie zwischen den Seufzern.
„Ich werde zu ihr in ihr Zimmer gehen und selbst nach ihr sehen“, sagte ich schließlich beruhigend, als der ärgste Sturm sich gelegt hatte. „Du brauchst dich nicht zu beunruhigen. Mit Aileen ist alles in Ordnung. Ich glaube, ich kann dir in der Sache ganz gut weiterhelfen.“
Im Kinderzimmer war Aileen wie gewöhnlich allein. Ich fand sie am offenen Fenster sitzend, ihr gegenüber einen leeren Stuhl. Sie starrte ihn an, starrte hinein, doch es ist nicht leicht zu beschreiben, welche Überzeugung von ihr ausging, dass da jemand auf diesem Stuhl saß und zu ihr sprach. Es war ihr Verhalten, das dies bewirkte. Sie erhob sich rasch und ein wenig erschreckt, als ich eintrat und machte eine angedeutete Geste in Richtung des Stuhls, als wolle sie jemandem die Hand geben, besann sich dann schnell und reagierte mit einem freundlichen kurzen Nicken, als würde sie jemanden verabschieden - oder entlassen. Dann wandte sie sich zu mir um. Es mag unglaublich klingen, aber der Stuhl wirkte mit einem Mal leicht verändert. Er war leer.
„Aileen, was um alles in der Welt machst du da?“
„Onkel, du weißt das doch“, erwiderte sie ohne Zögern.
„Oh, sicher! Ich weiß“, sagte ich, indem ich versuchte, mich in ihre Stimmung hineinzuversetzen, um sie später daraus befreien zu können.
„Ich mache ja genau dasselbe mit den Leuten in meinen eigenen Geschichten. Ich spreche auch mit ihnen ...“
Sie eilte an meine Seite, als ginge es um Leben und Tod.
„Aber antworten sie auch?“
Ich erkannte, wie überwältigend ernst und wichtig diese Frage für sie war. Der Schatten, den meine Cousine unten hervorgerufen hatte, war mir hier herauf gefolgt. Er berührte mich an der Schulter.
„Wenn sie nicht antworten“, sagte ich zu ihr, „sind sie nicht wirklich lebendig und die Geschichte stockt, wenn die Leute sie lesen.“
Sie schaute mich für einen Augenblick sehr genau an, als wir uns gemeinsam aus dem offenen Fenster lehnten und der schwere Duft des portugiesischen Lorbeers vom Rasen unten zu uns aufstieg. Die Nähe des Kindes erzeugte eine merklich eigenartige Stimmung, eine Stimmung, aufgeladen mit Andeutungen, mit undeutlichen Bildern, wie von Dingen, die ich einst gekannt hatte. Ich hatte dergleichen schon oft empfunden und es war mir nicht wirklich angenehm, denn die Bilder schienen in einen emotionalen Rahmen eingebunden zu sein, der sich stets meiner Analyse entzog. Auf unbestimmte Weise begriff ich, was es mit diesem Kind, das seine Mutter so ängstigte, auf sich hatte. Blitzartig überkam mich ein flüchtiges Empfinden, überaus schwierig zu fassen und doch schmerzhaft real, dass sie Momente des Leidens kannte, von denen sie eigentlich noch nichts hätte wissen dürfen. So bizarr und unvernünftig diese Vorstellung schien, war sie doch überzeugend. Und sie rief eine tiefe Zuneigung in mir hervor.
Zweifellos spürte Aileen diese Zuneigung.
„Es ist Philip, der die meiste Zeit mit mir spricht“, sagte sie schließlich aus eigenem Antrieb.
„Und immer, immer erklärt er, aber er kommt nie zum Schluss.“
„Er erklärt was, mein liebes kleines Mondkind?“, drängte ich sanft, indem ich sie bei einem Namen nannte, den sie, als sie noch kleiner war, sehr gern gehabt hatte.
„Warum er nicht rechtzeitig kommen konnte, um mich zu retten, natürlich“, sagte sie. „Weißt du, sie haben ihm beide Hände abgehauen.“
Ich werde nie das Gefühl vergessen, das diese Worte aus dem erdachten Abenteuer eines Kindes in mir hervorriefen, und auch nicht die schmerzliche Gewissheit, die sich mir aufdrängte - die Gewissheit, dass sie wahr seien und nicht bloß Teil einer erfundenen Rettung der „Prinzessin im Turm“. Eine wilde Gedankenflut schien meine Aufmerksamkeit auf meine eigenen beiden Handgelenke zu zwingen, als ob ich die Schmerzen der erwähnten Tat fühlen könne. Bevor ich es verhindern konnte, hatte ich instinktiv beide Hände in meine Jackentaschen gesteckt und so ihrem Blick entzogen.
„Und was erzählt dir Philip sonst noch?“, fragte ich sanft.
Sie errötete. Tränen stiegen ihr in die Augen und zogen sich wieder zurück, um nicht aus ihren sanftfarbenen Nestern zu fließen.
„Dass er mich so schrecklich liebt“, antwortete sie. Und dass er mich bis ganz zum Schluss geliebt hat, und dass er sein ganzes Leben, seit ich fort war und sie ihm die Hände abgehauen haben, nichts Anderes getan hat, als für mich zu beten ... am Ende der Welt, wo er sich versteckt hat ...“
Ich befreite mich mit einiger Anstrengung von der beklemmenden tragischen Stimmung und erkannte, dass ihre Einbildungskraft auf lichtere Pfade gelenkt werden musste, und dass meine Pflicht absoluten Vorrang vor meinem Interesse hatte.
„Du musst Philip dazu bringen, dir auch seine lustigen und fröhlichen Abenteuer zu erzählen“, sagte ich. „Die, die er erlebt hat, als ... weißt du ... seine Hände wieder nachgewachsen waren.“
Der Ausdruck, der nun auf ihr Gesicht trat, ließ mir buchstäblich das Blut gefrieren.
„Das sind doch nur ausgedachte Geschichten“, sagte sie eisig.
„Sie sind nie wieder nachgewachsen. Es gab keine fröhlichen oder lustigen Geschichten.“
Ich wühlte in meinen Gedanken nach einer Eingebung, wie ich ihre Erfindungskraft in zuträglichere Bahnen lenken konnte. Deutlicher als je zuvor fühlte ich, wie tief meine Zuneigung zu diesem seltsamen, vaterlosen Kind war, und dass ich meine ganze Seele dafür gegeben hätte, ihr zu helfen, und sie wieder Fröhlichkeit zu lehren. Es war wirkliche Liebe, die mich überflutete - die tiefer wurzelte, als ich begreifen konnte.
Читать дальше