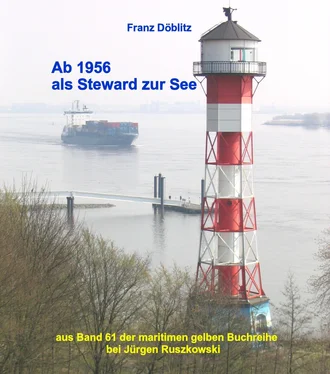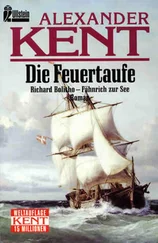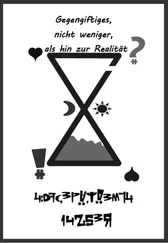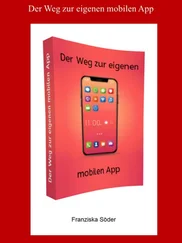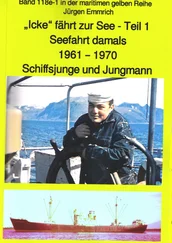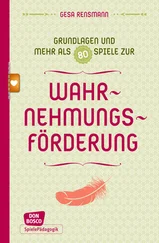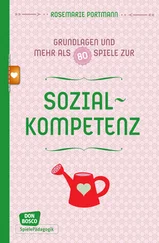Franz Döblitz - Ab 1956 als Steward zur See
Здесь есть возможность читать онлайн «Franz Döblitz - Ab 1956 als Steward zur See» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ab 1956 als Steward zur See
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ab 1956 als Steward zur See: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ab 1956 als Steward zur See»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ab 1956 als Steward zur See — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ab 1956 als Steward zur See», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:

– Mein Vater kehrte nicht aus dem Krieg zurück –
Bald läuteten die Hochzeitsglocken, und es wurde für Nachwuchs gesorgt. Kurz nach der Heirat 1940 wurde mein Vater dann Soldat und wurde zur Verteidigung der Heimat abgeordnet. Mutter war mit mir allein, so sollte es bis auf zwei Kurzurlaube des Vaters denn auch bleiben. Die beiden Schwestern (Herta und Erna) vom Vater lebten bei meiner sehr warmherzigen Oma, obwohl ihr das Schicksal einiges zugemutet hatte. Ihr Mann, mein Opa, wurde bei einem Rettungsversuch verschüttet, eine Tochter starb, der Sohn ist im Krieg gefallen, die andere Tochter war nierenkrank. Mit diesen nicht unerheblichen Sorgen fertig zu werden, war sicher eine große Herausforderung. Dennoch hörte man sie niemals klagen, sie hatte immer den Spruch „...anderen geht es noch viel schlimmer...“ auf den Lippen, und damit war es dann getan. Diese Worte gehen mir bis heute nicht aus dem Kopf.
Die Eltern meiner Mutter schlugen sich mehr schlecht als recht durch die Kriegs und Nachkriegszeit. An dieser Stelle fehlen mir detailliertere Informationen. Nur dass der Großvater nach dem Krieg bei ‚Blohm & Voß’ sein Geld verdiente, ist mir in bester Erinnerung, hat er mir doch immer, wenn ich ihn von der Straßenbahn abholte, eine Scheibe ‚Hasenbrot’ mitgebracht. Es gab für mich zu der Zeit wohl nichts Schöneres, als dieses Hasenbrot. Besonders lecker war es im Sommer, dann war das Brot schon etwas trocken und die darauf befindliche Wurstscheibe schön fettig. Die Großmutter war eine gefühlskalte Person (hat sie ihrer Tochter vererbt) deren für mich eindrucksvollste Gabe das Kochen war, ich würde sagen, sie konnte aus Schei... Gold machen. Es gab nicht viel an Lebensmittel, an Genussmittel war überhaupt nicht zu denken.
Um die Bevölkerung mit den knappen Lebensmitteln gerecht zu versorgen, gab es pro Person bestimmte Mengen, wie Zucker, Mehl, Brot, Fett, Kartoffeln usw. auf ‚Marken’. Vieles, was auf diesen Lebensmittelmarken aufgedruckt war gab es gar nicht, die wurden dann gegen andere getauscht.
Auf den verbotenen Schwarzmärkten gab es manchmal einiges Lebensnotwendige. Schnaps und Zigaretten, ja, wer da rankam, hat auf Umwegen alles bekommen, was er brauchte.
Aber, da die Schwester meiner Großmutter bei ‚Fisch Niebers’ in der Wexstraße ihre Brötchen verdiente und Fisch billig war, gab es Stint und Dorsch des Öfteren. Fisch war jedoch nicht mein Fall, ich aß lieber Maisbrot und dazu ein Kakaogetränk, heißes Wasser, wo man eine Kakaobohne durchgeschossen hatte, so der Volksmund. Der Großvater hingegen hatte ein ‚großes Herz’, er hielt viele Jahre meiner Kinder- und Schulzeit schützend seine Hand über mich. Am liebsten hörte ich ihm zu, wenn er von Schiffen und dem Hamburger Hafen erzählte.
Nach der Ausbombung, Hamburg war nur noch ein einziger Trümmerhaufen, waren wir fast bis zum Kriegsende bei Verwandten in Lindow / Mark untergebracht. Weil die russische Rote Armee immer näher an Berlin heranrückte, sollten meine Mutter und ich wieder nach Hamburg zurück kommen.
Großvater hatte dafür Sorge getragen, dass meine Mutter eine Parzelle neben der von ihm gepachteten bekam. Hier hatte er ein schuppenähnliches Behelfsholzhaus aufgestellt mit einem Kanonenofen als Heizung. Wir kamen also wieder zurück und bezogen diese Unterkunft.
Auf Dauer aber war es wohl ein zu kleiner ‚Palast’, und so sollte ein Behelfsheim aus Steinen gebaut werden. Platz dafür war ja vorhanden auf der 600 Quadratmeter großen Parzelle.
Steine – woher nehmen? Kaufen, wenn überhaupt, wo? Die Lösung war ja so einfach – und wie so viele andere Bauherren ging es in die Trümmer, um Steine zu sammeln. Diese Steine wurden mittels Maurerhammer von Zement und Mörtel befreit (geputzt) und per Boller- oder Blockwagen zum etwa fünf Kilometer entfernten Bauplatz gebracht. Dieser befand sich in Hamburg 34 – Kleingartenverein 142 – Rotkehlchenweg, Parzelle Nr. 370. Es waren keine Kleingartenvereine, wie man sie heute kennt, es waren einfach Behelfsheim-Siedlungen, um die vielen Ausgebombten notdürftig und hauptsächlich durch Eigenhilfe unterzubringen. ‚Leybuden’, benannt nach Dr. Robert Ley (Reichswohnungs- Kommissar) waren nicht gerade komfortable Fertighäuser aus Holz, sie boten aber immerhin ein Dach über dem Kopf. Die Eigenhilfe wurde in einem besonderen Fall sehr deutlich, das ‚Heim’ bestand aus zwei nebeneinander gestellten Bahnwaggons, aus denen man die Sitzbänke zum großen Teil entfernt hatte, um Wohn,- und Schlafräume zu schaffen. Auch in notdürftig hergestellten großen ‚Nissenhütten’ (halbrunde Wellblechbauten) mussten die Menschen längere Zeit unter minimalstem Komfort aushalten.
Woran ich mich im Zusammenhang mit dem Steine sammeln des Öfteren erinnere – einmal waren mehr Steine geputzt, als transportiert werden konnten, sie wurden gestapelt – und mich Fünfjährigen stellte man als Wachposten ab. In den Trümmern gab es aber sooo viel zu entdecken, teilweise waren Kellerräume zugänglich, und da zu stöbern, war einfach zu schön. Jedenfalls, als Mutter und Großvater zum Abholen der Steine kamen – waren sie weg – geklaut, es gab eben noch mehr Leute, die ein Wohnproblem hatten und selber bauen wollten. Mutter war derart erbost, dass sie mich am liebsten windelweich gehauen hätte, doch hier kam mal wieder – die schützende Hand! Großvater nahm mich an die Seite, strich mir über den Kopf und sagte nur: „Komm, wir putzen neue.“ Der Steineklau war aus heutiger Sicht mehr als verständlich, denn das Gebiet der Kleingartenvereine, es gab ja deren viele, zog sich von der Horner Landstraße zwischen Schurzallee und Bauerbergweg über 700.000 Quadratmeter bis ans Ufer der Bille hin, unterteilt in überwiegend 600 Quadratmeter große Parzellen – ein riesiges Gebiet. So wurde also langsam, aber sicher, ein Behelfsheim von ca. 50 Quadratmetern geschaffen, mit einem Schlafraum, einer Wohnküche und einem kleinen Eingangsflur. Später wurde noch, nicht ganz legal, ein Wohnraum angebaut. Hinter dem Bau wurde in einem Bretterverschlag ein damals übliches Plumpsklo mit ‚Goldeimer’ installiert. Der Goldeimer war ein ausgedienter Waschkessel von ungefähr 50 Liter Fassungsvermögen, und der Inhalt, wenn der Eimer voll war, wurde im Garten untergegraben, ein angeblicher Spitzendünger für Kohl, Kartoffel und Co. Die Wasserversorgung war durch eine Pumpe für 24 Parzellen gesichert. Der Transport des Wassers wurde mit Eimern bewerkstelligt.
Da die Witwen- und Waisenrente hinten und vorne nicht reichte, musste Mutter Arbeit suchen bei der Vermittlungsstelle des Arbeitsamtes Hamburg am Besenbinderhof. Da nicht gleich etwas Passendes für ungelernte Frauen greifbar war, musste sie zweimal die Woche zum ‚Stempeln’ kommen. Es gab Angebote in der Fischverarbeitung, das war aber nichts für Mutter, und so nahm sie bei ‚Tretorn’ einer Schuhfabrik in Barmbek eine Arbeit auf. Es wurden bei Tretorn Gummistiefel und Turnschuhe mittels eines Klebers gefertigt. Nach diesem Kleber roch sie noch sehr stark, wenn sie nach Hause kam. Gesundheitsschutz war seinerzeit ein Wort aus einer Fremdsprache.
Wir Kinder spielten in den Wegen des Kleingartenvereins ‚Kippel-Kappel’, ‚Meiersche Brücke’, ‚Hinkebock’ und oftmals selbst ausgedachte Spiele. Unsere Fantasie trieb die tollsten Früchte. Spielzeug kaufen? Wovon? Also selber basteln oder vom Opa zu Weihnachten wünschen.
Höhepunkt der Woche war immer am Sonntag um 13 Uhr im ‚Tivoli’ oder ‚Deli’-Kino der Kinderfilm. Das Geld (50 Pfennige) für die Kinokarte verdienten wir uns mit Milch holen für die Nachbarn – der Milchmann hatte sonntags von 8 bis 10 Uhr geöffnet – oder mit Schrott sammeln. Taschengeld gab es, wenn überhaupt, nur spärlich und unregelmäßig. Zeitungen austragen war auch ein Gelderwerb. Es gab für eine Zeitung im Monat – 40 Pfennig für 30 Zeitungen – den Betrag von 12 DM, doch solche Gelegenheiten blieben für die meisten von uns nur ein Traum.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ab 1956 als Steward zur See»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ab 1956 als Steward zur See» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ab 1956 als Steward zur See» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.