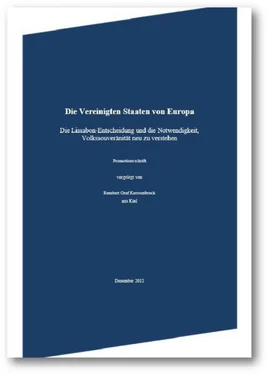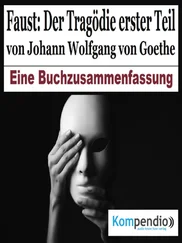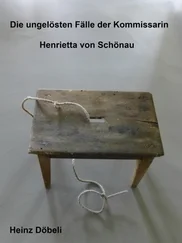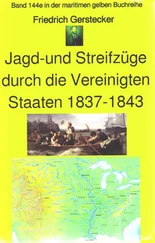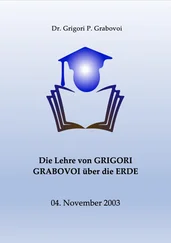Anschließend erklärt es das bereits zuvor genannte Konzept der Ultra-vires-Kontrolle: Wenn Rechtsschutz auf Unionsebene nicht zu erlangen ist, prüft das BVerfG, ob Rechtsakte der europäischen Organe und Einrichtungen sich unter Wahrung des gemeinschafts- und unionsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips in den Grenzen der ihnen im Wege der begrenzten Einzelermächtigung eingeräumten Hoheitsrechte halten.
Diese zwar voneinander zu unterscheidenden, aber miteinander eng verbundenen Kontroll-befugnisse, abgeleitet aus dem allgemeinen Verständnis der staatlichen Souveränität und seine Applikation auf die Bundesrepublik Deutschland, scheinen auf den ersten Blick eine bloße Fortführung der in den vorigen Jahrzehnten zu europäischen Änderungsverträgen er-gangenen Rechtsprechung zu sein. Jedoch wurde der mit dem Maastricht-Urteil geschaffene Begriff des Kooperationsverhältnisses 162nicht erneut verwandt. Vielmehr wurden die beiden erwähnten Kontrollmechanismen in den Vordergrund gerückt. Die Ultra-vires-Kontrolle sei demnach ein Sicherungssystem, das der Identitätskontrolle vorgeschaltet sei: Zunächst wird mit ihrer Hilfe festgestellt, ob die Organe der EU im Rahmen ihrer Befugnisse gehandelt ha-ben und damit nicht auf nationale (souveräne) Kompetenzen zurückgegriffen haben. Die Identitätskontrolle komplementiere dann diese begonnene Kontrolle: Auch für den Ausnah-mefall, dass die EU innerhalb ihrer Kompetenzen gehandelt habe, aber dennoch kernspezifi-sche Bereiche des Grundgesetzes unzulässig verletzt habe, behält sich das Gericht einen Kon-trollvorbehalt vor. Das Gericht nimmt damit an, in Ausnahmefällen 163die Reichweite des Art. 4 Abs. 2 EUV bestimmen zu müssen, in dem die Pflicht zur Achtung der nationalen Identität geregelt sei. Bemerkenswert ist, dass sich das Gericht eine Ultra-vires-Kontrolle schon bei „ersichtlichen“ Grenzüberschr eitungen 164vorbehalten hat, und nicht, wie zu erwarten, bei „offenkundigen“ oder „evidenten“. 165Man könnte die Ultra-vires-Kontrolle deswegen als eine Erweiterung der bisher vom Bundesverfassungsgericht beanspruchten Kontrollbefug-nisse verstehen, da aus dem Wort „ersichtlich“ abgeleitet werden könnte, dass die Anforde-rungen an das Eingreifen einer Ultra-Vires-Kontrolle abgesenkt wurden. Aus den oben zitierten Passagen lässt sich auch der Zusammenhang mit dem Prinzip der be-grenzten Einzelermächtigung herstellen. Das Bundesverfassungsgericht befürchtete, dass die Europäische Union trotz der begrenzten Zuteilung von Zuständigkeiten ihre Kompetenzen überschreiten oder die nationalen Identitäten verletzen könnte, und wollte durch die Dro-hung mit der eigenen Kontrolle einer etwaigen Überschreitung derselben einem solchen Vorgang vorbeugen. Dies bedingt aber gleichzeitig, dass der EuGH seiner Rolle als eigentliche Kontrollinstanz der Unionsorgane nicht vollständig gerecht würde, was das Bundesverfas-sungsgericht zumindest für möglich hielt. Bezugspunkt dieser vom Gericht aufgestellten Grundsätze bleibt die (Volks-)Souveränität der Bundesrepublik, was das Gericht missver-ständlich ausdrückt:
Es ist eine Konsequenz der fortbestehenden Souveränität der Mitgliedstaaten, dass jeden-falls dann, wenn es ersichtlich am konstitutiven Rechtsanwendungsbefehl mangelt, die Un-anwendbarkeit eines solchen Rechtsakts für Deutschland vom BVerfG festgestellt wird. 166
Mit dem Beschluss vom 6. Juli 2010 170äußerte sich das Bundesverfassungsgericht erneut zur Frage der Ultra-vires-Kontrolle. Es bemühte s ich, das Tatbestandsmerkmal der „Ersichtlich-keit“ zu konkretisieren:
Eine Ultra-vires-Kontrolle durch das BVerfG kommt darüber hinaus nur in Betracht, wenn er-sichtlich ist, dass Handlungen der europäischen Organe und Einrichtungen außerhalb der übertragenen Kompetenzen ergangen sind. Ersichtlich ist ein Verstoß gegen das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung nur dann, wenn die europäischen Organe und Einrichtungen die Grenzen ihrer Kompetenzen in einer das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung spe-zifisch verletzenden Art überschritten haben (Art. 23 I GG), der Kompetenzverstoß mit ande-ren Worten hinreichend qualifiziert ist. Dies bedeutet, dass das kompetenzwidrige Handeln der Unionsgewalt offensichtlich ist und der angegriffene Akt im Kompetenzgefüge zwischen Mitgliedstaaten und Union im Hinblick auf das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und die rechtsstaatliche Gesetzesbindung erheblich ins Gewicht fällt. 171 176Diese begründete Abweichung von der Lissabon-Entscheidung hinsichtlich der Ultra-vires-Kon-trolle 177ändert aber nichts an den vom Gericht gemachten Aussagen zum Demokratieprinzip und zur staatlichen Souveränität. Aus diesem Grunde muss das Urteil zum Vertrag von Lissa-bon auch weiterhin maßgeblicher Untersuchungsschwerpunkt hinsichtlich dieser Fragestel-lung bleiben.
b) Voraussetzungen für die Mittel zur Bewahrung des Grundgeset-zes
Die oben vom Gericht als unumgänglich dargestellten Mittel der begrenzten Einzelermächti-gung, der Identitäts- und der Ultra-vires-Kontrolle zur Bewahrung der Demokratie und der Souveränität sollen erst in bestimmten Fällen zur Anwendung kommen. Zunächst formu-lierte das Gericht sehr weiche Kriterien, die nicht auf einen Zusammenhang mit den unver-äußerlichen Grundsätzen des Art. 79 Abs. 3 GG hindeuteten: Die europäische Vereinigung auf der Grundlage einer Vertragsunion souveräner Staaten darf allerdings nicht so verwirklicht werden, dass in den Mitgliedstaaten kein ausreichender Raum zur politischen Gestaltung der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebensver-hältnisse mehr bleibt. Vor allem im Bereich des von den Grundrechten geschützten privaten Raumes des Bürgers. 178
Die Formulierung „ausreichender Raum zur politischen Gestaltung“ lässt viele Fragen offen. Damit sprach es mit anderen Worten erneut die unveräußerliche Souveränität an, hier als Volkssouveränität bzw. Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes zu verstehen, da die Bezugspunkte der gerichtlichen Ausführungen das Volk und das Demokratiegebot sind. Mit dem letzten Satz machte das Gericht klar, dass es sich außerdem nicht nur als Hüter der Ver-fassung sieht, sondern auch als Beschützer des deutschen Bürgers und seiner direkten Rechte. Dabei ging es davon aus, dass es diese Rolle am besten ausfüllen könne, wenn es zugunsten der staatlichen Souveränität Deutschlands bzw. der deutschen Volkssouveränität ein ausreichendes Maß an Demokratie gewährleiste. Die vom Grundgesetz sogar erstrebte Integration in die EU solle daran nichts ändern:
Das Grundgesetz erstrebt die Einfügung Deutschlands in die Rechtsgemeinschaft friedlicher und freiheitlicher Staaten. Es verzichtet aber nicht auf die in dem letzten Wort der deut-schen Verfassung liegende Souveränität als Recht eines Volkes, über die grundlegenden Fra-gen der eigenen Identität konstitutiv zu entscheiden. Insofern widerspricht es nicht dem Ziel der Völkerrechtsfreundlichkeit, wenn der Gesetzgeber ausnahmsweise Völkervertragsrecht – allerdings unter Inkaufnahme entsprechender Konsequenzen im Staatenverkehr – nicht be-achtet, sofern nur auf diese Weise ein Verstoß gegen tragende Grundsätze der Verfassung abzuwenden ist. 179
Im Folgenden erklärte das Gericht, dass es dies nicht als Aufruf zum Bruch mit Völkerver-tragsrecht begreife 180, sondern als Ausdruck des anerkannten Ausnahmetatbestandes „ordre public“ verstehe und zusätzlich von „nicht strikt hierarchisch gegliederten politischen Ord-nungszusammenhängen“ ausgehe. 181Man wird somit der Einschätzung Recht geben müs-sen, dass damit auch an dieser Stelle das Staatsverständnis des Bundesverfassungsgerichtes, eingebettet in der Völkerrecht, ausgedrückt wird. 182Es klassifizierte ausschließlich die natio-nalen Verfassungen als Staatsrecht, und die Unionsverträge hingegen als einfaches Völker-vertragsrecht, das dem nationalen Staatsrecht im Konfliktfall unterzuordnen sei. Damit wird das Bundesverfassungsgericht aber der eingangs dargestellten Supranationalität nicht ge-recht.
Читать дальше