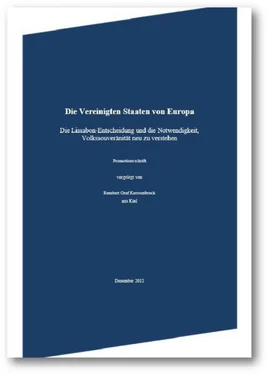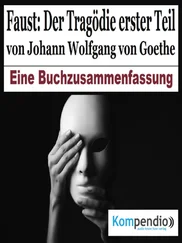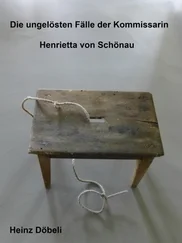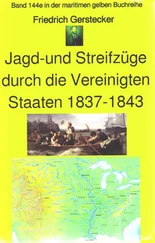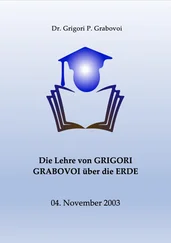C. Ausgangspunkt: Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Vertrag von Lissabon
Ausgangspunkt der Arbeit ist die Überprüfung des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes zum Vertrag von Lissabon. Dabei werden die Aussagen zu Souveränität und Demokratie als Bestandteil der von Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Grundsätze in den Fokus gerückt. Auf diese Weise soll ein möglichst klares Bild vom Verständnis des Bundesverfassungsgerichtes ermöglicht werden, das zwar den Vertrag von Lissabon für noch verfassungsgemäß erachtet, aber dennoch einen europäischen Bundesstaat für unvereinbar mit dem jetzigen Grundge-setz hält. Dies soll ins Verhältnis zu früheren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerich-tes gesetzt werden, um deutlich zu machen, dass dieses Verständnis in der logischen Folge früherer Entscheidungen steht. Die Ergebnisse dieses Abschnittes sollen dann als Prüfungs-maßstab für die historische Untersuchung von Demokratie und Souveränität dienen. Auch soll die Auslegung des Bundesverfassungsgerichtes ins Verhältnis zu einem anderen Ausle-gungsergebnis gesetzt werden.
I. Die Lissabon-Entscheidung
1. Das Verständnis des Bundesverfassungsgerichtes von Demokra-tie und Souveränität
Das Grundgesetz ermächtigt die für Deutschland handelnden Organe nicht, durch einen Ein-tritt in einen Bundesstaat das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes in Gestalt der völkerrechtlichen Souveränität Deutschlands aufzugeben. 117
Schon zu Beginn seines Urteils drückte das Bundesverfassungsgericht das grundsätzliche Ver-ständnis von der Beziehung des Grundgesetzes zu den europäischen Einigungsverträgen aus. Demnach sei weder die Regierung noch der verfassungsändernde Gesetzgeber, also eine Zweidrittelmehrheit des Bundestages zusammen mit einer Zweidrittelmehrheit des Bundes-rates, imstande, die von Art. 79 Abs. 3 iVm. Art. 20 I GG verbürgte staatliche und völker-rechtliche Souveränität abzugeben. 118Das Gericht bezog sich dabei aber nicht explizit auf die staatliche Souveränität, sondern auf das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes. Im darauf folgenden Satz zog das Gericht die Konsequenz aus dieser Aussage: Dieser Schritt ist wegen der mit ihm verbundenen unwiderruflichen Souveränitätsübertra-gung auf ein neues Legitimationssubjekt allein dem unmittelbar erklärten Willen des Deut-schen Volkes vorbehalten. 119
An anderer Stelle stellte es fest:
Das demokratische Prinzip ist nicht abwägungsfähig, es ist unantastbar. […] Mit der sog e-nannten Ewigkeitsgarantie wird die Verfügung über die Identität der freiheitlichen Verfas-sungsordnung selbst dem verfassungsändernden Gesetzgeber aus der Hand genommen. Das Grundgesetz setzt damit die souveräne Staatlichkeit Deutschlands nicht nur voraus, sondern garantiert sie auch. 120
Unter dem Eindruck der ersten Aussage, dass die völkerrechtliche Souveränität Deutschlands verbürgt bleibe, muss man die beiden zuletzt genannten Aussagen lesen und die folgenden Schlüsse ziehen:
Erstens gehört laut Bundesverfassungsgericht nicht nur die staatliche Souveränität, auch wenn sie nicht ausdrücklich im Grundgesetz zu finden ist, sondern auch das demokratische Prinzip bzw. die Forderung nach Demokratie zu den von Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Ver-fassungsprinzipien, die Bestandteil der deutschen Verfassungsidentität seien und damit nicht aufgegeben werden könnten. 121Bemerkenswert ist aber vor allem der zweite Aspekt: Das demokratische Prinzip und die staatliche Souveränität stehen aus Sicht des Bundesverfas-sungsgerichtes in einer Art Symbiose zueinander, weil sie sich gegenseitig bedingten. 122Dies deutet zumindest die inhaltliche Verknüpfung beider Prinzipien an. Denn beide werden in einen unmittelbaren Zusammenhang gebracht, indem bei der Erklärung des einen zugleich auf das jeweils andere Bezug genommen wird. Warum das Bundesverfassungsgericht diese beiden Grundsätze als so eng miteinander verknüpft betrachtete, wird am deutlichsten im Leitsatz 1 angesprochen:
Das Grundgesetz ermächtigt mit Art. 23 GG zur Beteiligung und Entwicklung einer als Staa-tenverbund konzipierten Europäischen Union. Der Begriff des Verbundes erfasst eine enge, auf Dauer angelegte Verbindung souverän bleibender Staaten, die auf vertraglicher Grund-lage öffentliche Gewalt ausübt, deren Grundordnung jedoch allein der Verfügung der Mit-gliedstaaten unterliegt und in der die Völker – das heißt die staatsangehörigen Bürger – der Mitgliedstaaten die Subjekte demokratischer Legitimation bleiben. 123
Die vom Demokratieprinzip im geltenden Verfassungssystem geforderte Wahrung der Sou-veränität […]. 128
Wegen der starken Betonung des Demokratieprinzips tritt jedoch die Souveränität als ein zentraler Aspekt des Grundgesetzes in den Hintergrund. So betonte das Gericht in seinem Urteil beispielsweise die elektorale Demokratie 129und nahm an, dass die modernen Territo-rialstaaten als Modell einer elektoralen Demokratie angesehen werden könnten. 130Elek-torale Demokratie wird dabei vom Bundesverfassungsgericht verstanden als ein Herrschafts-verband, dessen Organe durch wiederkehrende Mehrheitsentscheidungen der Bürger gebil-det werden und die sich neben einem Dualismus von Regierung und Opposition gegenüber einer beobachtenden und kontrollierenden Öffentlichkeit verantworten müssen. 131Hinzu kommt, dass das Bundesverfassungsgericht sich in besonderem Umfang mit dem Demokra-tieprinzip auseinandersetzte und dessen Bestandteile formulierte, die zur unveräußerlichen Identität der Verfassung gehörten und nicht derart umfänglich berührt werden dürften, dass eine Entstaatlichung möglich werde. 132So führte es aus:
Für die vom Grundgesetz verfasste Staatsordnung ist eine durch Wahlen und Abstimmungen betätigte Selbstbestimmung des Volkes nach dem Mehrheitsprinzip konstitutiv. 133
[d]iese zentrale Demokratieanforderung […] auf der Grundlage verschiedener Modelle erfüllt werden [kann]. 135
Das Bundesverfassungsgericht machte bei seiner Hervorhebung der staatlichen Souveräni-tät/Volkssouveränität als Voraussetzung für das Demokratieprinzip deutlich, dass es ihr Ver-ständnis als eine absolute Notwendigkeit zur Bewahrung der deutschen Verfassungsidentität sehe und sich davor bewahren wollte, aus bloßem „staatsrechtlichen Traditionalismus“ an den dargestellten Vorstellungen festzuhalten. 136Dabei bezog es sich auch ausdrücklich auf die Souveränität und hob die dem Grundgesetz inhärente moderne Vorstellung von Souverä-nität hervor:
In den Zielen der Präambel wird dieses Souveränitätsverständnis sichtbar. Das Grundgesetz löst sich von einer selbstgenügsamen und selbstherrlichen Vorstellung souveräner Staatlich-keit und kehrt zu einer Sicht auf die Einzelstaatsgewalt zurück, die Souveränität als völker-rechtlich geordnete und gebundene Freiheit auffasst. Es bricht mit allen Formen des politi-schen Machiavellismus und einer rigiden Souveränitätsvorstellung, die noch bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Recht zur Kriegsführung für ein selbstverständliches Recht des sou-veränen Staates hielt. 137
Zwar bekundet das Gericht an dieser Stelle, dass es sich von einer veralteten Vorstellung der Souveränität lösen will, doch blieb es, wie noch zu zeigen sein wird, in den bisherigen Vor-stellungen von der Einzelstaatsgewalt verhaftet, die Ausdruck der Souveränität des Volkes ist, nämlich die Verfügungsgewalt,
über die grundlegenden Fragen der eigenen Identität konstitutiv zu entscheiden. 138 139
Das Recht der Bürger, in Freiheit und Gleichheit durch Wahlen und Abstimmungen die öf-fentliche Gewalt personell und sachlich zu bestimmen, ist der elementare Bestandteil des Demokratieprinzips. Der Anspruch auf freie und gleiche Teilhabe an der öffentlichen Gewalt ist in der Würde des Menschen verankert. 140
Читать дальше