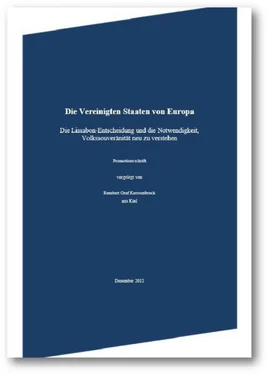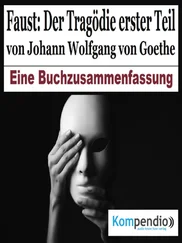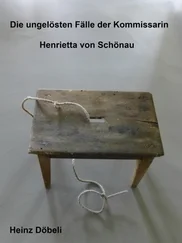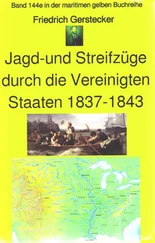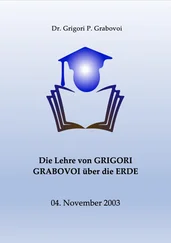B. Voruntersuchung: Bundesstaat als Organisationsform in Abgren-zung zum Staatenbund
Einführend soll das Modell des Bundesstaates – in Abgrenzung zum Staatenbund – erläutert werden und dies ins Verhältnis zum aktuellen Zustand der EU gesetzt werden, um eine Grundlage für die weitere Diskussion zu schaffen, denn diese Arbeit beschäftigt sich unmit-telbar mit der Möglichkeit, dass sich die Europäische Union zu einem Gesamtbundesstaat entwickelt. Nicht zuletzt ist die Darstellung der alternativen Organisation – des Staatenbun-des – essenziell für das Verständnis des Prinzips des Bundesstaates, weil die Europäische Union in ihrem jetzigen Zustand unterschiedliche Elemente des Staatenbundes und des Bun-desstaates miteinander vereint. Hinzu kommt, dass die Supranationalität als staatsrechtliche Struktur der Europäischen Union eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Integrati-onsoffenheit des deutschen Grundgesetzes spielt. Damit wird auch eine gesonderte Untersu-chung dieser schwer einzuordnenden Organisationsform notwendig, um die spätere Kritik hinreichend zu verstehen.
I. Die Idee und die Charakteristika des Staatenbundes / der in-ternationalen Organisation
Das Konzept des Zusammenschlusses von politischen Kräften ist alt. Als wohl ältester und bekanntester Vorläufer eines international organisierten Zusammenschlusses gilt die Am-phiktyonie, ein Bund der griechischen Stadtstaaten, dessen Aufgabe es war, mithilfe seiner Armee Heiligtümer zu schützen. 15Von der heutigen Lehre des traditionellen Staatenbundes ausgehend, ist dieser nicht auf der Ebene des Staatsrechtes angesiedelt, sondern vielmehr eine völkerrechtlich-diplomatische Staatenverbindung. Andere Beispiele hierfür sind die un-ter den „Articles of Confederation“ gegründeten Konföderierten Staaten von Amerika 16, die sich kurz darauf zum heutigen Bundesstaat weiterentwickelten, oder der Deutsche Bund von
1815. 17Davon kaum zu unterscheiden sind die modernen internationalen Organisationen, bei denen es vorwiegend um die internationale Kooperation zwischen Staaten geht. Im Ge-gensatz zu den Staatenbünden beschränkt sich diese meist auf einzelne Bereiche. 18Bei den früher häufig auftretenden Staatenbünden ging es primär um die Koordination. 19Die frühe-ren Zusammenschlüsse existierten also weniger zum Austausch politischer Positionen als Grundlage gemeinsamen Handelns, sondern vielmehr zur Absprache bei organisatorischen Fragen.
Gleichwohl bestehen Staatenbünde wie auch internationale Organisationen aus zwei oder mehr Völkerrechtssubjekten, die sich mittels eines völkerrechtlichen Vertrages bzw. eines Gründungsaktes 20darauf geeinigt haben, wesentliche staatliche Aufgaben einem übergeord-neten Verbund zu übertragen. 21Meist handelt es sich dabei um den Schutz des Territoriums des Bundes und der Unabhängigkeit seiner Mitglieder nach innen, wobei die heutigen inter-nationalen Organisationen sich auch anderen Aufgaben gewidmet haben. 22Sie können be-schränkte Völkerrechtssubjektivität besitzen und Aufgaben mittels eigener Organe wahrneh-men, ohne dabei eine übergeordnete Souveränität zu besitzen. 23Anders als Staaten sind sie als „offene Verbände“ zu verstehen, in denen die Mitglieder zwar sichtbar bleiben, die aber als eigenständige Rechtspersonen von diesen unterscheidbar agieren. 24So wurde zum Bei-spiel die GuS, die „Gemeinschaft unabhängiger Staaten“, als Staatenbund aufgefasst und ist heute als internationale Organisation anerkannt 25, die durch Zusammenschluss von elf Uni-onsrepubliken der ehemaligen Sowjetunion gegründet wurde. Von einigen Völkerrechtlern wird die Völkerrechtssubjektivität sogar als Voraussetzung genannt, von anderen 26jedoch als Merkmal einer bundesstaatlichen Struktur betrachtet. Diese Unsicherheit in den konstitu-tiven Merkmalen ist in erster Linie auf die unterschiedlichen Erscheinungsformen zurückzu-führen. 27
Letztlich ist die Entscheidung dieser Frage aber ohne Bedeutung, da die souveränen Staaten nach wie vor die maßgeblichen Akteure im modernen Völkerrecht sind und als solche selbst darüber bestimmen, welche anderen – von ihnen abhängige – Völkerrechtssubjekte es im Völkerrecht gibt. 28Die Mitgliedstaaten behalten also parallel zur vertraglich vereinbarten Völkerrechtssubjektivität ihre eigene Subjektivität zusammen mit ihrer ungeteilten Souverä-nität. 29Diese ungebrochene Inhaberschaft der Souveränität ist das maßgebliche Kriterium für die Beantwortung der Frage, was den Staatenbund bzw. die internationale Organisation vom Bundesstaat unterscheidet. 30Der Begriff der Souveränität beinhaltet dabei die äußere Souveränität, auch Völkerrechtsunmittelbarkeit genannt, und die innere Souveränität, die mit Verfassungsautonomie gleichgesetzt wird. 31Mit anderen Worten: Souveränität ist die Unabhängigkeit eines Staates von allen anderen Staaten nach innen und nach außen. Damit bedarf die Änderung völkerrechtlicher Verträge 32, welche die Rechtsposition der Mitglied-staaten antastet, der Zustimmung aller Mitgliedstaaten. 33Hinzu kommt, dass der Staaten-bund grundsätzlich nicht über eigene Hoheitsbefugnisse gegenüber den Bewohnern der Mit-gliedstaaten verfügt, sondern seine natürlichen und juristischen Personen nur mittels des Umweges über die Mitgliedstaaten verpflichten kann. Die Staaten bleiben also die unmittel-baren Adressaten. 34
II. Die Idee des Bundesstaates
Die Idee des Bundesstaates entstand wohl schon 1661, als das Heilige Römische Reich Deut-scher Nation erstmals als ein gemeinsames Staatswesen bezeichnet wurde. 35Erneut be-schrieben wurde es dann als ein für die Verwaltung zu vermeidendes, aber für die Regierung wünschenswertes Konzept. 36Zur Darstellung der Staatenverbindung in Gestalt eines Bundes-staates bedarf es zunächst der Klärung der in diesem Zusammenhang häufig doppeldeutigen und verschieden verstandenen Termini.
Als Staat beschrieben werden sowohl der Gesamtstaat als auch die einzelnen Gliedstaaten, aus denen sich der Gesamtstaat zusammensetzt.
Gliedstaat bezeichnet eine Rechtsordnung, deren Gesetze nur auf einen räumlich begrenz-ten Teil des Gesamtstaatsgebietes Anwendung finden. 37Demgegenüber erfasst der Begriff des Bundesstaates eine Rechtsordnung, die sich auf das ganze Bundesgebiet erstreckt, aber nicht alle Kompetenzen beinhaltet. 38Der Gesamtstaat begründet eine Rechtsordnung, von welcher der Bundesstaat sowie die einzelnen Gliedstaaten abhängig sind 39, und bezeichnet dabei die Bundesgesamtheit, die Inhaberin der inneren und äußeren Souveränität ist, den Staat darstellt, und aus sich heraus völkerrechtsunmittelbar am Rechtsverkehr teilnehmen kann. 40
Der Bundesstaat wird als Staatsorganisationsform, anders als der Staatenbund, staatsrecht-lich begründet. 41Diese Gründung erfolgt durch ein verfassungsgebendes Organ, zum Beispiel durch eine Nationalversammlung oder einen nationalen Verfassungskonvent, der sich vom Willen des ganzen Volkes – des zukünftigen Staatsvolkes – ableitet. 42So verfasste der Parla-mentarische Rat als Vertreter des Deutschen Volkes das Grundgesetz. Dieses stellt die Ver-fassung der Bundesrepublik Deutschland dar, die sich aus heute 16 Gliedstaaten – Bundes-ländern – zusammensetzt. Der Bundesstaat kommt also nicht vertraglich zustande, sondern wird durch die verfassungsgebende Gewalt, in einer Demokratie ist es das Volk, staatsrecht-lich geschaffen. 43Der Bund erfasst jeden Gliedstaat in seiner Gesamtexistenz und fügt ihn als Ganzes in eine politisch existierende Verbindung ein. 44
Früher wurde als eine der wesentlichsten Veränderungen des Status der Gliedstaaten der Verzicht auf Selbsthilfe begriffen. 45Dies mag daran liegen, dass in der frühen Staats- und Völkerrechtslehre das Selbstverteidigungsrecht als besonderer Ausdruck der Souveränität angesehen wurde. Heute geht das Verständnis von Bundesstaat darüber hinaus: Die Frage nach der Souveränität, der suprema potestas 46, ist maßgeblich für die Unterschei-dung zwischen Staatenbund bzw. internationaler Organisation auf der einen Seite und Bun-desstaat auf der anderen Seite. Beim Bundesstaat liegt diese bei der föderalen Gesamtin-stanz, die letztverbindlich über existenzielle Fragen entscheidet. 47– insbesondere, wenn sich der Bundesgesamtstaat historisch aus einem Zusammenschluss mehrerer Einzelstaaten ergibt. 50Nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, sondern auch die Vereinigten Staaten von Amerika sind so aus einst souveränen Einzelstaaten hervorge-gangen.
Читать дальше