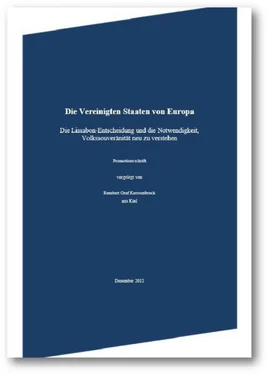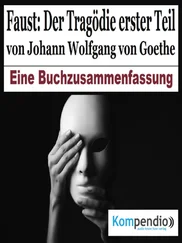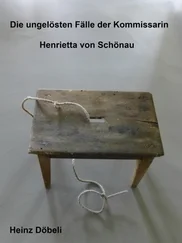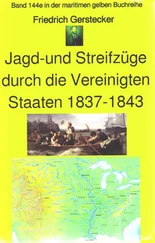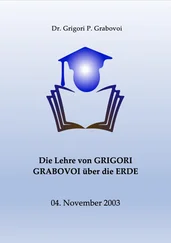Aus diesem Verständnis des Gerichtes lässt sich eine doppelte Bestandskraft für das Demo-kratieprinzip ableiten. Nicht nur ist das Demokratieprinzip über Art. 79 Abs. 3 GG geschützt, sondern auch bereits über Art. 1 GG selbst, denn die Menschenwürde kann nach de r „Ob-jektformel“ 141nicht Gegenstand von Abwägungs- oder Verfügungsprozessen sein. 142Diese zweite Herleitung verdeutlicht, dass nach dem Verständnis des Gerichtes das Demokratie-prinzip eine unverzichtbare Grundlage des Grundgesetzes ist und in keinem Fall eine zu starke Einschränkung erfahren dürfe. In dieser Passage wird aber nicht nur auf die wesentli-chen Ausprägungen des Demokratiegebotes Bezug genommen, und diese werden nicht nur an Art. 1 GG festgemacht; wie schon zuvor dargestellt, wird hier auch auf das Selbstbestim-mungsrecht des deutschen Volkes und damit auf seine Souveränität Bezug genommen. Das Gericht leitete sowohl Souveränität, in der volksbezogenen Variante, als auch Demokra-tie aus der Würde des Menschen ab, also sowohl individualistisch als auch kollektiv bzw. staatszentriert. 143Die besondere Betonung und Auseinandersetzung mit der Demokratie so-wie die umfangreiche Untersuchung der Frage, ob denn bereits mit dem Vertrag von Lissa-bon eine Verletzung derselben vorliege, können aber verschleiern, dass alle diese Bereiche weniger das Demokratieprinzip als vielmehr den Anspruch nach absoluter und ungeteilter Souveränität tangieren. 144Ob dabei auf die staatliche Souveränität oder die Volkssouveräni-tät abgezielt wird, kann an dieser Stelle offengelassen werden. 145Es ging dem Bundesverfas-sungsgericht weniger um die Probleme der Demokratie an sich, sondern vielmehr um die de-mokratische Legitimation, um die Unabhängigkeit des deutschen Volkes, also im Kern um die Volkssouveränität als Grundlage für die staatliche Souveränität. 146Es bezog sich bei seinen Ausführungen über Demokratie regelmäßig auf das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes und seine Souveränität. Derartiges konnte auch schon in der Entscheidung zum Ver-trag von Maastricht festgestellt werden. 147Man kann also das Urteil dahin gehend interpre-tieren, dass das Grundgesetz aufgrund seiner Verbürgung der deutschen Volkssouveränität – als Grundlage der staatlichen Souveränität und die Demokratie verbürgend – die Integration in einen europäischen Bundesstaat für nicht zulässig erachtet.
a) Instrumente zur Bewahrung von Demokratie in staatlicher Sou-veränität
aa) Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung In seinem Urteil zum Vertrag von Lissabon wollte das Gericht auf die Gefahr hinweisen, dass die Union sich politisch verselbstständigen könnte, und erklärte hierzu, dass zum Schutz da-vor nicht nur ein Austrittsrecht 148aus der Union als letztes Mittel notwendig sei 149, sondern es hielt auch weiterhin am Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung fest: Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung ist deshalb nicht nur ein europarechtlicher Grundsatz, sondern nimmt […] mitgliedstaatliche Verfassungsprinzipien auf. Das europa-rechtliche Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und die europarechtliche Pflicht zu Identitätsachtung sind insoweit vertraglicher Ausdruck der staatsverfassungsrechtlichen Grundlegung der Unionsgewalt. 150
Auch an anderer Stelle 151machte das Gericht deutlich, dass es die begrenzte Zuteilung von Einzelkompetenzen als wesentliches Instrument zur präventiven Abwehr vor der drohenden „Entstaatlichung“ und damit, wie oben dargestellt, auch zur Abwehr der Entdemokratisie-rung der Bundesrepublik und ihres Volkes begriff. Dabei ist die begrenzte Einzelermächti-gung als die Kehrseite des Verbotes zu betracht en, die „Kompetenz - Kompetenz“ zu übertra-gen:
Der Vertrag von Lissabon stattet die Europäische Union schließlich nicht mit Vorschriften aus, die dem europäischen Integrationsverband die Kompetenz-Kompetenz 152verschaf-fen. 153
Diese Aussage bestätigte den im Urteil zum Vertrag von Maastricht entwickelten Ansatz, dass eine begrenzte Zuteilung von Zuständigkeiten jeglicher Verselbstständigung vorbeuge und damit auch das Demokratiedefizit ausgeglichen werden könne. So meinte das Gericht selbst:
Das Grundgesetz ermächtigt die deutschen Staatsorgane nicht, Hoheitsrechte derart zu übertragen, dass aus ihrer Ausübung heraus eigenständig weitere Zuständigkeiten für die Europäische Union begründet werden können. Es untersagt die Übertragung der Kompe-tenz-Kompetenz. 154
Auf diese Art und Weise blieben die nationalen Parlamente für jegliche Entscheidung verant-wortlich, die von einem Unionsorgan getroffen wird. Würden einzelne Organe sich neue Kompetenzen zuteilen, würde zum einen das Demokratieprinzip der Bundesrepublik tangiert werden, da die Kompetenzerweiterung dann nicht vom deutschen Volk legitimiert würde. Zum anderen könnte darüber die staatliche Souveränität der Bundesrepublik beeinträchtigt werden, denn so würden dieser zwangsläufig Kompetenzen entzogen, die sie erst aufgrund ihrer staatlichen Souveränität besitzt. Ob eine Berührung oder sogar Beschränkung der staatlichen Souveränität hier tatsächlich anzunehmen ist, soll an dieser Stelle noch nicht ge-klärt werden. 155Dabei kommt es nämlich darauf an, ob man dem heute scheinbar mehrheit-lich vertretenen Konzept von der unveräußerlichen Kompetenz-Kompetenz folgt. 156Dieser Ansicht nach, wird die staatliche Souveränität jedenfalls so lange nicht berührt, wie diese noch dem Nationalstaat zur Verfügung stehen. Damit zog das Gericht mithilfe des Verbotes der Übertragung der Kompetenz-Kompetenz und mit dem damit einhergehenden Gebot der begrenzten Einzelermächtigung als Konsequenz die Grenze, die, einmal überschritten, dem Verständnis des Gerichtes zufolge zu einer Verletzung sowohl des Demokratie – als auch des Souveränitätsprinzips führen würde, da beide Verfassungsgrundsätze über eine Beeinträchti-gung der sie verbindenden Volkssouveränität gemeinsam verletzt würden. Die gemeinsame Schnittmenge beider Prinzipien soll im Folgenden noch eingehender untersucht werden. Deutlich wird, dass es dem Bundesverfassungsgericht hierbei um die Legitimation durch das deutsche Volk ging, also lediglich um einen kleinen Ausschnitt des Demokratieprinzips 157und nicht um das Demokratiegebot insgesamt. 158Indem das Bundesverfassungsgericht zum Teil sehr spezifische Kriterien des Demokratieprinzips formulierte und speziell diese als die tra-genden Hindernisse gegen eine weitere Integration ins Zentrum des Urteils rückte 159, sugge-rierte es, dass nicht die Legitimation und damit im Kern die Volkssouveränität, sondern De-mokratie als Ganzes und die staatliche Souveränität der weiteren Integration in die europäi-sche Union entgegenstünden. Indem das Gericht die spezifischen Elemente der Demokratie wie die Strafrechtspflege, als wichtige Elemente eines demokratischen Staates auflistete und sich mit diesen ausführlich auseinandersetzte, verlieh es aber diesen Kriterien eine unange-messen große Bedeutung. Dieser Eindruck wird verstärkt durch eine im Verhältnis zu ober-flächlich erfolgte Auseinandersetzung mit der Volkssouveränität als einem viel entscheiden-deren Demokratieelement. 160
bb) Die Ultra-vires- und Identitäts-Kontrolle
Zwei andere wichtige Mittel zur Wahrung der Verfassung sind zum einen die Ultra-vires- Kontrolle, die bei „ersichtlicher“ Grenzüberschreitung durch Unionsorgane eingesetzt wird, und zum anderen die Identitätskontrolle, die, ausgeübt durch das Bundesverfassungsgericht, gewährleisten soll, dass der Kern des Grundgesetzes gewahrt bleibt. Im Urteil zum Vertrag von Lissabon ging das Bundesverfassungsgericht zum ersten Mal auf die Identitätskontrolle ein:
Innerhalb der deutschen Jurisdiktion muss es zudem möglich sein, die Integrationsverant-wortung im Fall von ersichtlichen Grenzüberschreitungen bei Inanspruchnahme von Zustän-digkeiten durch die Europäische Union […] und zur Wahrung des unantastbaren Kerngehalts der Verfassungsidentität des Grundgesetzes im Rahmen einer Identitätskontrolle einfordern zu können. 161
Читать дальше