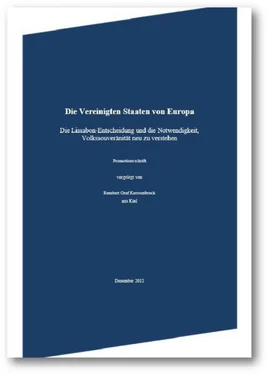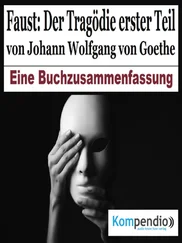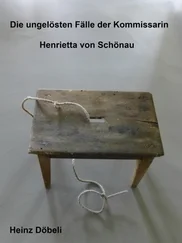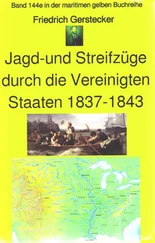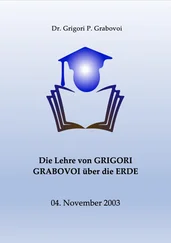Deutlich wird, wenn man sich diese unterschiedlichen und zum Teil gegensätzlichen Merk-male der EU vor Augen führt, dass die EU weder Staatenbund noch Bundesstaat ist. Zwar fußt sie konzeptionell zunächst auf dem Staatenbund, da völkerrechtliche Verträge Verfah-ren und Abläufe regeln und die einzelnen Regelungen streng die Souveränität der Mitglied-staaten wahren. Aber insbesondere der Anwendungsvorrang des Unionsrechtes gibt eben diesem ein Maß an Autorität, welches dem üblichen völkerrechtlichen Vertrag nicht zu-kommt.
Um nun zu klären, ob denn ein bundesstaatlich strukturiertes Europa mit der deutschen Ver-fassung im Konflikt steht, sollen die unterschiedlichen Optionen einer bundesstaatlichen Strukturierung erläutert werden.
IV. Unterschiedliche Formen der Bundesstaatenstruktur Bisher wurde untersucht, wie sich die Staatsform des Bundesstaates vom Staatenbund und von einer supranationalen Staatenverbindung grundsätzlich unterscheidet. Aber auch unter den bisher existierenden Bundesstaaten haben sich zwei verschiedene Ausrichtungen her-ausgebildet: zum einen der unitarische Bundesstaat, für den die Bundesrepublik Deutschland ein instruktives Beispiel bietet, zum anderen der duale Bundesstaat, den unter anderen die USA repräsentieren. 88
1. Der unitarische Bundesstaat
Charakteristisch für den unitarischen Bundesstaat ist das Streben nach einer möglichst gro-ßen Einheitlichkeit. 89Dies wird in der Bundesrepublik Deutschland an unterschiedlichen Stel-len deutlich:
Zum Beispiel wurden in den Gesetzgebungskatalog des Bundes in Art. 72 Abs. 2 GG Kompe-tenzen eingefügt, die dieser wahrnehmen darf, wenn dies zur „Wahrung der einheitlichen Lebensverhältni sse“ erforderlich sei. 90Schon im Bereich der Legislative macht die deutsche Verfassung deutlich, dass sie eine einheitliche Form des Föderalismus anstrebt. Zwar sind gem. Art. 30 GG die Erfüllung staatlicher Aufgaben und die Wahrnehmung staatlicher Befug-nisse Sache der Länder, jedoch nur so weit, wie diese nicht dem Bund zugeteilt wurden. Diese Einschränkung macht es möglich, dass die meisten Gesetzgebungskompetenzen beim Bund liegen und damit ein besonders hoher Unitarisierungsgrad möglich wird. 91
Es könnte dann auch erforderlich sein, dass neben den allgemeinen Strukturprinzipien wie Demokratie, Sozial- und Rechtsstaat die daraus abgeleiteten Grundsätze wie das freie Man-dat aus Art. 38 GG von den anderen Mitgliedstaaten übernommen werden müssten. Auf der anderen Seite könnte aber auch von der Bundesrepublik verlangt werden, dass sie sich im Staatsrecht an die anderen Unionsmitglieder angleicht, was Änderungen des Grundgesetzes zur Folge haben würde und womöglich mit dem Art. 79 Abs. 3 GG in Konflikt geraten könnte. So würden schnell historisch bedingte Unterschiede in den Verfassungsstrukturen zu un-überbrückbaren Konflikten führen. Beispielsweise wäre die konstitutionelle Monarchie Groß-britanniens mit der Stellung des Bundespräsidenten oder eine Parteiendemokratie Italiens, die ohne Fünf-Prozent-Hürde auskommt, nicht ohne Weiteres mit dem Grundgesetz in Ein-klang zu bringen. Das Bundesverfassungsgericht spricht zunächst von zentralen Demokratie-anforderungen, die auf unterschiedliche Weise verwirklicht werden könnten. 94Damit eng verbunden formuliert es aber auch einen anderen Aspekt, der letztlich in seinen unter-schiedlichen Formen Ausdruck der deutschen Volkssouveränität ist: Dass [d]ie europäische Vereinigung auf der Grundlage einer Vertragsunion souveräner Staaten […] allerdings nicht so verwirklicht werden [darf], dass in den Mitgliedstaaten kein ausreichen-der Raum zur politischen Gestaltung der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens-verhältnisse mehr bleibt. Dies gilt insbesondere für Sachbereiche, die die Lebensumstände der Bürger, vor allem ihren von den Grundrechten geschützten privaten Raum der Eigenver-antwortung und der persönlichen und sozialen Sicherheit prägen, sowie für solche politische Entscheidungen, die in besonderer Weise auf kulturelle, historische und sprachliche Vorver-ständnisse angewiesen sind, und die sich im parteipolitisch und parlamentarisch organisier-ten Raum einer politischen Öffentlichkeit diskursiv entfalten. 95 96, sich sehr von denen an-derer Mitgliedstaaten unterscheiden. Charakteristisch für den unitarischen Bundesstaat ist, dass dem Bund die unitarische Gesetzgebung und den Gliedstaaten die Verwaltung zu-kommt. 97Wenn aber schon die Verwaltungsstrukturen der (Bundes-)Länder sich stark unter-scheiden, erscheint eine grundlegende Konformisierung als schwierig. Gerade die Neustruk-turierung von zum Teil Jahrhunderte alten Strukturen würde nicht über die Entwicklung ei-ner einheitlichen Verfassung der Mitgliedstaaten geschaffen werden können, sondern müs-ste sich vielmehr entwickeln. Wenn die Bundesrepublik – trotz eines kooperativen Föderalis-mus 98– als Beispiel für einen unitarischen Bundesstaat zu betrachten ist 99, gibt es bei allen Gemeinsamkeiten – auf die noch weiter eingegangen wird – Unterschiede in den mitglied-staatlichen Strukturen, die bei der Umsetzung eines unitarischen Bundesstaates ein Hinder-nis darstellen könnten. Der unitarische Bundesstaat stellt somit wegen seiner stärkeren Ver-einheitlichungstendenz und den daraus erwachsenden hohen rechtlichen Anforderungen an die Gemeinschaft eine nur schwer umsetzbare Form des Bundesstaates dar. Es gibt aber eine Alternative, welche die „rechtlichen Vorbedingungen“, abgesehen von Demokratie und Sou-veränität, unangetastet lässt, und trotzdem einen Gesamtbundesstaat darstellt.
Womöglich bietet der duale Bundesstaat, den zum Beispiel die USA verkörpern, ein prakti-kableres Modell für die EU. 100Die Vereinigten Staaten von Amerika, die sich 1789 unter den „Articles of Confederation“ gründeten 101, mussten zunächst einen langen Konflikt um die Verteilung der Kompetenzen zwischen Union und Gliedstaaten (Art. I Abschnitt 8 U.S. Consti-tution) austragen. 102Ausgangspunkt war die Verfassung von 1787, nach der es eine Zentral-regierung gab, die zum einen aus dem „House of Representatives“ und zum anderen aus ei-ner Länderkammer, dem Senat, bestand. 103Die Stellung und Autonomie der Gliedstaaten waren insoweit geschützt, als die Befugnisse der Zentralgewalt in der Unionsverfassung ein-zeln aufgezählt waren und noch heute sind. 104Auch die Gleichberechtigung der Kammern hat besondere Auswirkungen: Damit werden alle Bundesgesetze zu Zustimmungsgesetzen, anders als zum Beispiel in Deutschland, wo, jedenfalls in der ursprünglichen Konzeption des Grundgesetzes, das Einspruchsgesetz die Regel und das Zustimmungsgesetz die Ausnahme darstellt. Dies ergibt sich aus Art. 77 Abs. 2a und 3 GG, wonach der Fall, in dem die Zustim-mung des Bundesrates erforderlich ist, gesondert geregelt ist. Hinzu kommt eine sehr viel striktere Trennung zwischen Bundes- und Landeskompetenzen: Das Militärwesen, die Erhebung von Steuern oder das Münzwesen sind zum Beispiel gem. Art. I Abscnitt 8 der U.S. Constitution dem Bund zugeteilt. 105Außerdem legt das 10th Amendment 106fest, dass alle in der Verfassung nicht dem Bund zugeteilten Kompetenzen Landeskompetenzen sind.
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people. 107
Zwar wirkt dies wie ein Äquivalent zu Art. 30 GG; anders aber als in den USA ist im deutschen Grundgesetz eine Zugriffsmöglichkeit von ganz anderem Ausmaße zugunsten des Bundes an-gelegt, und damit liegt das „Schwergewicht“ in der Gesetzgebu ng beim Bund. Nach Art. 70 iVm. Art. 72 Abs. 1 GG steht dem Bund sowohl die ausschließliche als auch die konkurrie-rende Gesetzgebung zu, die beide in der Summe den Regelfall darstellen. 109Man kann also sagen, dass Art. 30 GG iVm. Art. 72 GG nicht mit dem 10th Amendment vergleichbar ist. Jedoch konnte der Wortlaut des Art. I Abschnitt 8 der U.S. Consitution als Grundlage für eine Unitarisierungswelle auch in den USA benutzt werden: Der damalige Chief Justice Marshall ging davon aus, dass durch das Fehlen des Wortes „ausdrücklich“ 110und den Vorrang der Bundesverfassung 111ähnlich wie der Bund in Deutschland dieser auch in Amerika durch die Verfassung befähigt sei, alles, was „angebracht und notwendig“ sei, zu regeln 112. Mit Bezug auf diese Auslegung entwickelte der Chief Justice Marshall die Lehre von den „implied -pow-ers“. Diese besagt, dass alle in der Verfassung dem Bund zugeteilten Kompetenzen diesen gleichzeitig dazu befähigen, die geeigneten Mittel zur Erreichung des Zieles und des dauer-haften Funktionierens anzuwenden. 113Mit dieser Grundentscheidung wurde die Unitarisie-rungsentwicklung in Gang gesetzt. Dennoch sorgte das historisch gewachsene Selbstver-ständnis 114der Einzelstaaten sowie das 10th Amendment, dessen Berücksichtigung durch den Supreme Court überwacht wurde 115, dafür, dass die Unabhängigkeit der amerikanischen Staaten nach wie vor größer ist als die der deutschen Länder, und dass das System der USA repräsentativ für die Idee des dualen Bundesstaates ist. Dies zeigen auch heute noch auftre-tende Konflikte zwischen der Bundesregierung und den Einzelstaaten. 116
Читать дальше