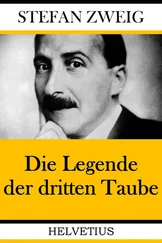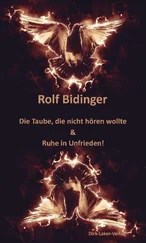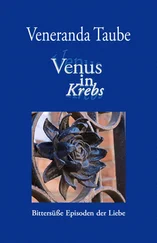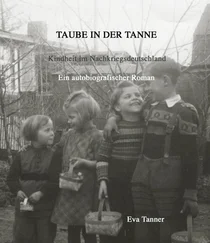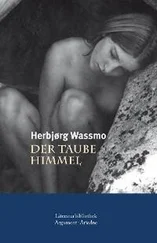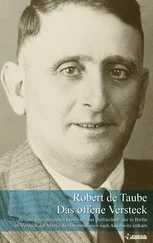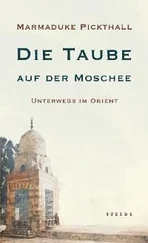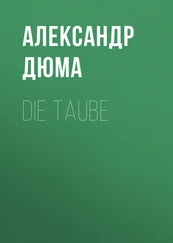Nun ja - auf See und vor Gericht sind alle in Gottes Hand. Hat der Pfarrer von der Seemannsmission gesagt.
Ohne konkrete Arbeitsanweisungen bekommen wir Neuankömmlinge zwei Tage Zeit, uns mit allen Räumen, Ventilen, Leitungen und Einrichtungen vertraut zu machen. Dabei erleben wir einige Überraschungen: Fingerdicke Rostbeulen an Deck und Außenhaut sind ohne eine vernünftige Grundierung mit Lack überpinselt worden. Manche Beulen sind so auffallend, als seien festsitzende Muscheln einfach überpinselt worden. Alle Wasser- und Heizungs- Rohrleitungen sind mehr oder weniger verdreckt, verstopft, verrostet. WCs und Urinals ebenso. Die Duschen funktionieren nicht. Anscheinend sollte das Schiff den Engländern überlassen werden, denn alle Ventile sind „englisch“, das heißt nach rechts wird ein Ventil oder Wasserhahn aufgedreht, nach links hingegen zu. Also genau umgekehrt, wie Deutsche es gewohnt sind. Was wir anfassen, muss entsprechend immer als bewusster Akt geschehen. Alle können sich vorstellen, dass es in den Öl-Tanks und im nicht sichtbaren Bereich des Schiffsrumpfes nicht viel anders aussehen kann, als im Blickfeld, beispielsweise den Ölleitungen an Deck.
Dann erbringen Maschinentests, dass die „Carola“ nur mit 6 sm (Knoten) fahren darf, weil sonst in der Maschine Probleme auftreten können.
Außerdem erlaubt die US-Administration nicht die Volladung des Schiffes, weil der Verdacht besteht, dass während der Fahrt durch US-Hoheitsgewässer Öl verloren wird. Es wird nur erlaubt, die Innentanks zu beladen. Armer Reeder! Das alles sieht nicht gut für ihn aus.
Es ist klar, dass auf dem gesamten Schiff absolutes Rauchverbot existiert, was einige Matrosen veranlasst, wegen höherer Heuer nachzufragen, allerdings nicht ernsthaft. Ernsthaft dagegen ist die Anordnung des Kapitäns auf Alkoholverbot. Das wiederum veranlasst einen der Flachmänner-Riege, nachts ein Blaues Kreuz auf den Schornstein zu malen.
Was zwar viel Arbeit, aber auch Spaß macht, sind die Rettungsbootsmanöver. Täglich drei, vier Mal bewegt die Decksmannschaft das laufende Gut der Boote, segelt oder rudert durch den Hafen, fettet und schmiert alles, was in einem Notfall gangbar sein muss, und legt die Rollen für einen Katastrophenfall fest.
Bootsmann Jens ist ein prima Kerl und kompetenter Seemann. Er sieht aus, wie sich alle einen Wikinger vorstellen: groß, stark, blondes Haar, blaue Augen, breite Schultern, Hände wie Schaufeln. Er ist ein guter Menschenkenner. Von Psychologie unbeleckt, hat er doch einen besonderen sozialen Instinkt und eine Ausstrahlung, die ihm Macht verleiht. Es ist klar, dass er der Erste der Mannschaft ist und dass sich alle an ihm zu orientieren haben. Seine Instrumente sind Umsicht, Übersicht, Vorsicht und Voraussicht. Am dritten Tag nimmt er mich zur Seite und will meinen Lebenslauf und Ansichten zu dem einen oder anderen Sachverhalt hören. Dann meint er: Er betrachte Seemannschaft als traditionellen Beruf und Abenteurer könne er grundsätzlich nicht leiden. Wenn ich jedoch meine Arbeit verantwortlich und ordentlich machen würde, kämen wir vermutlich miteinander aus. Er findest es gut, dass ich bei der Bundestagswahl gewählt habe. Er hat ebenfalls gewählt.
Nach ein/zwei Tagen stellt der Erste Offizier fest, dass die Längsachse des Schiffes geringfügig verdreht ist. Dadurch wird der Befehl „Ruder midships“ dem Schiff einen Links-Drall verleihen, der durch „Ruder steuerbord“ ausgeglichen werden muss. Das bedeutet, dass keine normale Seewachen geschoben werden können, sondern nur ein kleiner, ausgewählter Personenkreis das Ruder bedienen darf. Ich gehöre nicht dazu.
Jens richtet es so ein, dass ich mit ihm häufiger zusammen Arbeiten erledige. Er scheint gern mit mir zu schwätzen und ist trotz aller Probleme und Besonderheiten von einer guten Reise überzeugt: Die „Carola“ habe einen scharfen und doch ausladenden Bug, der die See gut nehmen kann und das hochgezogene Heck mit den Aufbauten hält die achtern auflaufende See von Deck ab. Ich mache mir seinen Optimismus zu eigen.
Die Schiffsführung hält es nicht für angebracht, normalen Kurs, also Großkreis zum Ärmelkanal zu steuern. Die Winterstürme nördlich der Azoren sind für das Schiff zu gefährlich, zumal sich im Warmwasser des Golfstromes höhere Wellen entwickeln, als auf einer Route südlich der Azoren. Auf eine Überfahrt von mindestens 21 - 25 Tage müssen sich alle ohnehin einstellen - dann also auch die sicherere Route.
Gedacht ist, den Schub des Golfstromes mit zusätzlich 6 - 10 Knoten durch das Bermuda-Dreieck bis Kap Hatteras auszunutzen, die Sargasso-See nördlich zu umrunden, um dann Kurs Ost die Gegend südlich der Azoren anzupeilen. Ausläufer und Abspaltungen des Golfstromes würden vermutlich bis zu den Azoren ausgenutzt werden können.
So werde ich von Jens bestens informiert und revanchiere mich mit anspruchs-volleren Themen.
Nach zehn Tagen Galveston geht es dann endlich auf große Fahrt. Ein Flugzeug der Cost-Guard begleitet das Schiff noch eine zeitlang und wackelt beim Überflug jedesmal mit den Tragflächen. Die Besatzung empfindet das als sympathische Geste. Ich denke: Die Amerikaner beobachten uns wahrscheinlich, um zu sehen, ob wir hinter uns eine Ölfahne herziehen. Sie kennen schließlich die Geschichte des Schiffes.
Das Bermuda-Dreieck habe ich als ein seltsam atmosphärisches Phänomen in Erinnerung. Es ist der vierte oder fünfte Tag der Reise. Bisher war das Wetter gut. Die Sonne scheint auf eine ruhig atmende See. Eine langgezogene Dünung mit zwei Metern Wellenhöhe rollt in langen Zügen unter dem Schiffsrumpf durch. Es verspricht, wieder ein heißer Tag zu werden. Ich bin achtern auf dem Offiziers-deck mit Entrosten beschäftigt und stelle fest, dass die Rostbeulen echt sind und keine übergepinselte Muscheln.
Der Anblick der See ist kurzweilig. In langgestreckten Hügeln der Dünung, die vom offenen Ozean her anrollen, tauchen aus völlig anderer Richtung, als scharfe Striche, kleinere Wellenzüge auf, schräg zur Dünung. Plötzlich kommt aus einer dritten Richtung ein weiterer, etwas größerer Wellenzug, läuft quer zum ersten und beide überkreuzen sich zu Mustern, die ich bis dahin noch nicht gesehen habe und auch später nicht mehr sehen sollte. Es ist offensichtlich nicht die Kreuzschraffierung, die mit einer sich ändernden Wetterlage einher geht. Es ist etwas anderes. Ich mache Jens darauf aufmerksam und deute an, die Ursache für die kleinen Wellenzüge komme bestimmt irgendwie von unten, aus der Tiefe. Jens lacht nur: „Quatsch! Das sind Reste von zwei Stürmen, die Tausende von Kilometern entfernt sich ausgetobt haben. Sei nicht abergläubisch!“ Ich glaube das nicht, weil die scharfe Vorderkante der Wellenzüge zu steil ist. Auf so große Entfernung wie Jens meint, müsste sie flacher sein. Plötzlich blitzt und donnert es um uns herum, ohne dass sich eine auffallende Gewitterwolke über uns angekündigt hätte. Das in der Hitze verdunstende Wasser hat die Luft klebrig gemacht und wolkenähnlicher Nebel ist zu sehen, aber keine Gewitterwolke. Regen prasselt in dicken Tropfen in die glatte Meeresoberfläche und kräuselt sie, als wäre der Ozean ein Gartenteich. Und dann zischen Blitze ins Wasser, dem
ohrenbetäubender Donner folgt. Von dem halben Dutzend Blitzen, die scheinbar gleichzeitig mit dem Donner niederfahren, habe ich zwei, in einem Abstand von 30 bis 50 Metern vom Schiff entfernt ins Wasser schlagen sehen, dass es nur so spritzt und dampft. Ich frage mich und später auch Jens, welche Erklärung er dafür hat? Wieso fahren Blitze ins Meer, wenn doch unsere Blitzableiter an den Masten einladend genug mit ihren 30 Metern Höhe in die Atmosphäre ragen. Lange nachdem dieses komische Gewitter zu Ende ist, überlege ich noch, wie sich elektrische Spannung derart punktuell und regional begrenzt auf dem Wasser bilden können, dass ein Eisenkasten, wie unserer Dampfer ein geringeres elektrisches Feld produziert, als Teile der Wasseroberfläche? Die Schiffsführung nimmt dieses Geschehen als gutes Omen für die Reise.
Читать дальше