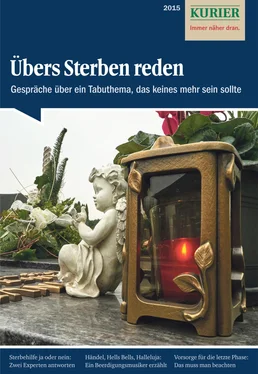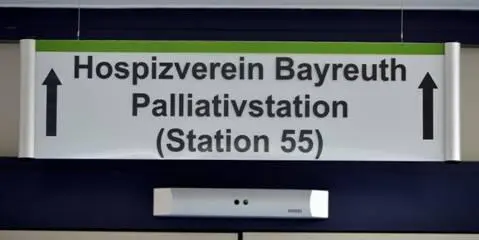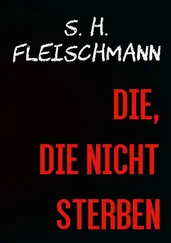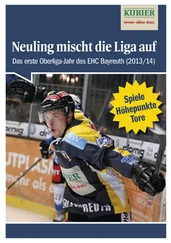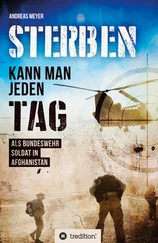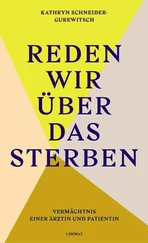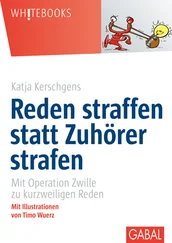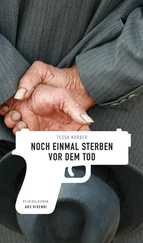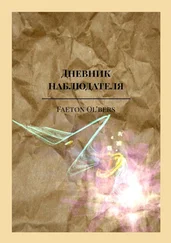KIRCHEN
Die katholische Kirche St. Michael in Weidenberg. Foto: Pilz
Geistliche sind in der Region für Sterbende eher selten erste Ansprechpartner, sagt Reinhard Forster, katholischer Pfarrer in Weidenbergund Kirchenpingarten. „Die Kirchenbindung ist hier deutlich niedriger als in katholischen Gegenden.“ Gelegentlich werde er angefragt, dann bete er gemeinsam mit dem Sterbenden und spende die drei Sakramente. Auch der evangelische Pfarrer Edmund Grömer aus Bindlachsagt, er werde eher gerufen, wenn der Todesfall schon eingetreten ist. „Viele Sterbende erschrecken sonst, weil sie denken: Wenn der Pfarrer kommt, ist es amtlich.“ Wird er gerufen, greift er auf Gebete zurück, die dem Sterbenden vertraut sind. „Auch wenn ihr Bewusstsein getrübt ist, verstehen sie dann: Hier passiert gerade geistliches Handeln.“
HOSPIZVEREIN
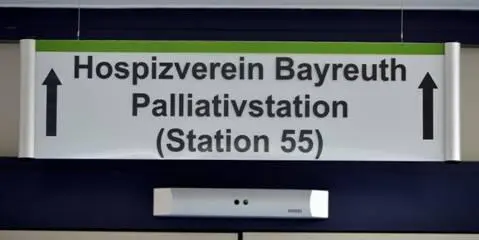
Der Hospizverein hat seine Räume direkt neben der Palliativstation im Klinikum. Foto: Wittek
„Wir gehen mit den Sterbenden ihren Weg, in ihrem Tempo“, sagt Brigitte Moser, Fachkraft für Hospiz und Palliative Care beim Hospizverein in Bayreuth. Die rund 50 ehrenamtlichen Begleiter kommen immer dahin, wo sie gebraucht werden: in Kliniken, Seniorenheime und zu den Menschen nach Hause. Sie schenken den Sterbenden ihre Zeit, hören zu, spüren, was der andere braucht. Und sie helfen, Dinge zu klären, die sonst ungeklärt blieben, weil Kranke die Angehörigen nicht damit belasten möchten – oder die den Kranken schonen wollen, sagt Moser. Die Begleiter sind zwischen 35 und 81 Jahre alt, ihre Hilfe ist kostenlos.
PALLIATIVSTATION
Auf der Palliativstation im Klinikum Bayreuth wird alles getan, um die Beschwerden der Patienten zu lindern. Duftlampen zum Beispiel helfen gegen einen trockenen Mund. Foto: Harbach
Die Palliativstation im Klinikumist für Menschen mit einer lebensbedrohlichen, nicht heilbaren Krankheit gedacht, die starke Beschwerden haben. Das können zum Beispiel Krebspatienten sein, die körperliche Schmerzen, Atemnot oder Panikattacken haben. Auf der Station versuchen Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten, diese Menschen mit Medikamenten, Pflege und Therapieangeboten so weit zu stabilisieren, „dass die Patienten ihre letzten Stunden, Wochen oder Monate zu Hause verbringen können“, sagt Dr. Wolfgang Schulze, Chefarzt der Station. Rund zwei Drittel der Patienten werden wieder entlassen, der größte Teil nach Hause, einige ins Hospiz. Es gibt zwölf Plätze und eine Warteliste, Kranke brauchen eine Überweisung des Hausarztes. Ab Oktober wird die sogenannte Spezialisierte Ambulante Palliative Versorgung (SAPV) dazukommen, die Patienten zu Hause medizinisch, pflegerisch und therapeutisch bis zum Tod betreut.
ALBERT-SCHWEITZER-HOSPIZ

Der Raum der Stille im Albert-Schweitzer-Hospiz in Oberpreuschwitz. Foto: Lammel
Im Albert-Schweitzer-Hospizwerden schwerkranke Menschen, die nicht mehr nach Hause zurück können, weil sie zu schwach sind oder Rundumbetreuung brauchen, kurz vor Ende ihres Lebens palliativ betreut. „Diese Menschen sollen sich bei uns sicher und aufgehoben fühlen“, sagt Hospiz-Leiterin Angelika Eck. Die Bewohner werden von Bayreuther Hausärzten betreut. Den Aufenthalt übernehmen größtenteils die Kassen, ein Teil wird durch Spenden finanziert. Das Hospiz hat zehn Plätze, auch hier gibt es ab und zu eine Warteliste.
„Manche wollen einfach ihre Ruhe“
Interview mit Palliativ-Krankenschwester Elfriede Dollhopf über den Umgang mit dem Sterben
Palliativmedizin und Hospizgedanke gibt es in Deutschland noch nicht lange. Die erste Palliativstation entstand 1983 in Köln, das erste Lehrbuch wurde 1997 herausgegeben. Elfriede Dollhopf (52) war von Anfang an dabei, heute kümmert sie sich auf der Palliativstation des Klinikums um schwerkranke Patienten.

Elfriede Dollhopf hat die Veränderungen im Umgang mit dem Sterben direkt miterlebt: Sie arbeitete zunächst in der Onkologie, wechselte dann auf die Palliativstation des Klinikums und wird ab Oktober die spezialisierte ambulante Palliativversorgung übernehmen, die zu den Menschen nach Hause kommt. Foto: Harbach
Frau Dollhopf, Sie haben die Veränderungen im Gesundheitswesen direkt miterlebt. Was können Ärzte, Pfleger und Betreuer heute besser als vor 30 Jahren?
Elfriede Dollhopf:Früher hat man nach damaligem Wissen gehandelt. Nehmen wir das Beispiel Mundtrockenheit: Vor 30 Jahren hat man Infusionen gegeben und mit einer Mischung aus Butter und Honig Mundpflege gemacht, um das Trockenheitsgefühl zu lindern. Heute weiß man, dass es viel besser hilft, mit gekühlten Getränken den Speichelfluss anzuregen. Oder mit gefrorener Ananas. Oder mit ätherischen Ölen, die man in einer Duftlampe verdampft. Die Hospizbewegung hat dazu geführt, dass es mehr Forschung zum Thema palliative Pflege gibt. Und damit mehr Wissen – und mehr Handlungsmöglichkeiten.
Hört sich vor allem nach medizinischem Fortschritt an.
Dollhopf:Nein, das gilt auch für andere Bereiche, zum Beispiel den Umgang mit dem Tod. Für das Abschiednehmen vom Verstorbenen können sich Angehörige auf der Palliativstation heute Zeit nehmen. Wir können zum Beispiel das Abschiedszimmer auf zehn Grad kühlen. Die Familie eines vor kurzem verstorbenen Patienten konnte sich so noch das ganze Wochenende über verabschieden. Wenn die Angehörigen das wünschen, können wir zum Beispiel auch eine kleine Aussegnungsfeier organisieren.
Früher war das anders?
Dollhopf:Früher wie heute zählt eine dem Menschen zugewandte Haltung, die die individuellen Bedürfnisse der Patienten und Familien erkennt und beachtet.
Und das bedeutet?
Dollhopf:Wir hatten schon Patienten, die wollten am Ende ihres Lebens einfach ihre Ruhe haben. Haltung bedeutet, ihnen diese Ruhe zu gönnen. Für jemand anders, der Ängste hat, ist es wichtig, dass immer jemand da ist. Hier bedeutet Haltung, den Wunsch zu respektieren und die Familie so gut es geht zu unterstützen. Heute ist durch äußere Gegebenheiten auf der Palliativstation, zum Beispiel den Abschiedsraum, manches mehr möglich.
Sind wir schon am Ende dieser Entwicklung angekommen oder kommt danach noch etwas?
Dollhopf:Als Nächstes kommt im Herbst die sogenannte spezialisierte ambulante Palliativversorgung, kurz SAPV: Ein Team aus palliativ geschulten Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten kommt zusätzlich zu Hausarzt und Pflegedienst zu den Patienten nach Hause. Dieses Team ist rund um die Uhr erreichbar und hat Zeit sowohl für Patienten als auch für Angehörige. Der Gedanke dabei ist, die Menschen früher zu begleiten, um in schwierigen Situationen aktiv werden zu können. Dadurch sollen unnötige Einweisungen ins Krankenhaus vermieden werden. Das ist ein weiterer Schritt nach vorne – und ich freue mich darauf.
Was treibt Sie an, sich den ganzen Tag mit Tod und Leid zu umgeben?
Dollhopf:Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, dass Menschen als Menschen gesehen werden, nicht nur als Patient oder Verstorbener. Der Mensch verliert nicht seine Würde, weil er entstellt oder dement ist, auch wenn nicht mehr das da ist, was mal da war.
Читать дальше