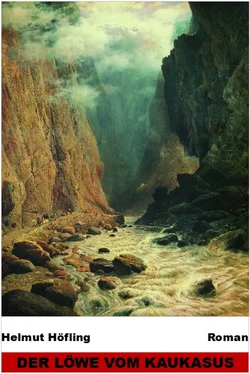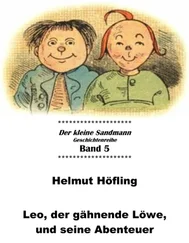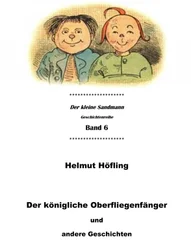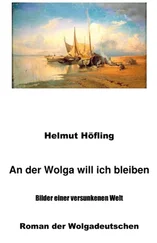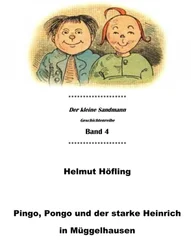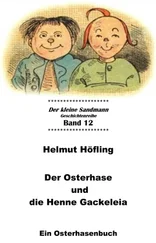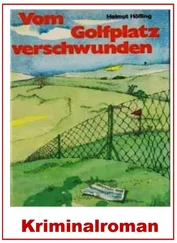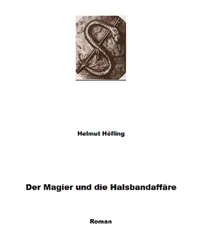„Erst jüngst hatte ich einen denkwürdigen Traum“, erzählte Mahommed. „Ich sah fremde Krieger mit langen Haaren wie die Russen einen Garten zerstören und die Feigenbäume und Blumen ausreißen. Als die Gläubigen diesen Frevel sahen, packte sie der Zorn. Sie stürzten aus der Moschee und erschlugen die Fremden mit den Steinen des Gotteshauses. Während ich gerade entsetzt feststellte, dass die Moschee zerstört war, blendete mich ein Lichtschein, und eine Stimme sprach: ‚O, du Kleingläubiger! Kann Allah sein Haus nicht wiederaufbauen, wann er will? Ist es nicht besser, die Gläubigen erschlügen die Krieger der Ungläubigen, als dass sie Schaden nähmen an ihrer Seele? Was eifert ihr Toren um euren Glauben, weshalb spaltet ihr meine Anhänger in Schiiten und Sunniten? Warum zerfleischt ihr euch um meines Glaubens willen? Höre, denn so spricht zu dir der Gottgesandte: Einigt euch und zerschlagt die Häupter der Ungläubigen, die in euer Land einfallen! Dies ist Allahs Wille und sollte auch dabei sein Haus einstürzen. Dereinst wird es wiedererstehen in noch größerer Herrlichkeit!´“
Diese Worte des Mullahs verfehlten ihre Wirkung nicht, denn Aslan Khan, obwohl ein Russenfreund, war ein gläubiger Muslim.
„Nun?“, fragte ihn Jermolow, als Aslan Khan nach seiner Unterredung ins russische Hauptquartier zurückkehrte. „Hört er jetzt endlich auf, gegen uns zu hetzen und zu wühlen?“
„Alles in bester Ordnung, General“, versicherte der Fürst und berichtete dem russischen Oberbefehlshaber, er habe die Gemüter besänftigt. Obwohl sich Aslan Khan nach außen hin weiter russenfreundlich gab, sympathisierte er heimlich schon mit den Muriden. Er wagte damit einen gefährlichen Seiltanz.
Jermolow schöpfte keinen Verdacht. Denn als die ständigen Hetzereien und Unruhen nicht aufhörten, ließ er Mullah Mahommed nicht durch verlässliche Kosaken seiner Armee verhaften, sondern durch Aslan Khan. Unterwegs entkam der Muride und floh ins Bergland von Tabassaran, wo er in den Dörfern weiterhin in seinen Predigten die Kaukasier zum Widerstand gegen die Ungläubigen aufrief.
„ Wann wird in den Bergen kein Blut mehr fließen? Wenn Zuckerrohr im Schnee wächst.“
So lautet ein altes kaukasisches Sprichwort, und selten hat ein Spruch so viel Wahrheit enthalten, die ganze bittere Wahrheit.
Schon von alters her beherrschten Rache und Gewalt die düstere Geschichte des Kaukasus. Die Bergvölker, besonders die Inguschen und Tschetschenen, beraubten Kaufleute und Reisende, Post und Karawanen. Abgeschlagene Köpfe oder Hände von Feinden waren im Kaukasus gängige Münze, und in solchen Trophäen wurde die Mitgift eines Mädchens vom Stamm der Tuschen berechnet. Am einfachsten ließ sich die Anzahl der erbeuteten Köpfe vorweisen, wenn man die abgeschnittenen Ohren auf Peitschenschnüre aufzog. Je mehr abgehackte Hände am Sattel eines jungen kaukasischen Kriegers hingen, desto mehr war er als Draufgänger und verwegener Kämpfer angesehen. Nur rechte Hände zählten, linke dagegen kaum, denn ein Kaukasier, dem man die linke Hand abgeschlagen hatte, kämpfte unverdrossen weiter.
Die Blutrache, die oft über drei oder vier Generationen hinaus vollstreckt wurde, rottete ganze Familien aus. Als arm und bemitleidenswert galt ein Haus nur dann, wenn niemand mehr darin lebte, der kämpfen konnte.
Immer wieder waren fremde Eroberer eingedrungen, in den letzten Jahrzehnten vor allem Türken, Perser und Russen. Jahr für Jahr hatten die zaristischen Armeen die asiatische Grenze weiter und weiter zurückgeschoben, langsam, aber stetig und immer wieder von Rückschlägen unterbrochen. Von mehr oder weniger Erfolg begleitet hatte auch die Eroberung des Kaukasus im siebzehnten Jahrhundert als belangloser Feldzug begonnen. Peter den Großen, der einst seine Soldaten ans Kaspische Meer geführt und sich dort in der Hafenstadt Derbent niedergelassen hatte, lockten die fruchtbaren Täler und geschäftigen Küstenstädte. So entschlossen er war, diese prachtvolle Beute Persien zu entreißen, so sehr schreckte er vor den gigantisch und drohend aufragenden Bergen Dagestans zurück, die der Legende nach aus purem Gold waren und von erbittert kämpfenden Volksstämmen verteidigt würden. Selbst ein so hemmungsloser Eroberer wie Peter der Große wagte keinen Feldzug gegen Dagestan. Er begnügte sich mit der Ebene, schloss einen Vertrag mit den Persern und setzte einen russischen Statthalter ein, der mit Härte und Gewalt den Willen des Zaren durchsetzen sollte.
Doch die asiatischen Stammeshäuptlinge scherten sich nicht im Geringsten darum, ob Zar oder Schah den Anspruch erhob, ihr Herrscher zu sein. Mit jedem, der sich ihnen in den Weg stellte, machten sie kurzen Prozess, so mit einem General Peters des Großen, einem Fürsten, dem sie die Haut abzogen, um damit eine Trommel zu bespannen. Die Khane und Fürsten von Georgien, Aserbeidschan und Dagestan jagten mit edelsteinverzierten Waffen und abgerichteten Leoparden die russischen Soldaten wie prächtiges Wild. Russland war heilfroh, nach einer Reihe diplomatischer Schachzüge seine stark gelichteten Truppen endlich wieder abziehen und die kaukasischen Provinzen an Persien zurückgeben zu können.
Die imperialistischen Gelüste in St. Petersburg waren damit jedoch nicht erloschen. Nach weiteren Anläufen erreichte der Eroberungssturm der Russen in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts seinen Höhepunkt, als die zaristischen Armeen ostwärts marschierten und dabei asiatische und nahöstliche Provinzen an sich rissen. Nur der Kaukasus versperrte den Russen den Landweg nach Indien und schien ihre lang gehegten Träume von kolonialer Ausbreitung im Osten zu zerstören.
Doch Jermolow, der Oberbefehlshaber der zaristischen Südarmee, ließ nicht locker. Er hatte von Anfang an, seit er auf diesen Vorposten des zaristischen Imperialismus berufen worden war, die Notwendigkeit begriffen, die russische Herrschaft auf den ganzen Kaukasus auszudehnen, einschließlich der unabhängigen und teilweise abhängigen Staaten und Gemeinwesen bis zu den Grenzen Persiens und der Nordgrenze der Türkei in Asien. Er war nicht nur der Erste, der einen Teil des Kaukasus unterwarf, eine Kette von Festungen errichtete und die Georgische Heerstraße baute, sondern auch der Erste, der persische und tatarische Gebiete dem russischen Imperium einverleibte. Jedes Mittel, seine Ziele zu erreichen, war ihm recht, ungeachtet des unermesslichen Schadens, den er durch seine Anmaßung, Rohheit und Grausamkeit anrichtete.
Seine Gräueltaten waren nicht nur der letzte Anstoß, den Muridismus wiederaufleben zu lassen und die fanatische Feindschaft der Dagestaner und Tschetschenen zu entfachen, sie bereiteten auch den Boden für den Ausbruch des Persischen Krieges. Als die Perser, die heimlich die Bergvölker, auch später noch, mit Munition und Waffen versorgten, im Jahre 1826 in russisches Gebiet einfielen, wurden Jermolows Truppen durch die Eindringlinge abgelenkt. Die kaukasischen Stämme, die jetzt freie Hand hatten, nutzten die Gunst der Stunde. Überall in den Bergen Dagestans brach der Aufstand aus, da die russischen Garnisonen zu geschwächt waren, um den Feind im Süden niederzuwerfen.
Nachdem sich auch die Tschetschenen weiter nördlich dem Aufruhr angeschlossen hatten, tauchte eines Tages ein Trupp von ihnen vor der kleinen Festung Amir-Hadschi auf.
„Macht das Tor auf, Kameraden!“, rief einer der russisch sprechenden Krieger. „Wir kommen zu eurer Verstärkung. General Grekow hat uns hierher abkommandiert.“
Im Schummerlicht der Dämmerung bemerkten die Wachposten, dass die Männer, die draußen vor dem Tor warteten, Lammfellmützen und Tscherkesskas trugen wie die „Linienkosaken“, ihre Kameraden, die im Norden an den Ufern des Valerik und Terek als Vorposten der Armee lebten. Sie sollten die russischen Befestigungen an den Grenzlinien halten, die sich Jahr für Jahr weiter nach Süden und Osten vorschoben.
Читать дальше