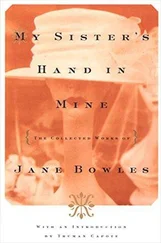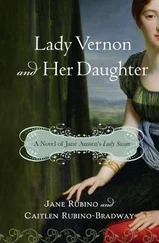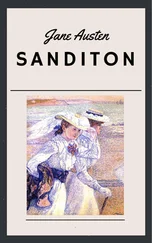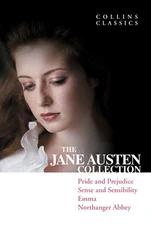»Du kannst die Jacke ausziehen und dich hier in die Küche setzen. Sie wird ja gleich kommen.«
Milo nickte. Der Blick, mit dem er zu mir aufsah, schien zu sagen: Hauptsache, ich bin jetzt hier. Es war ein betrübter, hellgrau verschleierter Blick. Als er die Jacke abstreifte, kam ein eingegipster Arm zum Vorschein, übersät mit bunten Namen und Kinderzeichnungen. Der Junge setzte sich an den Küchentisch und sah still vor sich hin. Ich hatte noch zu viel aufzuräumen, um auf ihn einzugehen.
Lajosné erschien um neun Uhr fünfundzwanzig und betrat mit ihrem traurigen Lächeln und einer Selbstverständlichkeit das Haus, als ginge sie hier seit Jahren ein und aus. Wegen Milo verlor sie kein Wort. Als sie ihren Mantel an den Haken hängte, wollte ich etwas sagen. Aber dann sah ich den Jungen, wie er mit gesenkten Lidern am Küchentisch saß, und ich schwieg.
Jetzt war nicht nur eine fremde Person im Haus, sondern es waren zwei, doch seltsamerweise machte es mir weniger aus. Obwohl es bis zu Janders Termin noch eine halbe Stunde dauerte, sah ich mir selbst dabei zu, wie ich seelenruhig und mit einer Leichtigkeit, die mir sonst abging, Stück für Stück die noch übrigen Winkel für Lajosnés Arbeit vorbereitete. Ich legte sogar Wäschestücke zusammen, die ich normalerweise so, wie sie waren, in die Kommode gestopft hätte. Und während ich all diese sonst so leidigen Handgriffe tat, fragte ich mich, was Milo zwei Stunden lang in meiner Küche tun sollte. Denn wie es aussah, hatte er nichts mitgebracht.
Mit einem Packen Zeitungen ging ich zu ihm.
»Langweilig?«
»Es geht.« Seine Kieselaugen, unter denen sich Schatten zeigten, betrachteten den Papierstapel in meinem Arm.
»Malstifte habe ich nicht. Aber hast du Lust, Bilder auszuschneiden und sie hier aufzukleben? Oder bist du Linkshänder?« Ich deutete auf den Gips an seinem linken Arm.
Er schüttelte den Kopf.
Aus einer Schublade nahm ich eine Schere, Kleber und einen Bogen Packpapier.
Milo beobachtete meine Bewegungen. Skeptisch sah er mich an.
»Darf ich das zerschneiden?« Als er das sagte, zeigten sich zwei Zahnlücken in seinem Mund. Eine oben, die andere unten.
Mein Lachen verunsicherte ihn. Er zog die Schultern zusammen und wich mit dem ganzen Körper zurück.
»Die Zeitungen sind alt. Du kannst damit machen, was du willst.«
»Alte Sachen sind wertvoll«, wisperte er.
»Diese nicht.« Ich zog eine Wochenendbeilage über Gewässer hervor und legte sie obenauf. Dann ließ ich ihn allein und betrat die Praxis, wo Lajosné die Regale abstaubte.
»Das ist nicht nötig. Nicht heute.« Ich wollte den Raum für mich allein.
»Er konnte nicht zu Hause bleiben. Da ist niemand«, sagte sie rasch, ohne mich anzusehen.
Ich merkte, dass sie noch etwas sagen wollte.
»Sein Vater ist tot.« Schnell wandte sie mir den Rücken zu, nahm die Putzsachen und verließ den Raum.
»Tut mir leid«, murmelte ich.
Sie war schon am Ende des Flurs.
Es blieb keine Zeit, weiter mit ihr zu sprechen. Jander kam. Mit dickem Schal und gefüttertem Wintermantel stand er vor der Tür. Seine Nase lief, und er hustete unentwegt. Er sei kurz davor gewesen, den Termin abzusagen. Doch dann habe er sich entschlossen, die Sache durchzuziehen und »Klartext zu reden«, wie er es nannte.
»Um es gleich zu sagen: Nichts hat sich verändert«, war das Erste, was er sagte, als er die Stiefel auf der Fußmatte abtrat. »Und ich hoffe, das Thema Traum ist damit erledigt.« Er schenkte mir einen triumphierenden Blick, während er Hut und Mantel aufhängte. Den Schal behielt er an. Bevor er sich setzte, ließ er eine Packung Taschentücher auf den Beistelltisch fallen.
»Hoffentlich stecke ich Sie nicht an«, sagte er. Sein Ton ließ eher das Gegenteil vermuten.
Ich nahm Platz, überprüfte die Zeit und wollte Jander nach dem für heute wichtigsten Anliegen fragen, als plötzlich der Satz, den er eingangs gesagt hatte, in meinen Ohren hallte. Das Thema Traum ist damit erledigt.
Der Traum war der Schlüssel zu Janders Fall. Ohne ihn würden wir nicht weit kommen. Wir brauchten ein Erklärungsmodell. Nicht irgendeines, wie manche Kollegen es aus dem Handbuch kopierten. Wir brauchten alle Faktoren und Elemente seiner persönlichen Situation. Was nützte uns alles andere, solange wir nicht die verstörende Szene verstanden, die Jander jede Nacht um drei Uhr erlebte. Und vor allem: Warum geschah das?
»Sie sagen, es habe sich nichts verändert.«
»Genau.« So einen zufriedenen Gesichtsausdruck hatte ich an ihm zuvor noch nicht entdeckt. Es fehlte nur noch, dass er zum Beweis eine Panikattacke bekam.
»Und Sie sind sich sicher?«
»Ganz sicher.« Er lehnte sich zurück und betrachtete seine Fingernägel.
»Dann haben wir unser erstes Ziel erreicht.« Ich beugte mich zu ihm vor. »Sicherheit.«
»Unheimlich witzig.«
»Ungewissheit füttert die Angst.«
Janders Finger pochten auf die Armlehne. »Dann hätte jeder Panikanfälle.«
»Ich meine die Ungewissheiten, die Sie beeinflussen können. Alles, worin Sie freie Entscheidungen treffen können, wenn sie es nur mit ihrer ganzen Kraft wollen. Vielleicht passt es nicht ganz zu dem, was Sie nachts erleben …«
Er schloss die Augen und atmete ein.
»Doch eines ist deutlich: Wir müssen herausfinden, was hinter dem Wiederholungstraum steckt. Und warum Sie jede Nacht um drei Uhr diese Dinge erleben.« Bei der Erinnerung an seinen Bericht überkam mich ein leichtes Frösteln.
Noch während ich sprach, spürte ich, wie absurd meine eigenen Aussagen klangen. Ich redete von Dingen, für die es kein therapeutisches Werkzeug gab. Das, worauf sonst Verlass war – die Erklärung –, geriet in Janders Fall zum zentralen Problem. Schon der erste Schritt, das Verstehen, fiel weg. Ohne Verstehen fehlte es an Vertrauen, und ohne Vertrauen gab es keine Therapie.
Aber ich machte weiter. Etwas nicht Greifbares trieb mich an. Ohne Verstand sah ich mir dabei zu, wie ich jede Chance verspielte.
Ich rückte meinen Sessel ein Stück vor.
»Wenn wir begreifen, was Sie in diese Lage gebracht hat, reduziert sich die Angst, und Sie erkennen: Sie sind freier, als Sie dachten.« Selten war ich mir so lachhaft vorgekommen.
Die Falten in Janders Augenwinkeln vertieften sich nicht, als er die Lippen zu zwei blassroten Bögen nach oben spannte, geschlossen, so dass die Zähne verborgen blieben. Es war ein verlogenes Lächeln, eine Grimasse der Unehrlichkeit.
Was war die Unbekannte in seiner Gleichung? Welches Puzzleteil versteckte er? Denn für das Unerklärliche seines Falles sah ich nur eine Erklärung: Er behielt etwas für sich.
Nachmittags kamen zwei neue Patienten, deren Schilderungen ich mit Mühe folgte. Die Sonne, an diesem Tag ohnehin ein Phantom, ging scheinbar Stunden früher unter. Als ich die letzte Akte zuklappte, meldete sich mein Magen, denn ich hatte das Mittagessen ausfallen lassen. Ich ging in die Küche, um Pasta zu kochen. Auf dem Tisch lag Milos Bild. Eine Collage, ein Nebeneinander bunter Motive und Buchstaben. Die Zeitungen waren durchwühlt, Papierschnipsel lagen herum. Dafür war keine Zeit mehr, sagte ich mir.
Ich setzte Wasser auf und beugte mich über Milos Werk.
In mir zog sich etwas zusammen. Um zu verstehen, warum, konzentrierte ich mich. Aber so lange ich die wirren Formen auch betrachtete, ich kam nicht darauf.
Die Mitte des Packpapierbogens, im Maßstab größer als die anderen Bestandteile, füllte die Zeichnung einer Schnecke aus, mit kegelförmigem Gehäuse und kurzen Fühlern, die Stacheln glichen. Ähnliche Tiere hatte ich in Aquarien gesehen, wo sie ihre glitschigen Körper über Glaswände oder algenbewachsene Steine schoben.
Um die Schnecke herum waren Strahlen geklebt, ein Dutzend schmaler gelber Streifen, wie Sonnenstrahlen. Dazwischen befanden sich schwarze Sterne, deren feine Zacken mich so erstaunten, dass ich einen Weile in ihrem Anblick versank.
Читать дальше