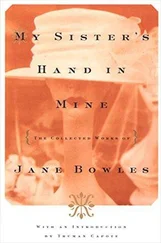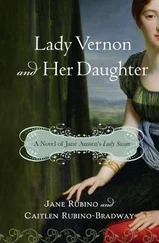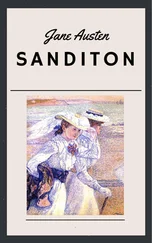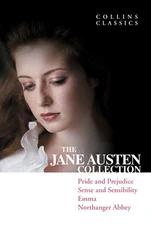Vor dem Gebäude war ich der einzige Mensch. Im beginnenden Regen näherte ich mich dem Portal und drückte den Klingelknopf. Legte die Hand auf den Türknauf. Wartete. Läutete noch einmal. Stellte mich dicht vor die Tür. Hörte den Wind über die Sträucher am Parkplatz streichen.
Ich zuckte zusammen, als die Tür aufging. Ein Briefträger kam heraus.
»Ist offen«, murmelte er und eilte weiter.
Ich brauchte die Tür nur aufzudrücken.
Im Korridor hing der Rest eines dumpfen Parfums. Die Rezeption war leer und ringsum niemand zu sehen. Dennoch schien jemand da zu sein, dessen Anwesenheit so diffus war, dass ich sie unbedenklich zur Kenntnis nahm. Eine Weile betrachtete ich die Papierlaternen, die an der Decke hingen, und wunderte mich über die Stille.
Die Frau im hellgrünen Kittel, die einen Küchenwagen um die Ecke schob, grüßte mit flüchtigem Nicken. Ich ging ein paar Schritte hinter ihr her.
»Wo finde ich Frau Blohm?«
Als sie stehenblieb und mich ansah, tat es mir leid, sie aufzuhalten. Sie hatte Schatten unter den Augen und ein müdes, farbloses Gesicht. Ihr Blick schwankte zwischen Güte und Ungeduld. Das Namensschild an ihrem Kittel verriet Ariana Delic.
»Oben. Pflegestation.« Sie deutete auf den Aufzug, wartete, bis ich in der Kabine stand, und drückte von außen die Taste 3. Mit einem Schleifen schloss sich die Tür. Ich starrte auf den zerkratzten Klappsitz an der Fahrstuhlwand.
In der dritten Etage schob ein schlurfender Mann seinen Rollator über den Gang. Eine Frau im Rollstuhl schimpfte, weil ihr der Mann nicht auswich. Aus einem Zimmer drangen Stimmen. Schwesternzimmer stand auf der angelehnten Tür. Im selben Moment, in dem ich anklopfen wollte, kam eine Frau mit blondierter Hochsteckfrisur heraus. Sie war fast einen Kopf größer als ich.
»Ich suche Frau Blohm.«
»Das bin ich.«
Beatrice Blohm. Jeder trug hier ein Namensschild. Das Blut stieg mir in die Wangen.
Sie bot mir das Du an und gab mir die Hand. Mit kräftigen Schritten ging sie voraus und führte mich an Wäschewagen und Zimmertüren vorbei ans Ende des Korridors. Es war der achtzehnte Oktober um neun Uhr, eine Stunde, bevor die Verwirrungen begannen, ohne die ein besseres Ende vielleicht noch möglich gewesen wäre.
Wir erreichten einen Raum mit Dachschrägen und einem schiefen Blumenbild an der Wand. Hier saßen zehn demente Senioren, neun Frauen und ein Mann, an einem langen Tisch. Vom Frühstück bis zum Mittagessen, vom Kaffeetrinken bis zum Abendessen. Jeden Tag.
Langsam ging ich um den Tisch herum und begrüßte alle nacheinander. Warme Handflächen, kalte, raue, zittrige, schweißige, schwache, zugreifende – alles spürte ich da. Müde, traurige, fragende, freundliche, resignierte Augen richteten sich auf mich. Die Namen würde ich rasch lernen. Bei den Rollstuhlfahrern waren sie unterhalb der Armlehne notiert, und die einzige Person ohne Rollstuhl war eine Frau, die von ihrer Tischnachbarin »die junge Alte« genannt wurde, wohl wegen ihrer kecken Lockenfrisur.
Die ersten Arbeitsabläufe, die Beatrice mir erklärte, ergaben sich aus der Situation. Ich desinfizierte meine Hände. Räumte leere Teller und Tassen ab. Füllte Wasserbecher nach. Lernte, dass nicht jeder einen Teller, auf dem nur noch ein Klacks Marmelade klebte, als leer ansah. Lehnte dankend ab, als man mir ein angebissenes Brötchen anbot. Suchte eine Antwort auf Frau von Bercks Frage: »Was ist denn die Telefonnummer meiner Mutter?« und fand sie nicht.
Ich kratzte Essensreste von Tellern. Ließ benutztes Besteck in einen Eimer mit Wasser fallen. Schenkte Frau Bronner, die zuletzt dazukam, den Kaffee ein. Putzte Herrn Carow Honig vom Kinn. Hob seinen Löffel vom Boden auf und holte einen neuen. Wischte die Plastiktischdecke ab.
»Bald zehn, gell?« Viele Male am Tag rief Frau Ehmann die Uhrzeit aus, und sie irrte sich nie. Bis heute höre ich ihre heisere Stimme. Vielleicht wird der Zeitpunkt
Mittwoch, zehn Uhr für mich immer damit verbunden sein, mit Frau Ehmanns Ausrufen und meinen eigenen verstohlenen Blicken zum Zifferblatt über der Tür.
Die Uhrzeiger im Ostbergstift bewegten sich langsam. Sie schlichen von Zahl zu Zahl, als wäre es etwas Verbotenes oder etwas, das ein Geheimnis bleiben sollte. Dabei erwarteten viele Bewohner voller Sehnsucht das Ende des Tages, manche auch das des Lebens. Es war ein tragischer Widerspruch, den es nur selten aufzulösen gelang.
Am Ende des Korridors gab es noch mehr. Ich mochte die Schranktüren an der linken Wand, weil sie bei jedem Öffnen und Schließen knarrten und quietschten. Beatrice zeigte mir alles Notwendige. Als sie die dritte Schranktür schloss, war es fast zehn Uhr.
Von der Mitte des Flurs kam ein Poltern. Ich drehte mich um.
Eine Frau mit Clownsnase stand am Treppenabsatz. Mittelgroß, Mittvierzigerin. Schwarzer Filzhut, dunkler Zopf. Kräftige Augenbrauen. Arztkittel, mit bunten Motiven bemalt. Rotweiß gestreiftes Shirt. Zu weite schwarze Hose mit Trägern. Ein grüner Schuh, ein blauer. Großer altmodischer Lederkoffer.
Ein surreales Gefühl erfasste mich, ein innerer Aufruhr wie nach zu starkem Kaffee. Meine Erinnerung an diese Sekunden gibt nur Fragmente preis: den knappen Wortwechsel zwischen ihr und Beatrice, die ernste Miene unter dem Hut und einen Blick, der meinem auswich – auch dann noch, als Beatrice in ihrem Büro den Laufzettel für die Clownin suchte und mich mit ihr allein ließ, die zu Boden blickte, obwohl wir einander gegenüberstanden.
Ich ging einen Schritt auf sie zu und gab ihr die Hand.
Da erkannte ich sie.
Die Frau aus dem Fachwerkhaus.
»Arnd Weyden. Ich glaube, wir kennen uns schon?«
Versteckte Resignation sprach aus ihrem Blick. Vor allem aber: Ernst. Nichts Plauderndes, Nettes, Gefälliges. Ich wunderte mich über die Anspannung, die von ihr ausging und die sie mit gespielter Souveränität zu kaschieren versuchte.
»Ehrenamtlich hier?« Sie deutete auf meine Alltagskleidung. Ein Hauch Zigarettenrauch streifte mich.
»Nur aus Egoismus. Zum Ausgleich für meine Arbeit.«
Ihre Mimik blieb unverändert. »Was arbeiten Sie?«
»Ich berate Menschen in kritischen Lebenslagen. Oder in Situationen, die ihnen so vorkommen.«
»Sind Sie aus Tiefenwald?«
Ich bejahte, ohne ihren Gedankensprung zu verstehen. Offenbar hatte sie mich nicht erkannt. »Eigentlich bin ich aus Norddeutschland.«
»Aha, ein Muschelschubser.«
Ich lachte. »Woher kommen Sie?«
»Von zu Hause.«
Wie auch immer ich sie jetzt ansah – etwas veränderte sich.
»Entschuldigen Sie. Als Clownin muss ich so sein. Das dürfen Sie nicht so ernst nehmen.«
Sie richtete sich wieder auf, etwas gerader als vorher. »Ich komme aus dem Finanzbereich«, sagte sie leise mit rollendem R.
Zum Nachfragen war keine Gelegenheit, denn Beatrice kam zurück. Sie gab der Frau einen Laufzettel mit Zimmernummern und den Namen der Bewohner, denen sie Einzelbesuche abstatten sollte.
Ich ging zu den zehn Senioren zurück. Doch meine Aufmerksamkeit blieb im Flur, auch dann noch, als niemand mehr dort war. Sie folgte den Schritten der Clownin, begleitete sie über die Treppe zu den unteren Etagen und in die Bewohnerzimmer hinein. Erst nach einer Weile schaffte ich es, mich wieder auf die Runde am Tisch zu konzentrieren.
Um elf Uhr klang eine Frauenstimme durch den Flur. »Ja, hallooo …« Die Clownin erschien in der Tür. Sie kratzte sich am Kopf und betrat mit übertrieben tollpatschigen Schritten und gebeugter Haltung den Raum, wo sie den Koffer in eine Ecke stellte.
Bei Herrn Carow machte sie Halt, hockte sich neben ihn und wartete ab. Er war ein ruhiger, freundlicher Herr von fast hundert Jahren, der jeden für ihn getätigten Handgriff mit dem Ausruf »Danke« quittierte. Sein trüber, müder Blick glitt über die Clownin hinweg. »So schöne Augen. So eine schöne Frau«, murmelte er.
Читать дальше