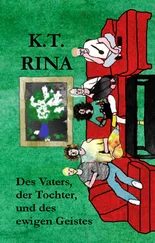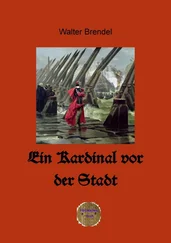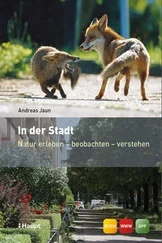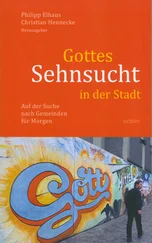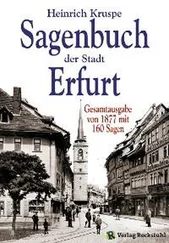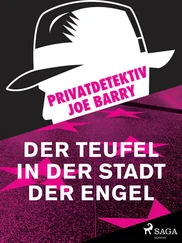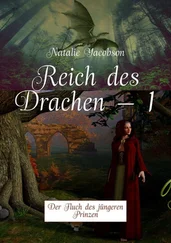1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Die Bildsprache der Symbole übermittelt emotionale, mentale und soziale Bedeutungen, von denen Menschen über den sachlichen Gegenstand hinaus ergriffen und fasziniert werden. Durch sie dringt etwas Unendliches in das endliche Leben ein. Das entsprechende Vertrauen hat einen irrationalen Kern. Vertrauen ist nicht Gewissheit, aber die Gestalten, wenn sie als „hilfreiche Monster“ erscheinen, können ein entspanntes Verhältnis zu den Unsicherheiten des Lebens aufkommen lassen. So können Symbole bei der Bewältigung existenzieller Lebenssituationen helfen, wenn sie mit Potenzialen der Psyche korrespondieren und wenn sich die mentalen Modelle im Innen und die physischen Strukturen im Außen in Einklang bringen lassen.
Selbstsymbole können hilfreiche und identitätsstiftende Symbole für das einmalige Individuum sein, das jeder Mensch ist. Symbole in der Stadt können als Ausdruck für „das Richtige“, für Nachhaltigkeit, für Zukunftsfähigkeit, für die Hingabe an das Leben, für Dauer und Beständigkeit, für Mut, für Lebensfreude, für Vergänglichkeit und Verwandlung stehen.
Ein Symbol für deutsch-türkische Freundschaft sollte seinerzeit der Pamukkale-Brunnen im Görlitzer Park in Berlin werden. Er wurde aufgrund baukonstruktiver Mängel abgerissen, ohne dass er jemals recht in Betrieb gegangen war. In einer Stadt können Symbole wie dieser Brunnen die Bindung und Verbindung der Bevölkerung bewirken. Sie reduzieren den Angstlevel durch Dinge, die von den Bewohnern geliebt werden. Für wen solche Symbole einen positiven Bezug und Bedeutung haben, für den sind sie auch identitätsstiftend. Je mehr Menschen etwas mit der Botschaft eines Symbols anfangen können, desto mehr Anziehungskraft entwickelt das Symbol. Der Abriss des Brunnens ist nunmehr ein Symbol für das Gegenteil, für eine Ablehnung, für die Äußerung des „Nichtgewolltseins“, auch wenn der Grund des Abrisses ein technischer und kein ideologischer gewesen ist.
Symbole als Gefühlspartner und Identitätsstifter zu entdecken, heißt für die Verantwortlichen, ein Symbolverständnis zu entwickeln, das Verantwortung für die Symbole als kulturprägende Reflexions- und Projektionsfläche im öffentlichen Raum übernimmt. In den Orten und bei Objekten, die sich als Projektionsflächen eignen, indem sie die Gemeinsamkeiten zwischen Menschen hervorrufen und wo Menschen sich selbst wiederfinden, lebt die Stadt. Daraus bezieht sie ihre Identität. Vor diesem Hintergrund dürfte der Abriss von Gebäuden, in denen legendäre Veranstaltungen stattgefunden haben, nicht vorrangig mit der Begründung erfolgen, dass diese Gebäude nicht mehr zeitgemäß seien. Das gilt zum Beispiel für den Abriss des Sportpalastes in Berlin, in dem Goebbels seine Rede hielt, die mit dem Aufruf zum „totalen Krieg“ und einer Hysterie der Teilnehmer endete, eine Emotionalität, die heute ohne dieses Raumgefühl kaum mehr glaubhaft erscheint. Das gilt auch für das langsame Verschwinden des Palastes der Republik und für das schnelle Verschwinden der Mauer , die Berlin geteilt hat. Das Entsetzen für solche Geschehnisse hat keinen Ort mehr.
Zur Begrifflichkeit der Symbole
Symbole sind bedeutungsvolle Zeichen — Zeichen, die über einen Bedeutungsüberschuss verfügen. Sie repräsentieren eine Ganzheit von etwas Auseinandergerissenem, so wie es der griechische Ursprung des Begriffs „ symballein — zusammenfügen“ zum Ausdruck bringt.
Der Bedeutungshorizont des Begriffs ist vielgestaltiger, reichhaltiger und umfassender, als es der allgemeine Sprachgebrauch annimmt. Ein Verkehrszeichen vermittelt seine Bedeutung konkret und eindimensional, selten lösen Verkehrszeichen Emotionen aus, höchstens, wenn jemand ein solches Zeichen als „ungerecht“ empfindet. Da gibt es aber keinen reichhaltigen Bedeutungsüberschuss und es darf ihn im Sinne eines fließenden Verkehrs auch nicht geben.
Sofern die Umwelt als Zeichensystem gelesen wird, geben die Dinge der Umwelt als Zeichen Aufschluss über die semantische, syntaktische und pragmatische Weise, in der sie funktionieren. Unter dem syntaktischen Aspekt zeigen sie sich in der Weise, wie sie zueinanderpassen, unter dem pragmatischen zeigen sie ihre Handhabung und unter dem Blickwinkel ihrer Bedeutung — semantisch/symbolisch — geht es um eben dieses „Mehr“ und „Darüber hinaus“.
Symbole sind Mittler und Vermittler von mehrschichtigen bis hin zu widersprüchlichen Bedeutungen. Sie sind „Versprechen“ auf etwas anderes. Sie sind Dolmetscher, aber ohne das, was sie vermitteln, zu erklären. Sie sind vergleichbar mit Brücken in eigene innere psychische Räume. Im psychoanalytischen und -therapeutischen Gebrauch sind sie allgegenwärtig.
5.000 Symbole erläutert Sven Frotscher, und er konstatiert ein enormes Interesse an diesem Begriff in den verschiedenen Fachdisziplinen. Er stellt eine Übersicht von Definitionen bzw. Klassifikationen zusammen, die belegen, wie sehr sich dieser vieldeutige Begriff in den Fachdisziplinen unterscheidet und sich dadurch der Definition entzieht (Frotscher, 2006). In seiner Übersicht anhand der Fachdisziplinen und ausgewählter Vertreter lässt er Architektur, Bauwesen und Baugeschichte allerdings außer Acht. Dabei verdichtet sich gerade in der Formensprache der Bauwerke und in der Stadtgestalt die Komplexität der Realität zur symbolischen Qualität. Jedes Bauwerk, jedes Objekt kann für jemanden zum Symbol werden, die Kirche wie das Tor, das Haus wie das Bett — der Turm, die Brücke, die Schwelle, der Baum können als Symbole zum Beispiel für den Körper, für einen Übergang, für das Leben dienen.
Bei einem engen Symbolbegriff sind Bild, Zeichen und Bedeutung im Sinne einer Entsprechung „pragmatisch“ eng miteinander verbunden, wie das z.B. bei Flaggen oder Wappen der Fall ist. Auch hier gibt es einen Bedeutungsüberschuss, der aber erläutert und begründet werden kann.
Als Beispiel kann die amerikanische Flagge dienen: Vor den letzten Präsidentschaftswahlen verteilten amerikanische Wissenschaftler Online-Formulare, in denen Menschen ihre Wahlabsichten angeben sollten. Auf einigen Fragebögen war eine kleine amerikanische Flagge abgebildet. Jene Versuchsteilnehmer, die Formulare mit der Flagge erhielten, gaben darauf häufiger an, für die Republikaner stimmen zu wollen. Sie taten das bei der Wahl tatsächlich ... (DER SPIEGEL, 29/2011). Die Betrachtung der amerikanischen Flagge hat womöglich Menschen dazu motiviert, die republikanische Partei zu wählen.
In einer weiten Fassung des Begriffs meint „Symbol“ den bildhaften Ausdruck von etwas anderem, das nicht unmittelbar anschaulich im Bild des Objektes mitschwingt. Es ist eben mehr als das Bild der Handhabung des Gegenstandes und seiner augenfälligen Bedeutung. Der weite Begriff ist vieldeutig, er kann selbst Gegensätzliches im Symbol zusammenführen, und der davon Berührte erfährt es gefühlsmäßig. Der Deutende erschließt den Sinn durch seine eigenen Assoziationen und die Auswahl von Bedeutungen, die ihm zur Verfügung steht, d.h. sein Wissen darüber. Symbolik in dieser Form ist Teil des geistigen Gesamterbes der Menschheit, das universale Vorstellungen im zeitgenössischen Objekt zum Ausdruck bringt.
Die Farbe Rot dient zum Beispiel als Symbol der Macht und kann als Farbe des Blutes Wärme und Geborgenheit, oder aber Gewalt zum Ausdruck bringen. Der Selbstdarstellung eines „Stars“ findet auf einem „roten Teppich“ statt. Eine reale rote Textilie liegt dem Auftritt im wahrsten Sinne des Wortes zugrunde. Das kostbare Rot hat seine Ursache im einst so wertvollen Drüsensekret der Purpurschnecke, das im Mittelalter für Kaiser, Könige und Kirche reserviert war. Liebe, Macht und Blut lassen sich auf einem Teppich assoziieren, der Menschen in Szene setzt, der ihnen einen Auftritt verschafft, durch den sie gesehen werden und „Aufmerksamkeitskapital“ anhäufen können.
Читать дальше