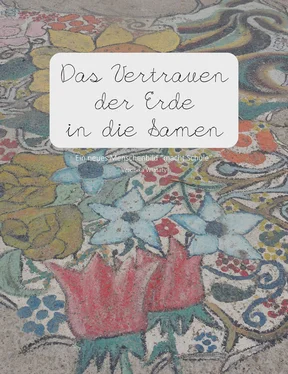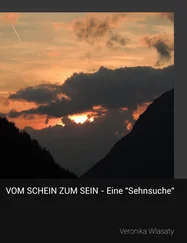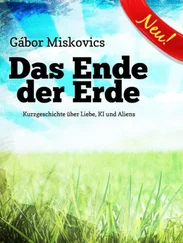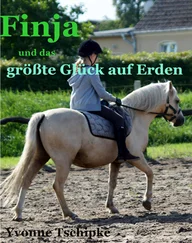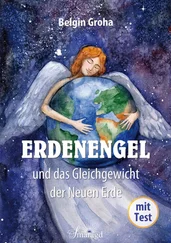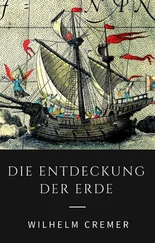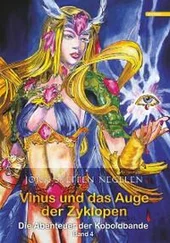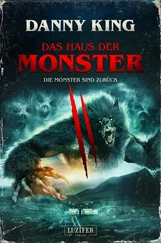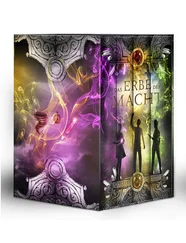Machen wir einmal ein Gedankenexperiment: Stellen wir uns die Welt vor, wie sie wäre als gerechter, für alle Menschen lebenswerter Ort. Was macht diese Vorstellung mit uns, wie fühlt sie sich an? Ist da etwas spürbar, wo wir verweilen möchten, ein Gefühl, in das wir tiefer eintauchen möchten? Etwas, das die Sehnsucht nach einer heilen Welt in uns zum Klingen bringt, ein stillgelegtes Ideal, das, unserer Jugend „vorbehalten“, nicht mit uns erwachsen werden durfte? So sind wir in vielerlei Hinsicht ärmer geworden und unser Nachlass ist nicht begehrenswert für die, die nach uns kommen. Aber… – was wäre, wenn diese lebenswerte Welt, oft abgetan als naive Phantasie weltentrückter Träumer und schwärmerischer Idealisten, real existent sein könnte? Was hindert uns, diese beste Welt aller uns möglichen Vorstellungen, das „World-best-practice-Modell“ sozusagen, aus dem virtuellen Bereich unserer Gedankenwelt in die Realität zu transferieren, in dem Wissen, dass es, zumindest was den Realitätstransfer betrifft, jede Menge (freilich nicht immer nachahmenswerter) Präzedenzfälle gibt? Wie würden wir beispielsweise heute den Atlantik überqueren, hätte es nicht Menschen gegeben, die die Vision vom Fliegen in die Wirklichkeit „geträumt“ hätten. Vieles von dem, was heute als selbstverständlich und alltäglich gehandelt wird, verdanken wir den einst als utopisch betrachteten Visionen unbeirrbarer Anders- und Querdenker (dass jeder Fortschritt auch eine weniger erbauliche Kehrseite hat, ist leider ebenso wahr).
So wie ein Wunsch erst durch ein konkretes Ziel erreichbar wird, muss sich das, was als Traum beginnt, kraft innerer Bilder zur Vision verwandeln, um die Grenze zwischen virtuellem Raum und Realität überwinden zu können. Genau hierin liegt die Möglichkeit und Macht des einzelnen, die sich im Kollektiv noch einmal kraftvoller bündelt. Wir sind allein nicht machtlos – es sei denn, wir glauben daran und verzichten damit auf unseren Anspruch, diese Welt mitzugestalten.
Kein Fortschritt ohne Visionen
„Nichts auf der Welt ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“ Victor Hugo
Visionen…
...sehen und denken noch nicht Sichtbares
...sind Ausdruck innerer Freiheit und Unabhängigkeit
...transformieren alte und manifestieren neue Realitäten
...inspirieren und beflügeln
...lassen Menschen über sich hinauswachsen
...öffnen Türen, wo wir keine vermuten
...eröffnen Potentiale, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen
...schließen Vernunft und Verstand nicht aus, erheben sich jedoch weit über diese hinaus.
...weisen einen möglichen Weg in eine lebenswertere Zukunft
Gute Visionen dienen dem Individuum und dem Gemeinwohl. Ich plädiere dafür, dass wir einander konkurrenzfrei, über Parteiinteressen und andere Begrenzungen hinaus bei der Entwicklung solcher Visionen unterstützen. Konkurrenzfreiheit, Verzicht auf Vergleich und dadurch auf Bewertung widerspricht dem gegenwärtigen, neoliberalen Zeitgeist, der auch unser Schulsystem prägt. Lernen und Leistung, die sich ausschließlich dem Wettbewerb und der Profitmaximierung verschreiben, kommen weitgehend ohne Vision aus und züchten „menschliche Bonsais“ heran – eine Metapher für das Beschneiden und Zurechtstutzen persönlicher Eigen-Art und des jedem Individuum innewohnenden, einzigartigen Potentials, das naturgemäß zur Entfaltung drängt, wo man es zulässt. Eine sozialisierende Institution wie Schule, die den Anspruch hat, auf das Leben vorzubereiten, sollte diese Entfaltung fördern. Noch fehlt mir in unserem Schulsystem allzu oft dieser Blick auf die Einzigartigkeit seiner Mitglieder, noch wird allzu vielen allzu oft vermittelt, nicht zu genügen. Eine Erwartung an die Schule ist, dass sie eine spätere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermögliche. Die Auffassung, dass diese Teilhabe nur über eine gelingende Eingliederung in den leistungs- und wettbewerbsorientierten Arbeitsprozess erreichbar ist, bedarf meines Erachtens einer kritischen Betrachtung. Konkurrenz bedeutet immer auch Leistungsdruck. Die Freude am Tun braucht weder noch. Wir alle hatten in unserem Leben schon des Öfteren dieses so genannte Flow-Erleben, das meist mit kindlichem Spiel assoziiert wird. Dieses Einswerden mit dem, was ich tue, das mich als Ganzes gefangen nimmt, das mich im Einklang sein lässt mit meinem innersten Wesenskern, entbehrt jedes Leistungsdenkens und steht dennoch nicht im Widerspruch dazu. Denn wann und wo ist unsere individuelle Schaffenskraft und Bereitschaft zu persönlicher Höchstleistung größer als in solch magischen Momenten, in denen wir mit unseren ureigensten Stärken und Interessen in Verbindung sind? Eine Schule und im weiteren eine Gesellschaft, die den ganzen Menschen im Blick haben will, muss für Bedingungen sorgen, die nicht den Druck, sondern den Leistungswillen oder besser noch die Freude am (Er-)Schaffen erhöhen. Die Aussage, dass jeder von uns etwas gut kann, darf nicht zur Floskel verkommen, sondern muss auch im Schulsystem gebührend Beachtung finden. Jeder Schüler muss auf seine Weise gut sein dürfen. Es geht nicht darum, einander zu übertreffen oder auszustechen, sondern darum, das zu werden und zu leben, worin unsere einzigartige Bestimmung liegt. Eine Schule, die dem Rechnung tragen möchte, wird ohne Visionen nicht auskommen.
„Kritik sollte eine Funktion von Liebe sein oder es wäre besser sie zu unterlassen.“ E. Freitag
Der Begriff „Defizit“ suggeriert, dass etwas sein sollte, was nicht ist – oder zu wenig davon, d. h. ein Mangel von etwas Erwünschtem oder Erwartetem. (Was das ist, darüber gibt es in der Regel einen gesellschaftlichen Konsens, der freilich einem Wandel der Zeit und ihrer Erfordernisse unterliegt.) Wird etwas, oder schlimmer jemand als defizitär betrachtet, verheißt das nichts Gutes für den Betreffenden, vor allem wenn er Schüler ist. Ein Defizit zu haben, bedeutet aus der Norm zu fallen, etwas „schuldig“ zu bleiben, über etwas nicht zu verfügen, das allgemein als wichtig erachtet wird. Man (Lehrer, Eltern, Gesellschaft…) macht es sich zur Aufgabe (oft gegen den Willen der Betroffenen), Defizite vor allem durch Maßnahmen der „Förderung“ zu beheben. Ist der Erfolg bescheiden und bleibt unter dem Erwarteten zurück, macht sich auf allen Seiten Enttäuschung breit: bei den Geförderten, die selbst bei größter Kooperationsbereitschaft oft bald an ihre Grenzen stoßen und sich als Versager wähnen, sowie bei den Förderern – wohl aus genau denselben Gründen. Da überdies meist weitaus mehr Zeit in die Behebung von mangelhaft ausgebildeten, als Schwächen bewerteten Fertigkeiten investiert wird als in die Förderung von dem, was gut beherrscht wird, die sogenannten Stärken, können sich letztere nicht oder nur unzureichend in dem Maß entwickeln, das ihnen zu eigen wäre. Vor allem dann, wenn diese nicht als „systemrelevant“ (d. h. der Gesellschaft bzw. Wirtschaft dienlich) bewertet werden, ist ihnen ein Aufschub auf später oder eine „Auslagerung“ in die Freizeit (bestenfalls noch in ein Freifach) bestimmt.
Aber nicht unsere Schwächen, unsere Stärken sind es, auf die wir unser Leben gründen. (Gäbe es überhaupt eine Fähigkeit, deren Erwerb allgemein verbindlich sein sollte, dann die, mit sogenannten Schwächen umzugehen und mit ihnen gut leben zu lernen.) In den seltensten Fällen wird jemand im späteren Leben eine Laufbahn einschlagen, die ihm Fertigkeiten abverlangt, über die er nicht (ausreichend) verfügt – und wenn doch, dann wird er Mittel und Wege finden, diese zu kompensieren. (So soll es angesehene Schriftsteller geben, die trotz ausgeprägter Rechtschreibschwäche – früher als Legasthenie bekannt – gut vom Schreiben leben können.) Deshalb sollte es unsere höchste Priorität sein, jeden Schüler dahin zu begleiten, dass er am Ende der Schulzeit um seine persönlichen Fähigkeiten weiß und diese auch ressourcenvoll nutzen kann. Da Begabungen äußerst vielfältig und nicht vergleichbar sind, sondern einander ergänzen, und vor allem immer der jeweilige Kontext über deren Nützlichkeit entscheidet, wäre genau genommen jede Form von Bewertung hinfällig. Eine Fähigkeit wäre eine Fähigkeit, jede Polarisierung und Kategorisierung in Stärken und Schwächen würde sich erübrigen.
Читать дальше