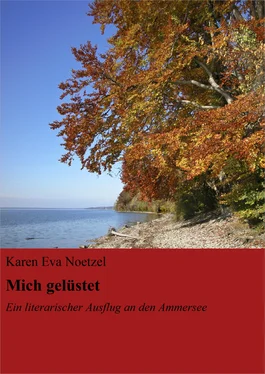HEINRICH BLENDINGER Der vernachlässigte Stiefbruder
ZUM GELEIT
Es ist durchaus nicht die Absicht dieses Wanderbuches möglichst viele Fremde an den Ammersee zu locken. Möge unser See noch weiter der „vernachlässigte Stiefbruder“ des Starnbergersees sein, vernachlässigt von jenen lauten Sonntagsausflüglern, die ihre lärmende Unrast von der Stadt auf das Land tragen, vernachlässigt auch von der stilleren Klasse derer, die eine ländliche Gegend nur auf ihre materiellen Genüsse hin anschauen. Vielmehr denen möchte das Wanderbuch etwas geben, die sich selbst vergessen können mit all ihren kleinlichen Gedanken, wenn sie plötzlich die weite Seefläche vor sich hingebreitet sehen, wenn sie durch den Wald gehen oder in eine Kirche treten; jenen Großstädtern vor allem möchte es etwas geben, deren Seele hungert nach den grünen Farben der Wälder und Wiesen, der stahlblauen Farbe des Sees, die sich entwurzelt fühlen in der naturfremden Stadt, die sich hinaussehnen nach dem Bauernland, auf dem auch ihre Vorfahren einst wohnten und arbeiteten.
Es liegt uns hier nicht so sehr daran auf besonders augenfällige „Naturschönheiten“ aufmerksam zu machen als vielmehr ein geistiges Band herzustellen zwischen dem Wanderer und der Landschaft, zwischen dem Städter und dem Bauern, zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Und dann entdecken wir erst die eigentlichen Naturschönheiten. Denn das ist, um mit Rosegger zu reden, „eine Sache, die nicht so obenaufliegt, die erst entdeckt werden muß. Das Sinnliche allein ist dazu nicht genug, ein Sinnen gehört auch dazu.“
I. DER SEE. 1. Eindrücke und Bilder
Wasser und Land, das Flüssige und das Feste, dieser Urgegensatz gibt unserem Gebiet seinen Charakter, seinen eigenartigen Reiz.
Wir verspüren diesen Reiz in seiner ganzen Macht, wenn wir etwa auf einer Wanderung die letzte Moränenkette erstiegen haben und nun plötzlich diesse große dunkle Wassermasse unter uns liegen sehen. An einem heißen Sonntagnachmittag kommen wir an den See. Wie wimmelt es da am Strand von Menschen, die sich sonnen und baden! Jubelnd patschen die Kleinen in dem flachen Strandwasser herum, während einige Große sich weit in den See hinauswagen. Ein Dampfer landet am Steg, das Verdeck ist voll von Menschen. Mächtige Wellen erzeugen seine Schaufelräder. Fröhliche Burschen rudern mit ihren Kähnen mitten hinein in die Wellen, daß die Mädchen an ihrer Seite laut aufschreien; und zwischen den lauten Booten hindurch streicht still und rasch ein Segelboot. – Auf solch’ einem Segelboot lernt man erst den See in all seiner Schönheit kennen. Welch’ wunderbares Zusammenspiel von Naturkraft und Menschengeist und Menschenhand, welches Hineinfühlen, welches Sichanpassen des Seglers an Wind und Wasser! Noch nicht jene kalte, rücksichtslose Emanzipation von der Natur, wie sie der Dampfer oder das Motorboot zeigen, diese Symbole der Herrschaft des Menschen über die geknechtete Natur.
Oder wir fahren an einem warmen Sommerabend auf dem Kahn vom Lande ab. Über uns glitzern die ersten Sterne am schwarzblauen Himmel; im Nordosten ein heller Schein – das sind die Lichter von München. Und nun stiegt der Mond auf hinter Breitbrunn; er spiegelt sich in einem breiten silbernen Band, das immer länger hinauswächst in den See, je höher er steigt. Ein anderer Kahn fährt in diesem Lichtstreifen, an seinen Rudern glitzert es von silbernen Tropfen und deutlich klingt aus ihm ein schönes Lied zu uns über die stille Wasserfläche. –
Ein völlig anderes Bild an einem sturmbewegten Sonntag-Vormittag! Ein großes Segelboot durchschneidet die weißen Wellenkämme, eine Bö nach der andern jagt über den See, die Segel fast bis auf die Wasserfläche hinunterdrückend. Manches kenternde Boot hat da schon die Gefahren des Sees kennen lernen müssen. – Aber wirklich gefährlich wird der See erst, wenn plötzlich ein Gewitter ausbricht und die Segelboote kaum Zeit finden ihre Segel zu reffen. Da ist die Luft erfüllt von mächtigen Wasserstaubwirbeln, in denen Kahn und Segelboot nur bei sehr guter Führung sich durchzukämpfen vermögen.
Ein letztes Bild: Das unruhige Wasser ist gebannt unter einer starren Eisdecke. Die ganze Nacht dröhnt es hinauf ins Land, wenn sich die gewaltigen Spannungen im Eis entladen, kilometerlange Spalten „Lehnen“ aufreißend. Am Tage aber schnallt man sich die Schlittschuhe an und fährt hinüber ans andere Ufer, wenn auch manche, nur dünn wieder zugefrorene Eisspalten den Weg versperren wollen. Bei starkem Wind fahren auch Segelschlitten über die gefrorene Decke, ja selbst Radfahrer sind auf der leicht mit Schnee überzogenen Eisfläche zu sehen und in Strandnähe vergnügt man sich mit Eisschießen und Schlittenfahren. Wenn aber im März ein warmer Föhn von den Alpen herunterbraust, dann zerreißt die Decke in große Schollen und der Sturm treibt diese Schollen langsam gegen das Ufer mit einer zermalmenden Kraft, der oft nicht einmal die starken Pfähle der Dampferstege standzuhalten vermögen.
ERNST BLOCH Gedenken an Elsa
Mitte August: Es wird wieder Herbst und ich erinnere mich. Ich erinnere mich an den frühen Herbst vor einem Jahr, wie wir uns in Garmisch, dem vertrauten, wiederfanden und ich die Arbeit wieder lernte. Die Fremden waren fast schon weg, und von dem entsetzlich gewordenen Schieber-Kurort war nicht mehr viel zu sehen; mein altes Refugium, unser Garmisch, trat einmal, noch einmal hervor. Jetzt ist es auch damit aus; Frau Erdmann, die Besitzerin des Hauses, in dem wir stets gewohnt hatten, berichtete Trübes von der Entstellung der alten Idylle; - es ist gut so, ich werde nicht wieder hinziehen, wie ich zuerst, aus der Öde meiner Heimatlosigkeit, vorhatte; ich fange an, zu überleben, auch äußerlich pure „Damals“ zu haben, wie ein sehr alter Mann. –
Hier in Herrsching, wohin ich mich aus der Schlaflosigkeit Seeshaupts gerettet habe, und ich wenigstens meinen alten Kinderschlaf glücklich wieder fand, bin ich ganz allein, nachdem ich eine ungemäße Bekanntschaft abgestoßen habe und mich ekle vor der Trivialität der mir begegnenden Menschen. Auf einem sozusagen Gauklerball sah ich zu. Bei einigen Malerinnen trank ich Tee: das erinnerte mich etwas an Elses Münchner Leben, bevor ich sie kannte. Ich gehe umher wie ein alter
Mann, träume mich in den Tod hinein, bin unaufhörlich vom Tod, von Gesprächen mit Ihr umleuchtet; brausen die Wasser, die Feuerströme meiner Philosophie. „Herbstnebel wallen bläulich überm See“ – oft singe ich mir diese Melodie vor, aus Mahlers Lied von der Erde(11): Der Einsame im Herbst. Aber es war stets so: darüber, davon kann ich nicht traurig werden; konträr, schon als Knabe wanderte ich im Herbst über die Ebenen, am Rhein, glücklich über die Wolken, die gelbe Sonne, die kühle, tiefsinnige Luft. „Sonne der Liebe“, willst Du nie mehr scheinen?“ – nein, das will sie nicht mehr, allerdings nicht. Ich sehe dem Winter entgegen; will in diesem ein weiteres Stück meines Werks abarbeiten, ans Licht bringen, mein irdisches Pensum tun; ich fühle, meine Arbeitskraft wird nicht erlöschen, trotz schwerem seelischem Bedrohtsein; sie ist sehr groß, stark und aushaltend, wird mir bleiben bis zum letzten Donnerschlag. Dann: so tief und unerträglich zuweilen auch meine Depression ist, das Gefühl der kranken Überwachheit – fühle ich doch in diesem zur Zeit allzu verworrenen Zustand, in meinem allzu verlassenen Bewußtsein: mir kann nichts mehr zustoßen, die eine letzte Sekunde löst alles, und dann fühle ich mich auch wieder wie Kinder im Dezember, wenn sie an den Weihnachtsmann denken.
HELENE BÖHLAU Im Garten der Frau Maria Storm
Aus dem 3. Kapitel
Der See rauschte im frischen Wind Schaumwellenköpfchen auf. Das Gebirge stand leuchtend und strahlend in Sonnenherrlichkeit. Die Dörfer und einzelne Häuser am Seeufer waren eingebettet wie Kleinodien in grüner Emaille. Ein Funkeln und Strahlen. Die Herrlichkeit Gottes lag ausgebreitet vor jedermanns Augen, und alles Häßliche, Alltägliche war wie versunken, so wie es in einer Seele ist, in der der Stern des Lebens aufgegangen ist. In einer kleinen Bauernstube, nahe am Seeufer waren vier Wesen eifrig dabei, den kleinen Raum zu schmücken. Blumensträuße, grüne Maienzweige, und ein emsiges Huschen und eifriges Tun. Da war ein zartes feinknochiges Dirnlein mit einem Blumengesichtchen, zwei Buben Ottomar und Heinrich und ein Weiblein mit einer kleinen Stumpfnase, zwei Zöpfen um die Ohren gelegt, mager und gelenk wie ein Bub, ein Weiblein, das Kind, Bub und Weiblein war, nicht hübsch, ein wenig seltsam für den, der es zuerst gewahrte.
Читать дальше