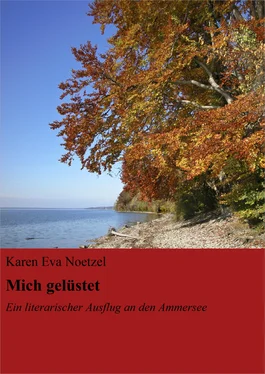Prinzessin halb, halb Zofe,
Ein reizend Wunderchen...
Wenn ich sie nur einmal reden hören könnte. Das Schwäbeln muß ... aber ich will schon wieder „allerliebst“ schreiben.
Wenn ich jetzt nicht so gewiß wüßte, daß ich frei bin, würd’ ich denken, ich wäre verliebt.
28. Juni.
Es regnet.
Wundervoll, dieses nasse Gespinst vom Himmel zur Erde. Man fühlt sich so sicher hiter dieser grauen Gardine.
Ganz leise rauscht sie, und in ihren Falten sind frische Gerüche. Es ist eine liebliche Musik zum Träumen.
29. Juni.
Sie hat eine Tante, und diese Tante ist dick. Sie hat einen Bruder, und das ist ein ungeschlachter Patron. Sie hat eine jüngere Schwester, und die ist passabel. Ihr Name aber ist sehr hübsch und lautet Brigitte.
Von wem ich das weiß? Von ihr weiß ich es.
Ich habe nämlich mit ihr gesprochen.
Mein Gott, ich bin ein älterer Herr...
Es kam aber so: Im Kloster war Schützenball, und ich sah nicht ein, warum ich nicht einem Schützenball in einem Kloster beiwohnen sollte. Es hat das unleugbar, etwas Merkwürdiges. In dem Saal, in dem er abgehalten wurde, haben die Väter Benediktiner ehemals ihr Coenaculum gehabt.
Es ist ein schöner, heller Raum mit großen hohen Fenstern, die auf den wundervollen Klostergarten hinausgehen. Ein italienisches Gemälde aus der Raffaelzeit, ganz angeschwärzt von Tabaksqualm, hängt dort. Es stellt die Fußwaschung dar, und Jesus Christus ist so pompös angezogen, daß man meinen möchte, sein irdischer Vater sei nicht ein Zimmermann gewesen zu Galiläa, sondern ein Zollpächter in Jerusalem. Die mächtigen Wirtstische, auf denen derbe Bauern- und Ackerbürgerfäuste emsig mit Maßkruglupf und anderen nicht eben heiligen Dingen beschäftigt sind, sind noch dieselben, von denen die Chorherren gespeist haben.
Also da ein Schützenball. Ein bißchen zu pseudohonoratiorenhaft, um wirklich lustig zu sein. Aber die kleine Braune, die hatte, was den anderen fehlte: Natur und Grazie.
Auch die Literatur des Ortes war vertreten: der Buchbindermeister und Redakteur des Lokalblattes, ein sehr schüchterner junger Mann, der beständig an seinem Halskragen rückte, als hege er die Sehnsucht, ihn mit der Schlipsseite auf den Nacken zu platzieren, und ein Rahmkäsegesicht hatte, - womit ich ihm nicht zu nahe treten will. Ich wüßte aber nicht, wie ich seinen Teint besser kennzeichnen sollte.
XXVII.
Herr Pankrazius Graunzer
Versucht, hinter sich selber herzu-
Gehen und die Aehren zu
lesen, die aus dem Breviario
Brigittae fallen, gibt es aber
Als unfruchtbar auf und er-
mannt sich statt dessen zu
einem wichtigen Entschlusse.
Ich glaube, wir befinden uns gegen Ende des Juli. Es ist eine himmlische Hitze, und die Sonennstrahlen quirlen die Luft, daß sie wies Wasser im Kloßtopfe wellt. Ich sitze gut auf meinem Balkon zwischen den Weinranken. Unten muht Gerschle-Pepis Kuh; ganz ferne, irgendwo, donnert’s, als wäre es des Kuhmuhs Echo; drüben auf Andechs blitzt ein Fenster in der Sonne.
Sitzt wohl ein kluger, alter Benediktiner dahinter und sinniert behaglich in die Landschaft hinab und denkt sich: Schabt mir die Glatze!
Gestern war ich drüben.
Was das schön war!
Erstens, weil’s überhaupt schön ist, und zweitens, weil ich mein Brevier mithatte.
Ich lese sonst nicht gerne draußen. Nur den Vogelweiden-Walther und das Brevier – die beiden können die Konkurrenz der Natur aushalten. Denn sie sind selbst Natur.
HEINRICH BLENDINGER Vom Fischreichtum
Nicht die Schönheit des Sees lockte die ersten Siedler hierher, sondern sein Fischreichtum, und noch heute spielt der Fischfang im Leben der Seedörfer eine solche Rolle, daß wir etwas Wesentliches auslassen würden, wenn wir davon nicht erzählten.
Der wichtigste Fisch des Sees ist der Renken (Blaufelchen). Um ihn zu fangen, senkt man eine Reihe zusammengehängter feinmaschinger Netze „Segen“ (lat. sagena) ein. Die Holzstücke, an denen die Netzenden hänge, sorgen dafür, daß diese Netze nicht untergehen; sie hängen also wie ein langes Gitter tief in das Wasser hinunter. In der Nacht „gehen dann die Renken an“, sie kommen vom Grund herauf, stoßen mit dem Kopf in die feinen Maschen und können sich nun nicht mehr loslösen. Im Morgengrauen zieht dann der Fischer die Netze ein, wenn er nicht fluchend feststellen muß, daß sie durch eine Strömung weit vertragen oder ineinander verfilzt sind. Das tritt dann ein, wenn „der See rinnt“. Es handelt sich da um Strömungen im Wasser, oft gegen den Wind, oft auch bei völliger Windstille. – Eine zweite Hauptform der Fischerei ist das Setzen von „Däsern“. Manchem Kahnfahrer sind sich schon Stellen in der Nähe des Seeufers aufgefallen, die einen Haufen Reisig zeigen. Das sind die „Däser“ (wohl = Dachsen, schwäb. Daas, das heißt Reisigzweige). In einen durch eigetriebene Stangen gebildeten Kreis wirft man das Reisig hinein, dessen Gewirr die Fische gerne aufsuchen. Nach einiger Zeit wird dann das „Dos ausgestoßen“. Man setzt rings um die Stangen ein Jagnetz und sticht in das Reisig hinein um die Fische in das Netz zu treiben. Oder man zieht die Zweige heraus und setzt an ihre Stelle Reusen in den Kreis hinein. Das sind zylinderförmige Fangnetze mit drei nach innen eingestülpten Öffnungen, den sogenannten Aberhacken. Die Fische, die nun ihre Deckung im Reisig verloren haben, schlüpfen in jene Reusen hinein. Auf diese Weise fängt man mehr die kleineren Fische, Bürschlinge, Rüßlinge, Saiblinge und Lauben, aber auch die größeren Nerflinge.
Die großen Raubfische werden vor allem im Frühjahr in der Laichzeit gejagt. Durch das Laichen ermüdet oder ganz davon in Anspruch genommen, stehen sie da unbeweglich im Wasser. Das geübte Auge des Fischers erkennt solche ruhenden Fische oft noch 3–4 m unter dem Wasserspiegel. Leise umstellt er nun den Fisch mit einem Jagnetz und schreckt ihn dann durch Hineinstoßen mit einer Stange aus seiner Ruhe auf. Diese Fangart gilt vor allem dem großen, silbergrauen, bis zu 15 kg schweren Amaul oder Zander, der besonders an dem Höhenrand zwischen Stegen und Buch „bei den weißen Bergen“ „auf dem Bruch steht“, oft auch zwischen den Nagelfluhfelsen von Ried am Nordende der Herrschinger Bucht. Den Hecht jagt man gern in ein am Schilfrand ausgesetztes Netz hinein, wenn man ihn außen in der Nähe des Schilfes stehen sieht. Auf diese Weise werden auch die guten, freilich recht grätenreichen Brachsen und die bis zu 20 kg schweren Karpfen gefangen.
Am interessantesten ist gewiß die Eisfischerei. Da handelt es sich um das Kunststück, die 260 m lange „Eissegen“ unter das Eis zu bringen und auseinander zu falten. Eines Tages erscheinen etwa 16 Fischer, z.B. die von Schondorf und Breitbrunn auf dem See. Auf einem Schlitten ziehen sie das große Netz hinter sich her. Nach uralter Sitte wird vor dem ersten Fischfang ein kurzes Gebet gesprochen. Nun wird in einiger Entfernung vom Ufer ein Loch in das Eis geschlagen, das sogenannte Setzloch. Dieses Setzloch dient zum Einführen des Netzes in das Wasser. Näher dem Ufer zu wird ein zweites Loch geschlagen, das Fangloch, aus dem dann später das Netz wieder herausgehoben wird. Die beiden Löcher stellen etwa die Endpunkte eines Kreisdurchmessers dar. Auf der Kreislinie werden nun in Abständen von je 22 Schritt kleinere Löcher mit der Axt eingeschlagen. Doch stellt das Ganze nicht einen regelrechten Kreis dar, vielmehr geht es zunächst von dem Setzloch ganz gerade nach rechts und links bis zu den „Reiblöchern“, wo dann die Reibung, das heißt die Umbiegung gegen das Fangloch beginnt. Das Netz ist nun im Setzloch eingeführt. Es hat an seinen beiden Enden je ein Tau von 150 m Länge. An jedem Tauende ist wieder eine Stange befestigt. Diese Stangen werden nun nach beiden Seiten von Loch zu Loch unter dem Eis gestoßen, damit also auch die Taue, an denen das Netz hängt. So kann sich das Netz schön auseinanderfalten, bis es ein langes vom rechten bis zum linken Reibloch reichendes Gitter darstellt. Dann biegen beide Netzenden, gezogen von den Tauen, ein und so geht es immer enger zusammen von Loch zu Loch, bis die Stangen mit den Tauen von beiden Seiten her im Fangloch anlangen. Vor dem Fangloch wird in einen Eiseinschnitt, das „Guksloch“, noch die „Färhel“ eingelassen, damit den Fischen auch der Ausweg nach dem Ufer versperrt ist. Nun kann das Herausziehen des Netzes beginnen. Je weiter es herauskommt, desto mehr werden die eingekreisten Fische gegen die Mitte des Netzes zusammengedrängt, an dem eine Art Sack angebracht ist, „der Bär“, in den die Fische leicht hinein, aber nur schwer wieder heraus können. Darin wimmelt es dann in der Regel von Fischen; viel kleines Zeug ist darunter, das sie wieder ins Wasser werfen, aber es finden sich auch schöne Brachsen und Renken, oft sogar ein mächtiger Hecht und schwere Karpfen. Ein guter Zug bringt etwa 12 Zentner, ein Durchschnittszug 70–80 Pfund. Im Jahr 1917 wurden vor Wartaweil einmal 72 Zentner herausgeholt! Überhaupt ist der südliche „Obersee“ noch fischreicher als der nördliche Untersee. Dort gibt es viel mehr Brachsen, dort wird auch der in der Tiefe lebende Kropffelchen oder Kilch gefangen. Während nun beim Herausholen des Bärs alles neugierig das Fangloch umsteht, ziehen manchmal ein paar Fischer ein Seil um die Leute und sprechen: „Wir schnüren auf Grafen und Fürsten, weils uns Fischer tut alleweil dürsten. Ist das Trinkgeld groß oder klein, wir Fischer werden stets zufrieden sein.“ Mit einem kleinen Trinkgeld wird man dann wieder von dem Banne gelöst. Das ist ein alter Brauch der Fischerzunft, zu der etwa 40 Fischer am See gehören. – Das Fischrecht besitzt ja der Staat. Aber der hat es an diese 40 verpachtet, vielmehr an bestimmte Häuser, denn das Fischrecht liegt auf dem Haus, nicht auf den Personen. Am Peter- und Paultag (29. Juni) hält die Fischerzunft ihren Jahrtag in Diessen ab. Früh geht’s hin zur Johannes-Kirche, am Nachmittag wird der „Peterstag“ tüchtig durch Essen und Trinken gefeiert.
Читать дальше