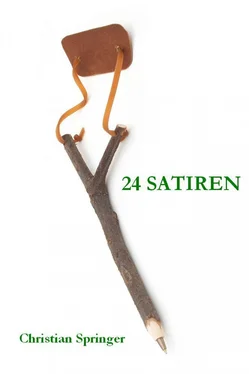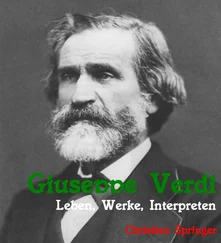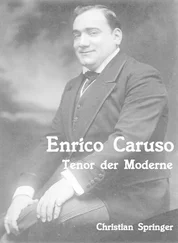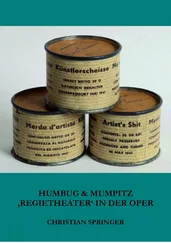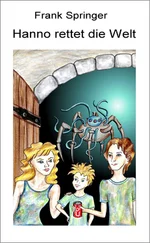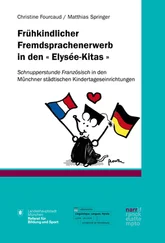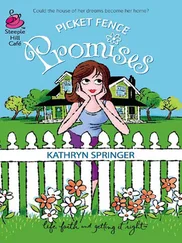Auch Pavarotti sang bei seinem Wien-Debut am 27. April 1963 den Duca di Mantova, geriet aber mit seinem sterilen Gesang neben dem Rigoletto von Ettore Bastianini und der in Wien beliebten Mimi Coertse ins Hintertreffen, obwohl er damals die lästigen gesanglichen Manierismen und Unarten, die er später entwickelte, noch nicht zeigte.
Das Buch The King and I von Pavarottis Manager Herbert Breslin gibt beredtes Zeugnis davon, wie das von Natur aus nicht vorhandene Charisma eines fettleibigen, nicht übermäßig musikalischen Sängers, der zu teuren Studioaufnahmen von Opern vollkommen unvorbereitet und in totaler Unkenntnis der zu singenden Rolle auch schon einmal mit einem originalversiegelten, da unbenutzten Klavierauszug erschien, erzeugt und wie am Aufbau seines Charismas kontinuierlich gearbeitet wurde, auch wenn der Charismatiker selbst hauptsächlich gefräßig, stinkfaul sowie unwillig war, aktiv am Charismaausbau mitzuwirken.
Er soll nach Breslins Schilderung einzig und allein daran interessiert gewesen sein, mit möglichst geringem Aufwand ein Maximum an Einkommen zu lukrieren, was gemeinhin mit dem Terminus „Wirtschaftlichkeitsprinzip“ bezeichnet wird. Dass er sich zum Zwecke der Charismaerzeugung bzw. zur Herstellung eines auch bei US-Amerikanern wirksamen Wiedererkennungsfaktors eines leintuchgroßen weissen Taschentuchs bediente, an dem er sich festklammerte und mit dem er in besonderen Momenten winkte und sich Tränen der Rührung über den unverdienten Applaus abwischte, ist nur ein Detail am Rande.
Ein schönes Beispiel für umstrittenes oder abwesendes Charisma ist die deutsche Sopranistin Annette Dasch. Sie ist eine gute, aber keine herausragende Sängerin, die es in Deutschland zu einer eigenen TV-Sendung mit dem sinnigen Titel Annettes Daschsalon gebracht hat und dort mit ihren Gästen die Zuschauer schwindlig redet. Im Juni 2012 hatte sie an der Wiener Volksoper die Hauptrolle in Leo Falls Operette Madame Pompadour ergattert und sich dabei augenscheinlich mehr auf ihr kolportiertes TV-Charisma als auf ihre sängerischen und darstellerischen Qualitäten verlassen. Doch ihre Darbietung wurde vorwiegend als mittelmäßig beschrieben. 9Da hat auch der Versuch des Charismaaufbaues durch diverse PR-Agenturen und Pressebüros rein gar nichts gefruchtet, die versuchten, die Sängerin als „international gesuchte Starsopranistin“ darzustellen. (Man kann mit Hilfe eines tüchtigen Agenten durchaus international tätig sein, ohne „gesucht“ zu sein, vom Startum einmal ganz zu schweigen.) Möglicherweise liegt es aber auch daran, dass Charisma nicht der Sängerin als Person, sondern interessanterweise nur ihrer Stimme zugeschrieben wurde, wie es der Kritiker der Augsburger Allgemeinen am 30. Juli 2007 nach der Premiere von Mozarts Il re pastore getan hatte: „[...] dass niemand überzeugender als Annette Dasch mit ihrem charismatischen Sopran belegte, dass es sich um ein Fest für Stimmfetischisten handelte.“
Charisma wurde auch dem Bassbariton Thomas Quasthoff zugesprochen. Dieser contergangeschädigte Schwerbehinderte, der von Natur aus über ansprechende stimmliche Mittel verfügte, machte – zum Teil jenseits seiner Möglichkeiten – in kürzester Zeit eine aufsehenerregende Karriere, obwohl seine gesangstechnischen Defizite vielen nicht verborgen blieben. Verschiedene Manager, Agenten und Karrierenutznießer meinten, ihn im Zuge seiner erfolgreichen Lied- und Konzertkarriere auch auf der Opernbühne vorführen zu müssen, was einige Auftritte zur Folge hatte, die nicht nur wegen seiner bedauernswerten Erscheinung, sondern auch wegen seiner gesanglichen Mängel peinlich waren, als sich nämlich herausstellte, dass der lyrische Sänger in Rollen wie dem Amfortas (in Wagners Parsifal ) im Zweikampf mit einem großen Orchester in Theaterräumen wie der Staatsoper in Wien oder dem Großen Festspielhaus in Salzburg (Don Fernando in Beethovens Fidelio ) das Nachsehen hatte. Er erkannte jedoch die Zeichen an der Wand selbst und beendete seine Karriere abrupt Anfang 2012, als er sich eingestehen musste, dass seine ohnehin beeinträchtigte Physis dem offenen Forcieren am Übergang und in der Höhe nicht mehr standhielt. Er selbst meinte dazu, er werde seinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Mit dem Charisma war es dann auch schlagartig vorbei.
Dieses Phänomen ist auch bei alten Komikern zu beobachten. Sie mögen in ihrer Jugend noch so genial und charismatisch gewesen sein, wenn sie einmal das Timing und den Rhythmus verloren haben und im Alter versuchen, ihre seit Jahrzehnten bewährten Gags, jetzt physisch ungelenk, zu wiederholen, verflüchtigt sich das einstige Charisma augenblicklich. Es gibt nichts Traurigeres als einen einst großen Komiker seine alten Routinen pathetisch und krampfhaft bemüht, wie aus der Zeit gefallen, abspulen zu sehen.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass Charisma offenbar an eine kontinuierlich und erfolgreich ausgeübte Tätigkeit – auch wenn es sich um eine kriminelle Tätigkeit wie bei Charles „Lucky“ Luciano, Meyer Lansky, Bugsy Siegel und Al Capone oder sogar nur um das freie, das heißt leistungsunabhängige Berühmtsein wie bei Paris Hilton, Verona Feldbusch, Kim Kardashian & Co. an sich handelt – gebunden ist und mit deren Beendigung erlischt.
Was mit dem vielen abgenützten und nur zum Teil verwendeten sowie beim Ableben des Charismatikers nicht aufgebrauchten Charisma geschieht, ist ungeklärt. Es müsste zum Schutz vor Missbrauch durch Charismalose (in der wissenschaftlichen Fachsprache: Acharismatiker) eigentlich wie Atommüll sicher endgelagert werden.
Vielleicht verhält es sich damit aber auch so wie mit dem Kinn mancher Personen: Es war entweder nie vorhanden oder es ist geflohen, man weiß nicht wohin.
Als ich vor einigen Jahren einen Vortrag an einer Universität einer österreichischen Großstadt hielt, hatten meine Begleitung – bestehend aus meiner Frau und einem befreundeten Ehepaar (wir waren insgesamt drei vortragsgeübte Akademiker, darunter eine Universitätsdozentin in Person meiner Gattin sowie die mit einem unbestechlichen, erdverbundenen Hausverstand gesegnete Ehefrau unseres Freundes) – und ich das Vergnügen, den Ausführungen eines Vorredners zu lauschen. Dieser junge Mann sprach mit großer Selbstsicherheit und Ausdauer von irgendwelchen für uns vier geheimnisumwobenen Dingen. Es war unmöglich, ihm auch nur einigermaßen zu folgen, denn wie sollte man das können, wenn man nicht einmal herausfinden kann, wovon er denn überhaupt sprach?! Es war wissenschaftlich, so viel stand fest. Aber wovon war die wissenschaftliche Rede?
Ein Blick ins Tagungsprogramm kündigte zwar ein Referat über eine bestimmte Form italienischer Literatur zu Ende des 19. Jahrhunderts an, jedoch war den hektisch vorgetragenen, mit phonetisch nicht ganz einwandfreien italienischen Einsprengseln ausgestatteten Emanationen überhaupt nicht zu entnehmen, ob sie etwas mit dem Thema des Vortrags zu tun hatten, und wenn ja, was. Wir begnügten uns also damit, die Hervorbringungen des akademischen Jünglings als akustisches Erlebnis über uns ergehen zu lassen, das in Form variabler Klangereignisse aus der Beschallungsanlage auf uns einströmte. Sie blieben für uns inhalts- und somit bedeutungslos.
Nachdem ich meinen eigenen Vortrag absolviert hatte, holte ich Informationen ein und erfuhr, dass es sich um einen begabten Doktoranden handelte, der so klug aus seinem Munde gesprochen hatte, dass nicht nur wir, sondern viele andere, die dem Vortrag gelauscht hatten, diesem nicht folgen konnten. Abzulesen war das an den glasigen Blicken der Zuhörerschaft, aus der am Ende seiner Ausführungen pflichtgemäß ein paar Fragen gestellt wurden. Sie hatten, wie sich zeigte, mit dem Vortrag nichts zu tun, verfehlten also das Thema. Die Treffsicherheit der Fragen wurde durch die Ungewissheit des Ziels verhindert. Offenbar waren die Fragesteller nach Abreissen des Klanggeschehens aus ihrem komatoiden Zustand nur erwacht, um sich in einem antrainierten, reflexartigen Automatismus akademisch zu gerieren.
Читать дальше