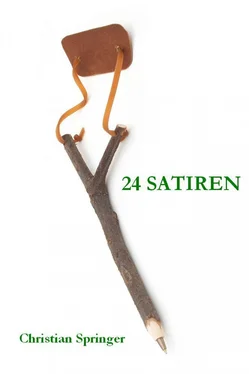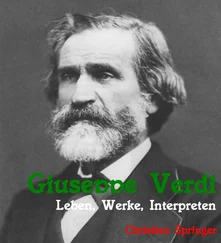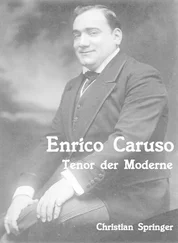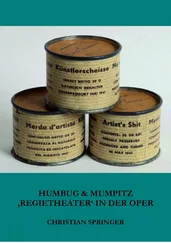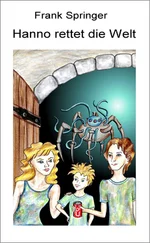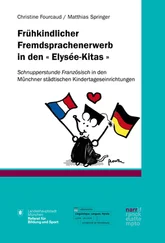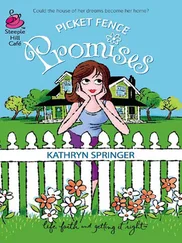Die wissenschaftliche Beschreibung der Zusammenhänge lieferte der Soziologe Max Weber: „Der Begriff Charisma beschreibt eine als außeralltäglich [...] geltende Qualität einer Persönlichkeit, um derentwillen sie als mit übernatürlichen oder übermenschlichen oder mindestens spezifisch außeralltäglichen, nicht jedem andern zugänglichen Kräften oder Eigenschaften oder als gottgesandt oder als vorbildlich und deshalb als ‚Führer‘ gewertet wird“. 1Ob jene besonderen Qualitäten tatsächlich vorhanden sind, ist laut Weber gleichgültig. Es kommt vielmehr darauf an, wie sie von den Anhängern wahrgenommen und bewertet werden. Mit anderen Worten: Charisma charakterisiert eine nahezu intime Interaktion zwischen der charismatischen Persönlichkeit und deren Jüngern. Dabei gibt es nach Weber „kein Reglement, keine abstrakten Rechtssätze, keine an ihnen orientierte rationale Rechtsfindung“, sondern es gelten ausschließlich die Eingebungen und Offenbarungen des Charismatikers: „Es steht geschrieben – ich aber sage euch“. 2
Die allgemeine Bereitschaft, Charisma überall anzutreffen und den Begriff strategisch einzusetzen, führt dazu, dass man diesen bei Religionen und Sekten vermehrt antrifft.
Dass die katholische Kirche echte Charismatiker wie Galileo Galilei, dessen Charisma auf wissenschaftlichen Leistungen und Einsichten beruhte, jahrhundertelang ablehnte, diffamierte und verfolgte 3, ist die klassische Vorgehensweise von Sekten, wie man sie heute beispielsweise bei Scientology beobachten kann. Während der Scientology-Geheimdienst OSA (Office of Special Affairs) heisst und im Sinne der Sekte äusserst effizient agiert, wurde er von den Katholiken Inquisition genannt und von charismatischen Inquisitoren betrieben, die sogar als Opernfiguren in Erscheinung treten, so in Verdis Don Carlos oder Meyerbeers L’Africaine . Später nannte der katholische Sektenteil diese Verfolgungs- und Folterinstitution beschönigend Glaubenskongregation, deren intellektuell brillanter, jedoch uncharismatischer Anführer (= Präfekt) vierundzwanzig Jahre lang der spätere Papst Benedikt XVI. war. Er zeichnete sich in dieser Funktion unter anderem dadurch aus, dass er die Verfolgung von Kindermissbrauchsfällen, derer sich vereidigtes Kirchenpersonal schuldig gemacht hatte, unterdrückte, was seiner späteren Beliebtheit keinen Abbruch tat, denn er verwandelte sich ohne eigenes Zutun vom Großinquisitor in einen von den Massen bejubelten charismatischen Popstar.
Aber das war ja auch bei L. Ron Hubbard, dem charismatischen Gründer von Scientology, der Fall. Obwohl sich herausstellte, dass er nachweislich ein größenwahnsinniger Hochstapler und Lügner war, der seine Biographie und sein berufliches Curriculum zur Gänze erfunden hatte, blieb er bis heute eine mythische Figur. Dies auch dank der Hilfestellung durch heutige Heldenfiguren in der Person intellektuell eingeschränkter Hollywoodschauspieler, die sich erfolgreich für die Erreichung der absonderlichen Ziele der Sekte einsetzen. Es überrascht nicht sonderlich, dass Ziele und Methoden der beiden Institutionen weitgehend deckungsgleich sind.
Wenn schon von der katholischen Kirche die Rede ist, muss deren Umgang mit Frauen angesprochen werden. Nicht nur, dass bei dieser Institution, welche Charisma – zumeist alten – Männern vorbehält, Frauen ausschließlich in untergeordneten, also charismafreien Positionen – als Klosterschwester, Krankenpflegerin, Küchenhilfe oder Reinigungspersonal – arbeiten dürfen und man ihnen mit dürftigen Altmännerargumenten die Möglichkeit verweigert, Priesterinnen, Kardinalinnen, Päpstinnen oder auch nur Direktorinnen der Vatikanbank 4zu werden, ist schon der Name des Staates, in welchem die Institution ihren Firmensitz hat, Programm: Er heisst Vati kan – möglicherweise eine dezente Anspielung auf die (zwangsläufig unehelichen) Kinder hoher kirchlicher Würdenträger (darunter ein beliebter österreichischer Kardinal) – und weist dadurch etymologisch eindeutig auf die darin herrschende Dominanz der Männer hin, die auch im wirklichen Leben offiziell keine weiblichen Partnerinnen (früher traten diese in Form von beischlafwilligen, gesellschaftlich durchaus akzeptierten Pfarrersköchinnen gehäuft auf) dulden, sondern sich statt dessen lieber an Kindern vergreifen. Damit schließt die Altherren- und Kinderschänderriege auch gleich die Möglichkeit aus, dass die Frauen einen Gegenentwurf mit dem Namen Mutti kan gründen.
Dabei fällt ins Auge, dass Frauen ganz allgemein weniger oft Charisma zugeschrieben wird als Männern, was angesichts mancher der heute in wichtigen politischen Funktionen aktiven Frauen gelegentlich sogar verständlich sein mag. Damit ist jenes Charisma gemeint, welches darüber hinausgeht, dass die jeweilige Dame beim Betreten eines Raumes von den anwesenden Männern sabbernd beglotzt wird.
Auffallend ist, dass es charismatische Personen gibt, deren Charisma nicht erkannt wird. Dies geschieht deshalb, weil das Vorhandensein von deren Charisma von niemandem behauptet und publik gemacht wird. So wurden beispielsweise die später angeblich vorhandenen ganz speziellen Charismata der Mitglieder der infamen Tenortrinität Carreras-Domingo-Pavarotti (nach Körpergewicht und alphabetisch geordnet) bei ihren Debuts an der Wiener Staatsoper von niemandem wahrgenommen. Pavarotti trat hier erstmals 1963 auf, Domingo 1967, Carreras 1974, wobei ihre Leistungen durchschnittlich bis mäßig waren. Sie alle erhielten kurzen Anerkennungsapplaus, wurden von jeweils rund zweitausend Menschen als unbedeutende Debutanten unter vielen anderen wahrgenommen und nicht weiter beachtet. (Der Verfasser dieser Zeilen war zufällig bei allen drei Debuts anwesend.) Erst als die PR-Maschinerien verschiedener Plattenfirmen in Gang gesetzt wurden, da man auf ein gutes Geschäft hoffte, ging die Kunde von der Starqualität und dem Charisma dieser Sänger durch die Medien und wurde in der Folge geglaubt.
Bei Domingo jubelte damals niemand „Habemus Papam“, wie dies heute im Nachhinein der Fall ist. Im Gegenteil: Die Wiener Opernliebhaber, denen in den 1960er Jahren häufig obskure Debutanten vorgesetzt wurden, befanden mehrheitlich, der dicke, abundant schwitzende Mann mit den fettigen Locken und dem Klobrillenbart, der wesentlich älter als ein 29jähriger wirkte, zu dem er rückwirkend erst Jahrzehnte später wurde, und der sich als Don Carlo in Verdis gleichnamiger Oper 5hörbar und sichtbar abmühte und enthemmt naturalistisch, ja geradezu tobsüchtig agierte, sänge „wie eine gesengte Sau“. Das war nicht vornehm formuliert, bekam aber etwas Treffendes, als er sich dieses unpassenden Stils auch in anderen Rollen bediente und damit einem größeren Kreis von Opernfreunden unangenehm auffiel.
José Carreras wiederum kämpfte bei seinem Debut mit der Tessitura des Duca di Mantova in Rigoletto so sehr, dass er nach einem geschmissenen hohen H am Ende von ‚La donna è mobile‘ mit eisigem Schweigen abgestraft wurde. 6Ein bekannter Wiener Kritiker entlastete den Sänger mit seiner durch Notenanalphabetismus verursachten Annahme, er habe in der Kadenz der in H-Dur geschriebenen Kanzone versucht, ein abschließendes hohes C zu singen, was harmonisch schwierig wäre und nur einem minderqualifizierten Musikreporter einfallen kann, der jeden hohen Ton für ein hohes C hält. Carreras haderte während seiner ganzen Karriere mit seiner Technik, die er wie sein Idol Giuseppe di Stefano nicht in den Griff bekam, und sprach deswegen einmal bei Franco Corelli vor, der seine exzellente Technik unter anderem in jahrelangem Studium bei Giacomo Lauri-Volpi erarbeitet hatte. „Sie haben keinen passaggio “ 7, beschied Corelli Carreras nach dem Vorsingen, „Sie haben eine Naturstimme wie di Stefano.“ 8Das war eine höfliche Umschreibung der Tatsache, dass keine nennenswerte Technik zu erkennen war. Magda Olivero, die in ihrer langen Karriere mit Tenören wie Beniamino Gigli, Tito Schipa, Giacomi Lauri Volpi, Francesco Merli, Galliano Masini und Giuseppe Lugo bis hin zu Corelli, del Monaco, di Stefano und Domingo gesungen hatte, brachte diese Tatsache in der mir 1981 gegenüber privat vor Zeugen geäusserten Feststellung „Carreras ist gesangstechnisch ein Dilettant“ zum Ausdruck. Anlass dafür war der Radames, den Carreras unter heftigem Forcieren im Juli 1979 in Salzburg gesungen hatte. Mario del Monaco wählte eine andere Beschreibung für die Charismalosigkeit dieses Radames: Carreras sei nur „Nemorino in Theben“ gewesen.
Читать дальше