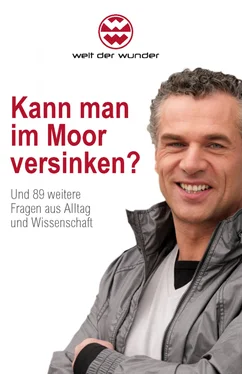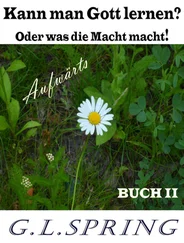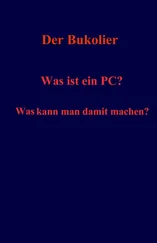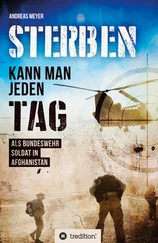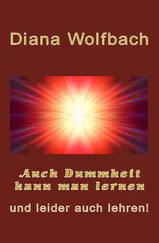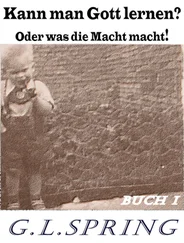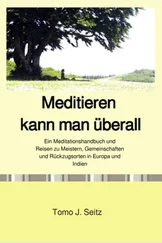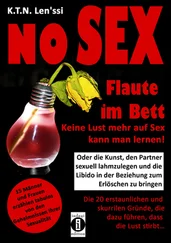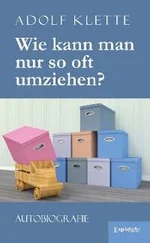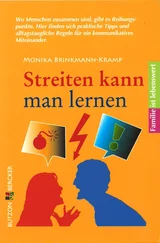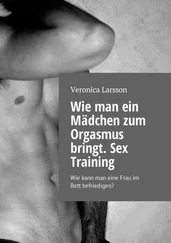Ähnlich entstanden Spurfossilien, etwa versteinerte Dino-Fährten. Sand oder Schlamm füllten die Trittspuren, bevor sie verwittern konnten. Immer mehr Erde lagerte sich darüber ab und presste die Abdrücke über Millionen Jahre zu Stein. Besonders gut erhaltene Fußabdrücke lassen sogar Einzelheiten der Haut erkennen.
Durch Bewegungen der Erdkruste und durch Erosion – also dann, wenn lockere Bodenteile von Wind oder Wasser abgetragen werden – gelangt ein Fossil schließlich wieder an die Oberfläche. So kommt es, dass dann und wann die Spuren eines vor hundert Millionen Jahren lebenden Dinos von Arbeitern in einem Steinbruch entdeckt werden – oder sogar direkt von einem wissbegierigen Paläontologen.
Fossilien geben einen unvergleichlichen Einblick in die Entwicklungsgeschichte des Lebens. Sie zeigen uns, wie sich Lebewesen im Laufe der Zeit entwickelt haben und welche Tierarten es einmal gab, die längst ausgestorben sind. Außerdem kann man durch die Altersbestimmung feststellen, wann welche Tierarten gelebt haben und ob es beispielsweise zum Massensterben bestimmter Arten kam.
Warum ist Musik für uns so wichtig?
Musik bringt Menschen zusammen, lässt uns tanzen und mitsingen, manchmal auch weinen. Sie bahnt sich ihren Weg direkt in die Gefühlswelt, berauscht unsere Sinne. Die Wirkung der harmonischen Klänge auf den Menschen ist wissenschaftlich belegt. Auch in der Medizin wird immer mehr auf Musik als therapeutisches Mittel gesetzt.
Wenn wir verliebt sind, hören wir gerne Herz-Schmerz-Balladen. Schönes Wetter verlangt nach heiteren Klängen. Zu jeder Stimmung gibt es die passende Musik. Harte Rhythmen bringen das Herz zum Rasen, sanfte Melodien beruhigen. Wir wissen instinktiv, welche Wirkung die jeweilige Musik im Körper und vor allem im Gehirn auslöst. Wir setzen sie gezielt ein, um unserer Stimmung Luft zu machen oder sie zu beeinflussen. Musik spiegelt unser Leben als das, was es ist: ein gefühlsmäßiges Auf und Ab.
Als Ergänzung zu traditionellen Heilmethoden wird Musik in der Medizin eingesetzt. In zahlreichen klinischen Studien konnte die angst- und schmerzlösende Wirkung von Musik belegt werden. Im Einzelnen werden Effekte wie Muskelentspannung, Senkung von Herzfrequenz und Blutdruck oder Stabilisierung des Atemrhythmus beobachtet. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Krankheitssymptome und der medikamentösen Behandlung ist die Musiktherapie sehr erfolgversprechend. Sie stützt sich ausschließlich auf Musik als Mittel zur Heilung. Musiktherapie wird vor allem bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen eingesetzt. Auch Menschen mit Behinderungen oder anderen Beeinträchtigungen werden musiktherapeutisch behandelt. Dabei beteiligt sich der Patient aktiv, indem er ein Instrument spielt oder singt. Im Gespräch mit dem Therapeuten werden die gewonnenen Erfahrungen, Emotionen und Wünsche anschließend bearbeitet. Die Therapie kann aber auch rezeptiv aufgebaut sein, das heißt der Patient hört sich gemeinsam mit dem Therapeuten speziell ausgewählte Musikstücke an. Dadurch werden psychische und körperliche Prozesse in Gang gesetzt, um die Beschwerden zu lindern.
Ist das Eis an den Polen süß oder salzig?
Damit die Feuchtigkeit auf den Straßen nicht zu Glatteis gefriert, streuen wir im Winter Salz. Auch im Meerwasser ist Salz enthalten – das wiederum gefriert, zumindest an den Polen. Wie lässt sich das erklären?
In der Arktis und Antarktis gibt es sowohl süßes als auch salziges Eis. Denn: Die Eiskappen an Nord- und Südpol bestehen aus Gletschereis und Meereis. Sie bilden sich in Abhängigkeit von klimatischen Faktoren wie Temperatur, Meeres- und Luftströmungen sowie Luftfeuchtigkeit. Gletschereis besteht aus Schnee – und somit aus Süßwasser. Als Meereis bezeichnet man gefrorenes Salzwasser der polaren Ozeane. Das Meereis und die polaren Eisschilde des Festlandes bilden zusammen das Polareis.
Der Salzgehalt des Meerwassers von etwa 3,5 Prozent senkt dessen Gefrierpunkt auf ungefähr minus 1,9 Grad Celsius ab. Das Wasser gefriert also deutlich später als nicht salzhaltiges Wasser. Mit steigendem Salzgehalt verstärkt sich diese Tendenz. Das im Wasser enthaltene Salz gefriert selbst gar nicht: Es wird nicht ins Kristallgitter des Eises eingebaut, sondern teils in das umgebende Wasser ausgeschieden, teils in Soletaschen im Meereis eingeschlossen. Diese bilden zwischen den festen Eiskristallen ein verzweigtes Kanalsystem. Dadurch hat Meereis zwar einen im Vergleich zum Meerwasser geringeren Salzgehalt von 0,3 bis 0,5 Prozent, ist aber ebenfalls salzig.
Warum haben wir Angst vor Spinnen?
Die Angst vor Spinnen ist so tief verwurzelt, dass sich Betroffene kaum dagegen wehren können. Noch immer rätseln Wissenschaftler über den Ursprung dieser irrationalen Furcht. Möglicherweise ist die in der Fachsprache als „Arachnophobie“ bezeichnete Spinnenangst nur ein Erbe der Evolution, ähnlich wie die Angst vor Dunkelheit. Für unsere Vorfahren war es überlebenswichtig, giftigen Tieren wie Spinnen oder Skorpionen mit gebührender Vorsicht zu begegnen.
Doch auch heute noch hat schätzungsweise jeder vierte Deutsche Angst vor Spinnen, sechzig Prozent davon sind Frauen. Schuld daran ist die Amygdala, eine mandelförmige Struktur im Gehirn. Sie spielt eine Schlüsselrolle bei der emotionalen Bewertung von Situationen und ist wesentlich an der Entstehung von Angst beteiligt. Entdeckt man also eine Spinne, wird das Unterbewusstsein aktiv, noch bevor das Bild im Großhirn bewusst verarbeitet wird. Es werden Hormone ausgeschüttet, Panik beherrscht das Gemüt. Die Muskeln spannen sich an und der Körper ist bereit zur Flucht. Da bestimmte Urängste seit Jahrtausenden existieren, sitzen sie wesentlich tiefer verankert als vergleichsweise moderne Ängste – etwa vor Autos im Straßenverkehr.
Auch die Erziehung spielt eine Rolle: Wenn Eltern Angst vor Spinnen haben, werden meist auch ihre Kinder den Achtbeinern eher skeptisch gegenübertreten. Untersuchungen haben gezeigt, dass selbst Kinder, die noch keine schlechten Erfahrungen mit Spinnen gemacht haben, mit Panik reagieren, sobald sich diese nähern. Es folgten Reaktionen wie Angstschweiß und leichtes Herzrasen.
Die Arachnophobie ist allerdings kein globales Phänomen. Außerhalb der westlichen, christlich geprägten Kulturen ist die Spinnenangst kaum verbreitet. Ganz im Gegenteil: Einige Naturvölker verehren bestimmte Spinnen sogar als göttliche Wesen. Bei uns hingegen werden Spinnen tendenziell als böse oder dämonisch verdammt. Hier galten sie über Jahrhunderte als Überträger der Pest und wurden mit Tod und Teufel assoziiert.
Problematisch wird die Arachnophobie, wenn sie krankhafte Ausmaße annimmt. Wer nicht mehr in die Garage oder den Keller geht, weil er Angst vor Spinnen hat, der sollte sich dringend professionell helfen lassen. In Spezialkliniken kann die Angst vor Spinnen erfolgreich therapiert werden.
Haben eineiige Zwillinge den gleichen Fingerabdruck?
Eigentlich müssten sich eineiige Zwillinge gleichen wie ein Ei dem anderen – und auf den ersten Blick tun sie das auch. Doch viele von ihnen sind es leid, ständig verwechselt und verglichen zu werden. Durch Frisur, Kleidungsstil und Hobby versuchen sie deshalb, sich von ihrem Gegenpart abzugrenzen. Doch vollständig schaffen sie es niemals, denn sie besitzen das gleiche Erbgut. So sind etwa Augenfarbe, Haarfarbe und Größe identisch. Aber zählt auch der Fingerabdruck zu den identischen Merkmalen?
Fingerabdrücke sind Abbilder der sogenannten Papillarleisten, also den charakteristischen Linien auf der Innenseite der Hand. Sie wirken wie ein Stempel – und das besonders exklusiv. Obwohl sich auf dem Papier die Fingerabdrücke eineiiger Zwillinge noch ähnlich sehen, weichen spätestens die eingescannten Abdrücke auf dem Computerbildschirm deutlich voneinander ab. Sie haben zwar mehr Übereinstimmungen als die Fingerabdrücke nicht verwandter Personen, doch identisch sind sie nicht.
Читать дальше