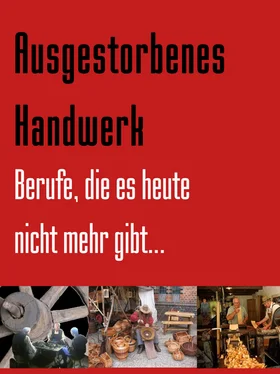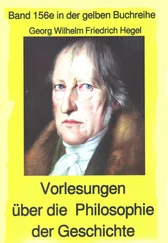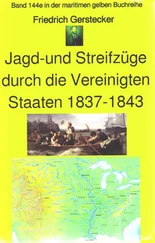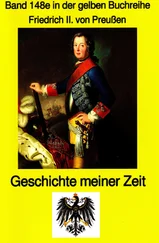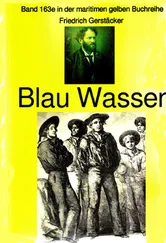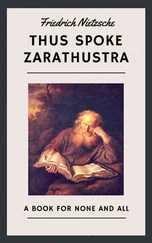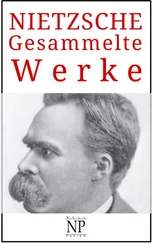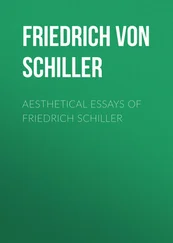Friedrich Zwiebler - Ausgestorbenes Handwerk
Здесь есть возможность читать онлайн «Friedrich Zwiebler - Ausgestorbenes Handwerk» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ausgestorbenes Handwerk
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ausgestorbenes Handwerk: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ausgestorbenes Handwerk»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Lernen Sie Berufe kennen die es heute nicht mehr gibt und begleiten Sie Handwerker bei längst ausgestorbenen Künsten.
Dieses Buch trägt die interessantesten Quellen aus dem Internet zusammen und fasst diese für Sie übersichtlich für unterwegs zusammen.
Ausgestorbenes Handwerk — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ausgestorbenes Handwerk», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Konservierung: Die Pelz-Sommeraufbewahrung bei gleichzeitiger Pflege durch einen Pelzfachbetrieb
Läutern: Das Reinigen der Pelze durch Holzmehl
Male: Das männliche Kleinpelztier, vor allem beim Nerz (auch: Rüde)
Mutationsfarben: Durch plötzliche, sprunghafte, natürliche vererbbare Farbveränderung entstandene neue Fellfarben (insbesondere bei Nerz, Nutria)
Nourkulemi: Extra zu verarbeitende Kehlstücken, vor allem bei Nerz und Zobel
Nacktpelz: Alte, nur noch selten benutzte Bezeichnung für die mit der Lederseite nach außen zu tragenden Mäntel oder Jacken aus Lamm- oder Ziegenfell, auch „wie gewachsen“. Häufig bestickt (Trachtenpelz)
Pumpf: Das hintere Teil des Felles
rauch: Bezeichnung für dichtes, nicht straff anliegendes Haar. Auch die Rauche
Reinforcing: (= verstärken) Nachdunkeln der Felle durch die Behandlung mit Metallsalzen, insbesondere bei hellerer Unterwolle. Die Felle gelten weiterhin als naturell, also nicht gefärbt (insbesondere bei Nerz und Bisam)
Rupfen: Das Entfernen des Grannenhaars (Ergebnis z. B. Samtnerz, Samtnutria, Samtwiesel, früher auch üblicherweise beim Haarseehund/Seal). Seit etlichen Jahren, soweit möglich, auch bei zertrennten, getragenen Nerzpelzen angewendet
Scheren: Das Kürzen des Haares durch Schermaschinen (Ergebnis z. B. Samtbisam, Samtnerzstücken, Biberlamm, Sealkanin). Auch beim zertrennten, getragenen Pelz möglich
Schnatte: Ein beim Entpelzen oder Zurichten entstandener Aufriss des Oberleders („Narbenbruch“) auf der Fellseite
Schönen: Nicht rein weiße oder vergilbte weiße Felle werden chemisch aufgehellt, entweder durch die Behandlung mit optischen Aufhellern oder mit einem rotstichigen Blaufarbstoff
Thiliki: Extra zu verarbeitende Bauchstücken, vor allem bei Nerz und Zobel
Veredlung: Sammelbegriff für Veränderungen des Haares, z. B. durch Färben, Rupfen, Scheren oder der Lederseite durch Färben, Nappieren, Veloutieren, Bedrucken
Wamme: Die Bauchseite des Felles
Zurichten: Das Gerben von Fellen für Pelzzwecke
Zwecken: Das Glattspannen der auf der Lederseite angefeuchteten Pelzteile nach dem Zusammensetzen der Felle vor dem Abgleichen (in die endgültige Form schneiden)
Müller
Als Müller wird der Handwerksberuf bezeichnet, dem die (häufig industrielle) Herstellung von Mehl oder Gewürzen, Pflanzenöl oder auch Futtermitteln obliegt. Daneben nennt man den Besitzer oder Betreiber einer Mühle Müller, auch wenn diese Mühle heute kein klassisches Müllerhandwerk mehr betreibt. Zugleich ist Müller auch der häufigste Familienname des deutschen Sprachraumes.
Neue offizielle Berufsbezeichnung
Die neue offizielle Berufsbezeichnung in Deutschland lautet: Müller (Verfahrenstechnologe in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft)/Müllerin (Verfahrenstechnologin in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft).
Die zuständigen Berufsverbände waren zu der Überzeugung gekommen, dass die alte Berufsbezeichnung „Müller“ die heutigen technologischen Anforderungen des Berufes nicht mehr widerspiegelt und strebten mit der Reform der Ausbildungsordnung auch eine Namensänderung an. So sollte der Beruf fortan nur noch „Verfahrenstechnologe in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft/Verfahrenstechnologin in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft“ heißen. Der damalige Wirtschaftsminister Michael Glos, Müllermeister, verhinderte dies und bestand darauf, dass die alte Bezeichnung, Müller, voran gestellt wird. Jeder, der bisher die Gesellen- oder Meisterprüfung als Müller abgeschlossen hat, darf sich weiterhin so nennen.
Gegenwärtiges Berufsbild des Müllers
In der industrialisierten Welt haben nur wenige der traditionsreichen alten Handwerksberufe überlebt. Der Müller gehört dazu, denn er hat es verstanden, sich die Errungenschaften moderner Technik zunutze zu machen. Es gibt auch heute noch viele handwerkliche Mühlen, aber der überwiegende Teil sind mittlerweile Industriebetriebe. Im Wirtschaftsjahr 2008/09 gab es in Deutschland noch 302 Getreidemühlen, die mehr als 500 t Getreide im Jahr vermahlen. Neun Betriebe davon haben 200.000 t Getreide pro Jahr oder mehr vermahlen. Der größte Teil der Mühlen (185, entsprechend 60,1 %) hatte eine Jahresvermahlung zwischen 500 und 5000 t pro Jahr. Für Nostalgie (der Müller mit Zipfelmütze und Mehlsack über der Schulter) ist da kein Platz mehr – heute kommt der Müller mit einem Silofahrzeug und bläst das Mehl mit Druckluft in die Bäcker-Silos.
Der Müller produziert:
in einer Getreidemühle aus Weizen, Roggen und seltener aus Dinkel u. a. Schrot, Grieß, Dunst und Mehl sowie Kleie
in einer Schälmühle aus Hafer, Gerste, Mais, Reis und Hirse u. a. Flocken, Grütze und Graupen
in einer Gewürzmühle aus Gewürzsaaten, Kräutern und Mineralstoffen Gewürzpulver, Schrote, Blattverschnitt und gerebelte Gewürze
in einer Ölmühle aus Raps, Sonnenblumen-, Soja- oder Leinsamen u. a. Speiseöl bzw. Biodiesel oder Industrieöl
in einer Futtermühle aus pflanzlichen, tierischen und mineralischen Grundstoffen Mischfutter für Nutz-, Heim-, Zootiere und Wild.
Da die Arbeitsabläufe in Mühlen und Mischfutterbetrieben weitgehend technisiert worden sind, werden in der Müllerei nur wenige Arbeitskräfte gebraucht. Diese aber müssen gut ausgebildet sein, umfassende Fachkenntnisse mitbringen, es verstehen, sich neuen Anforderungen immer wieder anzupassen, kombinieren und schnell entscheiden können. Der Tätigkeitsbereich des Müllers von heute ist also weit gespannt und anspruchsvoll. Er setzt organisatorisches, technisches und kaufmännisches Denken und Handeln voraus. Ein ausgelernter Müller kann sich – auch in der heutigen Zeit – meist seinen Arbeitsplatz aussuchen, denn die Mühlenbetriebe bilden insgesamt zu wenig aus.
Die Arbeitsplatzsituation gestaltet sich für Müller sehr entspannt, die Arbeitslosenquote bei Müllern ist äußerst gering.
Sozialgeschichte des Müllerberufs
Noch im Mittelalter galt das Müllergewerbe als anrüchig und zählte vielenorts zu den „unehrlichen“ Berufen. Dies wird sehr schön dokumentiert in dem 1724 erschienenen Werk von Georg Paul Hoenn (3. Edition) "Betrugs-Lexikon, worinnen die meisten Betrügereyen in allen Staenden nebst denen darwieder guten Theils dienenden Mitteln entdecket von...". Hier wird sehr detailliert an insgesamt 30 verschiedenen Fällen beschrieben, auf welche Art und Weise die einzelnen Betrügereien von Müllern durchgeführt werden. Einige Beispiele:
Wenn sie an verborgenen und bedeckten Orten heimliche Neben-Beutel führen / wodurch das Meel auf die Seiten, in ihre Diebs-Löcher fället.
Wenn sie unvermerckt zweyerley Gemäß führen / ein grosses zum Einnehmen und ein kleines zum Ausgeben.
Wenn sie bey der Unruhe derer Mühl-Beutel inwendig in den Meel-Kasten doppelte Bretter oder Böden machen / worinnen sich das Meel verbergen kan.
Wenn sie ihre Hüner / Tauben und Schweine / so in die Mühl kommen / im fremden Getreid Herr seyn lassen
...und noch viele mehr. Nach der Antriebsart wurden früher „Wassermühlen“ von „Windmühlen“ unterschieden. Windmüller gab es in Mitteldeutschland erst seit dem 18. Jahrhundert.
In den Mahlmühlen wurden vom Mahlmüller Mehl und Schrot für die Ernährung hergestellt. In den uneigentlichen Mühlen wurde die Wasserkraft zur Bearbeitung verschiedenartiger Materialien benutzt, wie unter anderem in Papiermühlen, Walkmühlen, Lohmühlen, Hammermühlen und Schneidmühlen. Die entsprechenden Berufsbezeichnungen, die oft auch als Familiennamen fest geworden sind, lauten Hammermüller, Bretschneider, Oelschläger usw.
Erbmüller saßen als Eigentumsmüller auf einer Mahlmühle bzw. einem Mühlengut. Diese Müller waren, in dörflichen Maßstäben gemessen, oft ausgesprochen wohlhabend, mit 2000 fl. Vermögen und mehr schon im 17. Jahrhundert. Da die Mühlen (oft auch mit einem Schneidegang zusätzlich ausgestattet) fast ausschließlich vom Vater auf einen Sohn vererbt wurden, sind bei Erbmüllern Besitzerfolgen in einer Familie über mehrere Jahrhunderte hinweg möglich.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ausgestorbenes Handwerk»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ausgestorbenes Handwerk» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ausgestorbenes Handwerk» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.