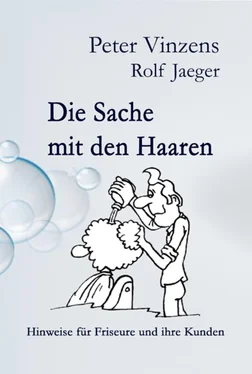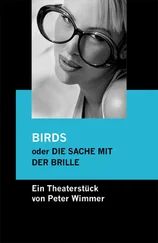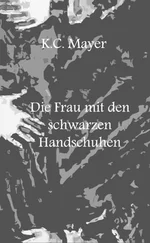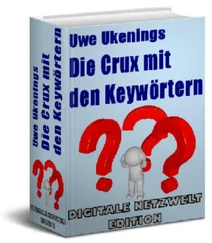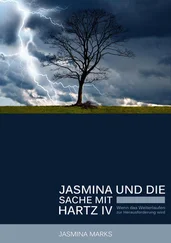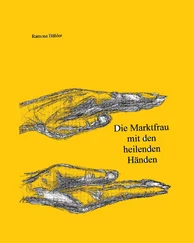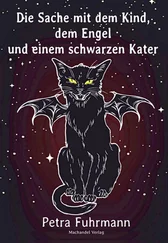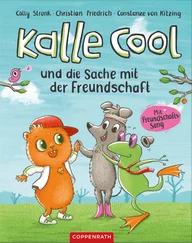„Haben Sie keinen Friseur?“ Dieser Verzweiflungssatz gestresster Mitmenschen entfleucht ihnen immer dann, wenn ein anderer, oder eine andere, ihnen mit ihren Seelenergüssen völlig den Nerv raubt. Der Friseur hingegen ist solche Geständnisse seiner Mandanten gewöhnt, sie sind ihm vertraut, sie sich anzuhören gehört zu seinem Berufsbild. Und wie jeder gute Psychologe wird er sich die Sorgen und Nöte anhören ohne Stellung zu beziehen. Nur selten wird er Kommentare abgeben, höchstens mal unverständliche Laute der Zustimmung oder der Verwunderung, und nie, wirklich niemals, wird er zugeben, dass das Gegenüber des aktuell Klagenden ebenfalls zu seinen Kunden gehört, und er die Zusammenhänge bereits durch andere Schilderungen kennt. Seine Rolle gleicht an dieser Stelle dem des Pfarrers oder des Arztes. Und dies, obwohl er oder sie nicht an Beichtgeheimnis oder Verschwiegenheitsgebot gebunden ist. Diskretion ist hier trotzdem dreiviertel der Miete, wie man so sagt. Es ist deshalb verwunderlich, dass unter Friseurinnen und Friseuren so wenige Schriftsteller zu finden sind, die Krimis, Liebesromane und andere Schauergeschichten schreiben. Vorlagen, zu anonymisierende Beispielgeschichten, hätten sie doch wahrlich genug.
Umso unverständlicher sind solche Betriebe, die ihre Kunden mit schlechter Laune, Geschwätz mit den Kollegen während der Arbeit am Haarschopf und mangelnden handwerklichen Fähigkeiten traktieren. Der Spiegel für die Endkontrolle der verborgenen Rückseite des eben Behandelten findet heute oftmals nur noch im Vorbeigehen statt, der kleine Stoß hochalkoholischen Parfüms zu Schluss auf die gelungene Locke ist dem Rotstift zum Opfer gefallen, und das dekorativ knallende Ausschütteln des Umhangs ist schnödem Wäschewechsel gewichen. Dabei könnte der Beruf doch so schön sein: Künstlerisch, kommunikativ und wohlriechend.
Wo aber wird der Kunde heute – nach dem kleinen Umweg an der Kasse vorbei – vom Meister noch persönlich zum Laden hinausgebürstet, um die letzten Reste der Behandlung von Mantel und Jackett zu entfernen. Diesem Missstand des Gewerbes wollen wir an dieser Stelle entgegentreten. Zu diesem Zweck wurde dieses Buch geschrieben. Zu Wohle des Friseurhandwerks und seiner unverstandenen Kunden. Das Werk soll dienen der erneuten Aufrichtung der anscheinend vergessenen Haar-schneide-legen-und-föhnen-Kultur.
Und wenn alle Leute, die noch Haare haben oder anderen dieselben abschneiden, dieses Buch kaufen, dann hat sich die Arbeit auch für die Autoren gelohnt.
Es gibt Menschen, die haben auf ihrem Haupte überhaupt keine Haare. Diese nennt man Glatzköpfe. Die bekanntesten Vertreter der Neuzeit sind Telly Savalas, alias Kojak und Jul Brunner. Beide waren Schauspieler, Amerikaner und in der Lage aus ihrem Mangel einen Kult zu machen. Zu ihren Gunsten versteht sich. Hinzu kommt natürlich als Aspirant heute der Politiker Peter Altmeier. Aspirant deshalb, weil Peter Altmeier noch Reste seiner Haupthaare als Kränzchen trägt. Bald aber schon wird er sich in die Reihe der genannten Berühmtheiten einreihen können. Das lassen zumindest die Gesetze der Biologie vermuten.
Nun mag es befremdlich, ja widersinnig erscheinen ein Traktat über Haare ausgerechnet mit Glatzköpfen zu beginnen. Ein Blick zurück in die Geschichte des Haupthaares allerdings lässt diesen Beginn in ganz anderem Licht erscheinen.
Da war zum Beispiel Simson, auch Samson genannt, der bekanntlich (Altes Testament, Richter 13 – 16) übermenschliche Kraft aus seinen Haaren bezog. Aus Liebe zu der Philisterin Delila verriet er dieser sein Geheimnis und dann, der wallenden Pracht beraubt, wurde er versklavt und geblendet. Schließlich kam er um. So geht es einem, wenn die Haare weg sind.
Ähnlich die Informationen über Absalom. Der arme Kerl verheddert sich bei der Flucht vor seinen Häschern mit seiner prachtvollen Mähne in einem Baum, wird gefangen und umgebracht. Mit kurzen Haaren wäre das nicht passiert. Mit den langen Haaren hatte es also schon vor langer Zeit seine besondere Bewandtnis. Hätten die Gegner der Beatles-Behaarung dieses Argument früher vertreten, wer kann ermessen, wie die Pop-Geschichte ausgegangen wäre. Aber das ist jetzt eine unzulässige Spekulation.
Noch heute können wir dieses Phänomen allerdings nachvollziehen. Man stelle sich eine Wagner-Oper vor: Gewichtige Klänge aus dem Orchestergraben, blaues Licht von hinten, dunkle Dekoration, gewaltige Stimmen berichten von drohendem Untergang und dann tritt einer der Hauptprotagonisten, natürlich ein Bass, mit Glatze auf. Unmöglich! sagen da die Theaterkritiker, und natürlich, der Regisseur verstünde sein Handwerk nicht. Recht hätten sie, diese Besserwisser der schreibenden Zunft, gleichgültig wie stimmgewaltig der Sänger auch sein möge. Schließlich schleppen wir eine Jahrtausende alte Kultur der Haartracht mit uns herum. Die kann man nicht so einfach von heute auf morgen in den künstlerischen Orkus werfen.
Kelten und Germanen trugen ihr Haar lang, vorausgesetzt sie waren Freie. Knechten und Leibeigenen wurden die Haupthaare geschoren, auf dass jeder erkennen konnte, wo wer in der Hierarchie hingehörte. Auch noch viel später wurden Menschen die Haare abgeschnitten, um sie zu demütigen, um sie quasi öffentlich unfrei zu machen. Das hat sich in einigen Köpfen sogar bis heute noch gehalten, auch in Glatzköpfen. Woraus man ersehen kann: Die Haartracht ist eine durchaus politische Angelegenheit.
Nun galten Kelten und Germanen bei den Machthabern im mediterranen Raum durchaus als Barbaren. Irgendwie bedeutet Barbaren ja auch „die Bärtigen“, die Ungepflegten, die Kulturlosen. Und da hatten die Römer wohl auch recht. Auf die Barbaren wurde deshalb – zumindest solange sie das Römische Reich noch nicht erobert hatten – einfach herabgesehen. Ihre lange Haartracht galt als unappetitlich und abstoßend.
Trotz dieser kulturellen Erfahrung: Diese Unterschiede in der Betrachtungsweise der Haarlänge sollten auch unter statistischen Gesichtspunkten gesehen werden:
Der Mensch als Solcher hat im Schnitt zwischen 300-Tausend und 500-Tausend Haare am ganzen Körper. Glatzköpfe ausgenommen. Davon entfallen rund 25% auf die Kopfbehaarung, also maximal 125-Tausend Haare. Jedes dieser winzigen Haarkleid-Teile wächst jeden Tag zwischen 0,25 und 0,40 Millimeter. Rechnet man diesen Wert hoch, dann kommt der Beobachter auf erstaunliche Werte, statistisch gesehen versteht sich: Somit wächst das Haar jedes Jahr um 118 Millimeter. Bei einer statistischen Lebenserwartung von 70 Jahren wächst jedes Haar also gut 8 Meter, vorausgesetzt sie fallen dem statistisch Berechneten nicht vorher aus. Bei 125- Tausend Haaren auf dem Kopf ergibt das eine Gesamtlänge von rund 1.000 Kilometern. Die Strecke von Oslo nach Frankfurt am Main, knapp. Aus dieser Länge müsste sich doch im Prinzip was machen lassen.
Aber, treiben wir – um der kulturhistorischen Betrachtung willen – die Rechnerei noch weiter: Die mittlere Temperatur im Januar des kühlen Nordens liegt im Mittel rund 15 Grad Celsius unter den Temperaturen Italiens. Da sollte es doch niemanden verwundern, dass die Barbaren des Nordens ihr Haarkleid länger wachsen ließen als die Schöngeister in den warmen Gefilden des Mittelmeeres. Deshalb bestand weder bei Römern noch bei Griechen, die Notwendigkeit, sich vermittels langer Haupthaare gegen die Kälte zu schützen. Die störten in der Hitze des Mittelmeers nur. Insofern müssen wir heute die Barbaren des kalten Nordens in Schutz nehmen.
Somit bleibt festzuhalten, dass das Haar eine besondere Aufgabe besitzt und nur sekundär Modeerscheinungen untertan gemacht wird. Die Natur hat vorgesehen, dass Haare wärmen, dass sie vor Sonne schützen, dass sie – je nach Beschaffenheit- die Transpiration fördern oder unterbinden sollen. Weiter nichts.
Читать дальше