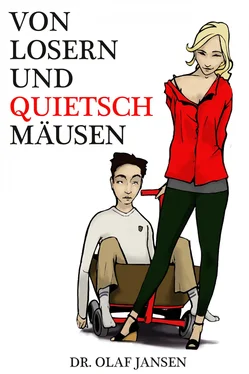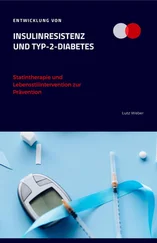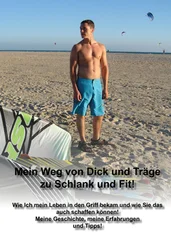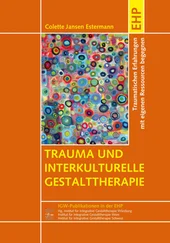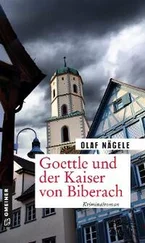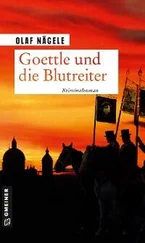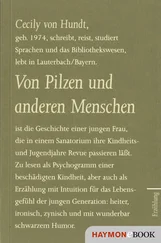Lars' Großvater väterlicherseits hingegen entstammte einer ostfriesischen Bauernfamilie. Auch er war nicht der erstgeborene Sohn, so dass er den Hof ebenfalls nicht erben konnte. Er entschloss sich, mit sehr viel Arbeit und Ehrgeiz in Hannover eine Versicherungsagentur mit wachsendem Kundenstamm aufzubauen. Diesen Kundenstamm brachte er eines Tages in eine sehr große deutsche Versicherung in Leipzig ein und wurde als Gegenleistung in den Vorstand mit einem guten Gehalt und einer eleganten Dienstvilla befördert. Er bekam die Funktion der Personalverwaltung. Wie er später immer wieder nicht ohne Stolz erzählte, hat er vor der Einstellung eines neuen Mitarbeiters immer darauf bestanden, dass der ihm erst einmal seine Ehefrau vorstelle. So könne man sich ein besseres Bild vom Bewerber machen, erklärte er. Mit seiner Frau Erna hatte er einen Sohn, Lars' Vater. Dieser wuchs als verwöhntes Einzelkind in einer gut situierten großbürgerlichen Familie auf. Er absolvierte ein Jurastudium und traf im Jahre 1939 auf Lars' Mutter. Sie heirateten im Jahre 1941. Beide hatten zwar in etwa dieselben Wertvorstellungen wie Ehrlichkeit, Gehorsam, Sittlichkeit usw., waren aber von der Herkunft sehr verschieden.
Während die Mutter sehr offen, fröhlich und positiv sowie auch unternehmerisch gestimmt war, war der Vater eher skeptisch bis pessimistisch. Er wurde zunehmend ein egoistischer Miesmacher. Beide hatten aber gegenüber ihren Kindern nicht in Frage zu stellende Grundeinstellungen. Kinder hatten den Mund zu halten, wenn Erwachsene redeten, sie mussten aufessen, was die Eltern auf ihren Teller wuchteten, und es schmeckte gefälligst – sonst: Aua! Kinder mussten ordentlich angezogen und stramm gescheitelt sein, sie durften nicht schmutzen, das Kinderzimmer musste immer aufgeräumt sein – sonst … Auf Fragen der Kinder hieß es meist: „Davon verstehst Du nichts.“ Oder entgegenkommend und ausnahmsweise wohlgelaunt, scheinbar geradezu verständnisvoll: „Dazu bist Du noch zu klein.“
Untereinander gingen sie ebenso wenig würdevoll und schon gar nicht verständnisvoll miteinander um: Dem Vater machte es offenbar immer wieder Freude, der Mutter ihre gewisse Korpulenz vorzuwerfen und sie „Mops“ zu nennen. Schlimmer noch war, dass er ihr als Frau wohl in allen Lebensbereichen die erforderliche Kompetenz bestritt und ihr immer wieder deutlich machte, dass sie keine Ahnung insbesondere von wirtschaftlichen und finanziellen Dingen hätte. Dabei hatte sie es geschafft, sich ohne nennenswertes Eigenkapital eine eigene Praxis aufzubauen. Der Vater hatte es hingegen vorgezogen, anstatt den freien Beruf eines Rechtsanwalts oder Notars auszuüben, sich als Staatsanwalt auf einen sicheren Beamtenstatus zu begeben.
Die Ehe ging jedenfalls sehr schlecht. Sie lebten gemeinsam einsam und sie zogen es vor, sich möglichst aus dem Wege zu gehen. Ob sie die Ehe in geschlechtlicher Hinsicht hin und wieder vollzogen, war und blieb unklar. Irgendwelche Anhaltspunkte hierfür gab es nicht. Stattdessen war eine gegenseitige Verachtung und Kälte zu spüren, die auf das gesamte Familienleben durchschlug. Immerhin setzte sich die Mutter nach einigen Jahren mit ihrer immer besser funktionierenden Zahnarztpraxis gegen die ständige Miesmacherei („Milchmädchenrechnung“, meckerte er) des Vaters durch, dass ein Einfamilienhaus gebaut wurde.
Im Nachhinein ist festzustellen, dass der Vater wohl – wie noch heute der größte Teil der Männer – nicht ertragen konnte, dass seine Frau ihm nicht nur in menschlicher, sondern auch in sachlicher und zunehmend auch in finanzieller Hinsicht überlegen war. Das passte nicht in das übliche Schema, in dem der Mann das bewegende oder zumindest kraft Überlieferung das dominierende Element war, während die Frau das beharrende und eher passive Element darstellen sollte. Ein harmonisches Eheleben und insbesondere auch ein Familienleben fand nicht statt. Beide Eltern hatten sich innerlich sehr weit voneinander entfernt. Es war wiederum die Mutter, die neben ihrer täglichen Arbeit in der Zahnarztpraxis alle möglichen abendlichen Beschäftigungen wie Fechten, Club berufstätiger Frauen, Bridgekränzchen etc. ausgiebig wahrnahm, um einem Familienleben bestmöglich zu entgehen.
Diese Kälte schlug schon von Anfang an auf Lars und seinen Bruder voll durch. Klein-Lars war sehr lang Bettnässer. Jedes Mal, wenn er das Bett vollgemacht hatte, wurde er von der Mutter oder vom Vater bedroht, dass man ihn beim nächsten Mal in die tiefe Trave werfen werde. Lars erinnert sich noch bis heute, dass er als Kleinkind auf dem Rücken in seinem Bette lag und unablässig seinen Kopf hin- und herdrehte und ebenso stundenlang an dem Geländer des Bettes hin und her wippte. Schließlich zog die Mutter eine befreundete Kinderärztin zu Rate, die zwar keine Diagnose stellen konnte, aber immerhin darauf hinwies, dass durch das Hin- und Herscheuern des Hinterkopfes auf der Unterlage weder das Kopfkissen noch die Kopfhaare Schaden genommen hätten.
Nachdem das von der Mutter gegen den ständigen Widerstand des Vaters errichtete Einfamilienhaus fast fertiggestellt war, starb sie im Alter von 49 Jahren an Magenkrebs, der durch fehlerhafte Diagnose viel zu spät festgestellt worden war.
Da es also kein Familienleben gegeben hat und die Erziehung in immer häufigeren Schlägen mit großen Kochlöffeln bestand, kapselte Lars sich mehr und mehr ab. Er fing an zu klauen, Dinge mutwillig zu zerstören, wurde schlecht in der Schule und litt zunehmend an starken Depressionen mit Selbstmordgedanken. Diese Gedanken hat er einige Male in die Tat umzusetzen versucht, nämlich durch Schnippeln an der linken Pulsader bzw. durch Aufdrehen des Gashahns, nachdem er seinen Kopf in den Backofen gesteckt hatte. Eine Persönlichkeit konnte er nicht entwickeln, da es an Vermittlung von Kenntnissen, Werten, Umgangsformen, gesellschaftlichen Zusammenhängen, kurz: an gleichwertigem Zusammenleben vollkommen fehlte.
So wirkten wohl die Erziehungsmethoden der wilhelminischen Zeit bis in die Nachkriegszeit hinein, obwohl diese Epoche schon lange hinter dem Horizont verschwunden war. Die bunten zwanziger und anfänglichen dreißiger Jahre wurden wohl als undeutsche Ausrutscher gewertet, indem sie von der heroischen Nazizeit mit Begeisterung abgelöst wurden. So gaben Lars' Eltern die Erziehung, die sie genossen hatten, unverändert an ihre Kinder weiter. Sie hatten den Mund zu halten. Sie mussten den Teller aufessen, den die Eltern ihnen vollgeschüttet hatten. Andernfalls mussten sie solange am Tisch sitzen bleiben, bis sie sich den widerwärtigen kalten Rest hineingewürgt oder auf andere Weise unbemerkt beseitigt hatten. Oder es gab eben keinen Nachtisch, bis alles aufgegessen war.
Das war wohl auch ein Verhalten aus der „Schlechten Zeit“, von der es in Deutschland mehrere gegeben hatte. Nichts wurde weggeworfen oder dem Verderben überlassen. So wurde Lars weiterhin mit Portionen auf seinem Teller traktiert, die er nicht bemessen hatte. Es war eine Folter. Denn zu viel oder Widerwärtiges essen zu müssen ist eine Qual. Aber da war nichts zu machen. „Kinder mit ‘nem Willen krieg‘n was auf die Brillen“, hieß es häufig. Bei kleinen oder mittleren Vergehen oder Widerreden gab es mit der Kochkelle Schläge auf den Hintern und/oder Stubenarrest. Lars wurde bockig. Er wurde bösartig und und stänkerte gegen seine Eltern.
Hin und wieder musste er zur Lateinhilfe zu dem „afrikanischen“ Großvater. Dort hatte er aber zunächst dessen Post zu sortieren und abzulegen. Es war ganz normal, dass er bei Widerreden mit einem Schlag ins Gesicht vom Großvater niedergestreckt wurde. Lars war eben schwer erziehbar. Da galt es, ihm erst einmal Mores beizubringen. Der Schlag des Großvaters war offenbar von dem Kaliber, den seine schwarzen Arbeiter in Afrika zu spüren bekommen hatten, wenn es eilte und die schwarzen Arbeiter, die die üblichen Prügelstrafen an ihren Kollegen vollziehen mussten, gerade nicht zur Stelle waren. Nun, das war eine andere Zeit, in der ein anderes Miteinander herrschte. Allerdings passten diese Gebräuche nicht mehr in Lars' Kindesalter.
Читать дальше