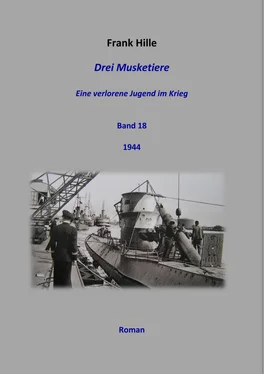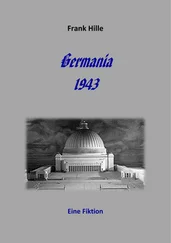„Hört zu“ sagte er „wir werden jetzt gleich in ein riesengroßes Durcheinander kommen. Es hat keinen Sinn, auf Teufel komm raus zusammen zu bleiben, das wird sowie so nicht klappen. Seht euch die Massen an, die jetzt alle aus der Falle raus wollen. Also. Jeder wird sich ab hier auf eigene Faust durchschlagen, Treffpunkt ist Lsyjanka. Bildet höchstens kleine Gruppen. Und unterschätzt den Fluss nicht. Wartet lieber oder sucht euch halbwegs sichere Übergänge als ans andere Ufer zu schwimmen, ihr werdet es nicht schaffen, es ist Hochwasser. Vielleicht kommen unsere Truppen von draußen doch noch durch. Haltet die Ohren steif, wir haben schon ganz andere Probleme gemeistert.“
Weber ging los, zwei Männer waren bei ihm geblieben, Herbert Großmann und Dieter Kleber. Beide kannte er seit Beginn des Russlandfeldzuges. Großmann war kräftig, er hatte als Metzger gearbeitet. Kleber war ein zierlicherer Typ, er war direkt nach dem Abitur in die SS eingetreten. Obwohl er schmächtig wirkte war er einer der besten Handgranatenwerfer der Kompanie, er wandte eine etwas wundersam anmutende Technik an. Er warf die Granaten nicht wie die anderen mit nach vorn schnellendem Arm über den Schulterbereich sondern mehr aus Hüfthöhe. Das Ergebnis war frappierend, denn er erzielte große Weiten und eine hohe Treffgenauigkeit. Seine Ergebnisse kommentierte er immer gern, er war sehr gesprächig. Großmann war sein Gegenpart. Er wirkte wie ein Teddybär aber war dennoch sehr beweglich und schnell. Die drei Männer gingen hintereinander, keiner hatte Lust zum Reden. Mit ihnen marschierten hunderte Soldaten auf das Tor in die Freiheit zu, aber keiner wusste, wie lange sie es noch passieren konnten. Die in ihrem Rücken feuernde russische Artillerie trieb sie zusätzlich an. Die Einschläge schienen kein Muster zu haben, sie streuten willkürlich im Gelände und das vergrößerte die Panik noch mehr.
Nach weiteren vier Kilometern erreichten sie den Gniloi Tikisch. Der sonst so sanft vor sich hin plätschernde Bach war durch die Schneeschmelze zu einem reißenden Fluss mit gut 15 Meter Breite angeschwollen. Am Ufer drängten sich hunderte deutsche Soldaten. Sie mussten ans andere Ufer kommen, dort lag Lysjanka. Im Wasser erkannte Weber einige Pferdefuhrwerke. Die verzweifelten Männer hatten die Pferde ausgeschirrt und die Wagen ins Wasser gestoßen, denn es gab, so wie er es vermutet hatte, keine Behelfsbrücken. Etwas weiter rechts von ihnen versuchten Soldaten eine Menschenkette im Wasser zu bilden. Der erst Mann stand bis zum Brustkorb im Wasser, und er hatte noch nicht einmal die Mitte erreicht. Offensichtlich war das Wasser mehr als zwei Meter tief. Als der Soldat noch weiter ans andere Ufer gelangen wollte wurde er von den Füßen gerissen und von der starken Strömung mitgenommen. Die anderen in der Kette hatten jetzt eingesehen, dass sie so nicht weiter vorankommen könnten und dann versuchten sie schwimmend herüberzukommen. Günther Weber hatte schon von der Uferböschung aus gesehen dass die Kraft des Wassers enorm hoch war, und dass selbst ein geübter Schwimmer kaum eine Chance haben würde das andere Ufer zu erreichen, zumal alle ihre schweren Winterdienstuniformen trugen und die Stiefel voller Wasser waren. Die Männer im Wasser wurden flussabwärts abgetrieben und nur einigen wenigen gelang es an westliche Ufer zu kommen und sich an Wurzeln festzuhalten. Damit waren sie aber noch keineswegs gerettet, denn die Uferböschung war sehr steil und zum Teil stark ausgewaschen. Trotz des Tauwetters waren im Schutz der Uferböschung noch Teile des Flusses vereist, und einige Männer wurden unter diese Schicht gedrückt und ertranken. Günther Weber wollte sich dieses Drama nicht mehr länger mit ansehen, aber Kleber kam ihm zuvor.
„Das gefällt mir gar nicht“ sagte er „das ist die falsche Stelle. Eigentlich müsste man am anderen Ufer Lysjanka sehen können. Ich sehe aber nur freies Feld. Hier rüberzugehen ist Quatsch. Selbst wenn wir es schaffen sollten wären wir bis auf die Knochen nass, und das bei diesen Temperaturen. Es ist zwar kein Frost, aber ich schätze, es sind gerade einmal zwei Grad. Da wäre es besser sich gleich zu erschießen, dann geht es schneller.“
„Dafür gibt es noch keinen Grund“ erwiderte Großmann ruhig „wir sind noch lange nicht am Arsch.“
„Hier rüberkommen zu wollen ist aussichtslos“ stimmte Weber Kleber zu „wir müssen uns eine andere Stelle suchen. Flussabwärts müsste die Strömung eigentlich abnehmen. Wir gehen in diese Richtung. Dort müsste auch Lysjanka liegen.“
Die drei Männer gingen am Fluss entlang in nördliche Richtung. Hinter ihnen schoben die Soldaten weitere Pferdefuhrwerke in das tosende Wasser. Die leichteren Gefährte wurden sofort von der Strömung weggerissen und trieben ab. Einige schwerere Wagen blieben verkeilt im Fluss liegen, aber diese hölzerne Brücke in die Freiheit reichte gerade einmal bis in die Mitte des Gewässers. Das war nicht weit genug. Aber die Soldaten verloren durch die näherkommenden Granateinschläge immer mehr die Nerven und konnten nicht mehr klar denken. Einige kletterten über die im Fluss liegenden Fuhrwerke, standen dann unentschlossen da, aber sprangen schließlich in das eiskalte Wasser.
Günther Weber war mit seinen beiden Begleitern gut zwei Kilometer marschiert, als ein paar schäbige Holzhäuser sichtbar wurden, Lysjanka. Auch dort waren viele Soldaten zu erkennen. Zu seiner großen Erleichterung sah Weber, dass es eine Behelfsbrücke gab, und am anderen Ufer drei Panzer IV standen. Sie hatten doch noch einen Ausweg gefunden. Als sie am Flussufer auf diese Stelle zugingen schaute Weber in das Wasser.
Immer wieder trieben leblose Körper vorbei, diese Männer würden zwar auch Lysjanka erreichen, aber als Leichen.
Fred Beyer, 17. Februar 1944, vor Lysjanka
Durch seine langjährige Erfahrung im Panzerkampf war Fred Beyers Vorahnung bestätigt worden. Als die „Panther“ noch knapp 500 Meter von den russischen Stellungen entfernt waren wurden sie von den PAK unter Beschuss genommen. Die wenigen übrig gebliebenen
T 34 waren hinter die eigenen Linien geflohen und hatten die Soldaten in den Gräben im Stich gelassen. Sieben Panzer V rollten in der ersten Reihe, vier in einigem Abstand hinter ihnen und jeweils zwei sicherten die Flanken. Die Fahrzeuge bildeten keinen Panzerkeil wie bei „Zitadelle“ vor Kursk, sondern hielten weite Abstände. Diesmal war es kein Begegnungsgefecht zwischen beweglichen Einheiten, wo diese Formation ihren Sinn gehabt und sich sehr gut bewährt hatte. Damals hatten die kampfkräftigeren Panzer die Spitze gebildet und waren an den Flanken gefahren, um die schwächeren Einheiten zu schützen. Hier rollten sie wegen dem schlammigen Boden nur langsam auf die PAK zu, die damit den Vorteil einer guten Zielmöglichkeit hatten. Die Kampfwagenkanonen der „Panther“ waren mit Sprenggranaten geladen, gepanzerte russische Fahrzeuge waren an diesem Abschnitt nicht mehr in Sicht. Die Panzer hatten die Grabenbrüstungen heftig unter Beschuss genommen aber das Gelände führte leicht hangaufwärts, und damit waren die PAK nur schwer zu erkennen. Die Russen hatten ihre Geschütze zudem noch geschickt eingegraben, so dass nur die Rohre der Waffen und Teile der Schutzschilde aus den Gräben herausragten. Was sie allerdings nicht bedacht hatten war, dass die PAK für die vorangegangenen Kämpfe so gut wie es eben möglich gewesen war mit weißer Farbe angestrichen worden waren, um diese unter den bis vor kurzem herrschenden winterlichen Wetterbedingungen mit viel Schnee gut tarnen zu können. Der Wetterumschwung hatte den Schnee jedoch fast vollständig abtauen lassen, und das Gelände war nur noch an wenigen Stellen mit weißen Flecken gesprenkelt. Obwohl es weder den Deutschen noch den Sowjets gelungen war eine haltbare weiße Farbe auf Panzer und Geschütze aufzubringen, waren doch etliche Teile der PAK noch weiß geblieben. Fred Beyer hatte einige der Rohre wie weiße Finger auf ihre Panzer zeigen sehen und damit war ihm auch eine Zielansprache möglich gewesen. Lahmann hatte von links nach rechts beginnend mit dem Beschuss begonnen. Beyer hatte keinen Schießhalt befohlen, denn der Panzer kam jetzt nur noch mit kaum fünf Kilometern in der Stunde vorwärts und der weiche Boden ließ ihn auch nur minimal federn. Der Abstand zwischen den deutschen Panzern und den russischen Geschützen betrug jetzt keine 400 Meter mehr, und die Geschosse der leistungsstarken Divisionskanonen und den Kampfwagenkanonen würden auf diese kurze Distanz verheerende Wirkungen haben. Die Ladeschützen beider Seiten wussten auch, dass ihre Schnelligkeit über Leben und Tod entscheiden konnte. Die deutschen Richtschützen standen vor dem Problem, dass sie kaum etwas von ihren Zielen sahen, die russischen mussten mit negativer Rohrerhöhung schießen.
Читать дальше