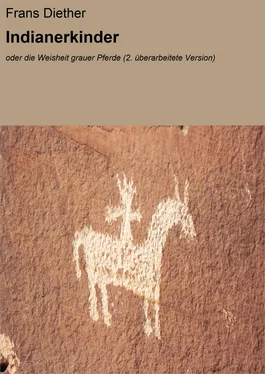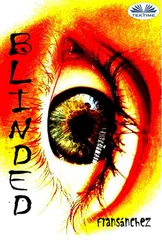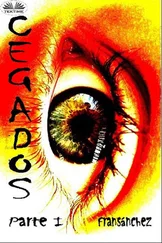"Hier trink, wir wollen ja nicht, dass du verreckst. Das kannst du auf dem Feldzug in Mexiko immer noch tun."
Begierig saugte Francis das Wasser auf.
"Das reicht."
Die Flasche wurde weggenommen, dann legte sich Saddick neben den Wagen. Johnson versorgte die Pferde und band ihnen die Vorderbeine zusammen.
"Wir wollen ja morgen nicht laufen müssen." Mit diesen Worten setzte er sich neben Saddick und hielt die erste Wache. Sie wechselten sich ab bis zum Morgen, dann ging es weiter. Francis schleppte sich mühevoll in die Kutsche.
"War dir hoffentlich eine Lehre." Johnson tat es schon fast leid. Er hatte doch wirklich einen angehenden Kameraden und keinen Verbrecher vor sich. Aber warum musste der Mann auch so austicken. Beim Militär kam es auf Beherrschung an. Davon konnte das Überleben der ganzen Einheit abhängen. Vielleicht war es Prügel zur rechten Zeit, versuchte er sich in Gedanken zu rechtfertigen.
Nach etwa einer Stunde bemerkte Francis eine feine Staubwolke am Horizont. Er schien nicht zu träumen. Es waren Reiter. Und sie hielten direkt auf ihn zu. Die Kutsche beschleunigte merklich. Francis verstand nicht, was seine Bewacher sprachen. Sie schätzten die Situation offenbar als bedrohlich ein. Plötzlich ein lautes "brr". Die Bremse quietschte. Der Wagen stand.
"Wir spannen die Pferde aus, sie holen uns sonst ein. Verdammte Rothäute." Saddicks Stimme klang wirklich besorgt.
"Bist du sicher?"
"Ich hab solch einen Überfall schon mal nur knapp überlebt."
In großer Eile löste Johnson das Geschirr. Schon sprang Saddick auf das erste Pferd.
"Und er?", fragte Johnson beim Aufsitzen.
"Abknallen."
Francis duckte sich blitzschnell, da pfiff bereits die erste Kugel über seinen Kopf. Zum Glück hatten seine Bewacher wenig Zeit.
"Weg, weg", rief Saddick.
"Hast du ihn?"
"Ja, ja, nichts wie weg." Saddick schoss erneut, dann folgte er dem davon galoppierenden Johnson.
Gerettet, dachte Francis, dann spürte er einen kurzen Schmerz in der rechten Brust. Übelkeit stieg auf. Ihm wurde schwarz vor Augen.
Es war ein Gefühl der Kälte, welches Francis weckte. Gleich darauf kam auch der Schmerz zurück. Über sich gebeugt, sah Francis eine junge Frau mit langem schwarzen Haar und auffällig heller Haut.
"Weißer Schatten?" Seine Stimme war schwach, aber die Frau verstand ihn wohl.
"Ganz ruhig, du hast viel Blut verloren, aber jetzt bist du in Sicherheit."
Francis versuchte seine Arme zu heben. Sie waren frei.
"Wir haben Deinen Schmuck leider abnehmen müssen. Er ist auf dem Krankenlager nicht erlaubt."
Tatsächlich, nur die Schwellung über den Gelenken erinnerte daran, dass hier einmal Fesseln saßen.
"Wir mussten ganz schön feilen. Die Qualität eurer Schmiede ist beachtlich. Hast duDurst?"
Weißer Schatten reichte Francis einen Krug mit Wasser. Er trank begierig, fühlte aber das rasche Schwinden seiner Kräfte.
"Es wird alles gut. Du hast einen jungen Körper und einen starken Willen. Du wirst bald gesund werden."
Nebel umfing seinen Geist erneut. Bruchstückhafte Träume zeigten, wie er aus einer Kutsche gezogen wurde.
'Er lebt.' Im Traum verstand Francis die Diné-Worte. Er sieht sich auf einer Art Schlitten liegen. Ein Teil der Indianer bleibt bei der Kutsche, mit Ihnen ein Hund. 'Er gibt sein Blut für das des Weißen.' Der Hund wird in die Kusche gesperrt. Schüsse fallen. Holz splittert. Die Indianer ziehen einen blutigen leblosen Körper aus der Kutsche. Der Schlitten setzt sich in Bewegung. Was bedeutete dieser Traum? Francis konnte es nicht ergründen.
"Hey du Schlafmütze, es ist Zeit fürs Frühstück." Weißer Schatten hatte ihren Patienten wohl schon eine Weile beobachtet. "Du hast kein Fieber mehr. Jetzt musst du essen und trinken, dann werden wir Deinen Körper trainieren."
Jede Bewegung schmerzte und der Gedanke an körperliches Training war Francis unangenehm. "Wo bin ich?"
"In Sicherheit. Du bist zu mir zurückgekehrt, nicht freiwillig, o nein, man musste dir erst Ketten anlegen. Und du bist auch nicht wirklich gekommen. Ich habe dich abgeholt, aber egal, jetzt bist du da."
Francis stärkte sich mit Früchten und Brot. Es ging ihm viel besser. Welchen Anteil die Gegenwart von Weißer Schatten daran hatte, war ihm unklar. Aber sie hatte Anteil daran, das stand für ihn fest.
"Sucht man nach mir? Was wurde aus meinen Kindern?"
"Dubist tot. Nach Toten sucht man nicht. Und was heißt deine Kinder? Du hast keine Kinder. Du durftest zwei junge Diné ihrem Stamm zurückgeben." Weißer Schatten nahm die rechte Hand ihres Patienten und strich zärtlich darüber. "Dort sind sie gut aufgehoben. Dich wollte man dort nicht. Deshalb war es allen recht dich weit entfernt zum Militär zu schicken. Man machte sich auch viel Mühe dich wohlbehalten zu transportieren. Aber man rechnete nicht mit der Klugheit meines Vaters."
"Deines Vaters?"
"Nevada Johns nennt ihr ihn. Sein wahrer Name ist Der mit dem Falken fliegt. Er hat dir doch versprochen, dass du gerettet würdest."
"Gerettet? Um ein Haar wäre ich wirklich gestorben."
"Wäre, würde, hätte, es zählt doch nur was ist. No Risk, no Fun, erinnerst du dich? Wichtig ist, dass du lebst und alle deine Verfolger an deinen Tod glauben. Deine zwei ehemaligen Bewacher haben ihr Bestes dazu beigetragen. Sie schworen Stein und Bein, erst unter Beschuss geflohen zu sein. In der Kutsche fanden sich dann auch reichlich Blut und verspritztes Gewebe. Und die Lage der Einschüsse ließ keinen Zweifel aufkommen. Der angehende Soldat Francis Blackwater starb, von mehreren Kugel getroffen. Saddick und Johnson traf keine Schuld. In der Kürze der Zeit konnten sie ihn nicht retten. Die marodierenden Indianer hatten ihn auf dem Gewissen."
Weißer Schatten lachte triumphierend. "Hundeblut sieht aus wie Menschenblut."
Sie sah Francis spitzbübisch an. "Allerdings hast du davon auch Deinen Namen. Der vom Hund gerettet wurde, heißt du jetzt offiziell. Meistens nennen wird dich nur kurz Amadahy."
Francis verstand nicht wirklich, doch Weißer Schatten sprach unbeirrt weiter. "Der Name des Hundes, der dich rettete, war Amadahy. Das ist Cherokee, übersetzt Waldwasser. Klingt doch schön, oder? Eigentlich ist's ja ein Frauenname. Der Hund war ein Weibchen, aber ganz egal. Cherokee versteht hier eh keiner. Und überhaupt, es zählt nur, dass du lebst. Freu dich, du bist so frei, wie ein Mensch nur frei sein kann."
Doch Francis - Amadahys - Gedanken waren weit entfernt. "Kann ich sie sehen?"
"Sie?" Natürlich verstand Weißer Schatten sofort und hob abwehrend die Hände. "Noch mal, es sind nicht deine Kinder. Was hast du nur an ihnen gefressen? Sie erfuhren genug Leid. Vergiss sie. Sie sollen bei ihrem Stamm aufwachsen. Wenn du Indianer spielen willst, dann bleib bei uns."
"Ihr habt viel für mich getan. Ihr habt sogar einen unschuldigen Hund für mich erschossen. Ich werde euch immer dankbar sein, aber ich muss wissen, ob es den beiden gut geht. Weiße Feder nannte mich Vater und ich bin ihr verpflichtet. Du sagst, ich bin frei und eigentlich tot. Was soll mir noch passieren. Man stirbt nur einmal."
"Dann steh doch auf und geh, wenn du kannst." Sie drehte ihr hübsches Gesicht zur Seite. Francis versuchte sich aufzurichten. Es gelang nicht.
"Weißer Schatten, ich wollte dich nicht beleidigen. Du hast mich gerettet. Lass uns Freunde sein. Was die Zukunft bringt, soll die Zukunft bringen."
"So sei es." Stolz ging sie aus dem Zelt.
Die Tage zogen dahin. Es wurde Winter. Kalte Stürme tobten über die Shadow Lands. Francis Wunden waren verheilt. Nur einige Narben zeugten von den vergangenen Ereignissen. Er hatte sich in die Gemeinschaft der Indianer eingelebt, konnte ihre Sprache verstehen und einigermaßen sprechen. Weißer Schatten, die durch ihre Erziehung in zwei Welten fließend Englisch beherrschte, war ihm Lehrer, Schwester und manchmal auch mehr. Doch es gab da noch die Welt seiner Träume und darin drei Hauptakteure, Husky, Weiße Feder und Kleiner Wolf. Er konnte nur hoffen, dass es ihnen gut ging. Auf seine diesbezüglichen Fragen antwortete Weißer Schatten stets ausweichend. "Ist schon alles in Ordnung. Das ist eine andere Welt. Ihr solltet einander vergessen. Alles andere bringt nur Leid."
Читать дальше