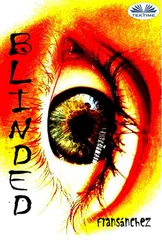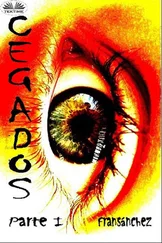Frans Diether
Siebenhundertfünfundachtzig
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel Frans Diether Siebenhundertfünfundachtzig Dieses ebook wurde erstellt bei
Vorwort
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Nachwort
Impressum neobooks
Über Jahrhunderte lebten die Sachsen im heutigen Nordwestdeutschland als freie Männer und Frauen, war es nicht Herkunft, sondern Leistung, welche ihre Stellung in der Gemeinschaft bestimmte, verehrten sie Tiere als Boten der Götter und die Edelsten von ihnen, die Pferde, als Götter selbst. Sie kannten keine Könige und keine Vasallen, bis ein fremdes Volk in ihr Land einfiel, zunächst unter dem Hausmeier Karl Martell, später dann unter dessen Sohn Pippin dem Jüngeren. Doch erst dessen Sohn Karl, den man den Großen nennt, vollendete das schändliche Werk, welches Kultur, Lebensweise und Glauben der sächsischen Stämme, heute würde man sie indigen nennen, vernichtete.
Siebenhundertdreiundfünfzig, Karls Geburt jährte sich zum elften Male, nahm ihn der Vater mit auf den Feldzug gen Norden, gegen die Barbaren, wie sie die in kleinen Familienverbänden lebenden Bewohner der wald- und wasserreichen Gegend nannten. Und der zukünftige König sah, mit welchem Mut die Feinde kämpften und lernte, sie zu besiegen, bedurfte größter Entschlossenheit und Härte. Während er mit den Kindern der Hauptleute Sachsenjagd spielte, jagte sein Vater, fern der Ehefrau und getrieben von männlichem Verlangen, den Sachsenweibern nach und weihte auch den Sohn schon früh in die Freuden des Liebesspiels ein.
Warnechin, der Sachse, ließ seine wunderschöne Frau Gunilda und den gemeinsamen Sohn Widukind auf dem Hof zurück, stellte sich mit anderen tapferen Männern der fränkischen Streitmacht entgegen, war nicht zu Hause, als die Frankenkrieger sein Heim überfielen, die Frau verschleppten, der Sohn nur überlebte, weil er sich unter den Leibern der Getöteten verbarg. Und der König tat der schönen Sächsin Gewalt an. Erst in der folgenden Nacht konnte sie entfliehen, seinen Siegelring als Preis mit sich nehmend.
Pippins Truppen zogen sich zurück. Der Frankenkönig fand noch viele Frauen auf seinem Weg, ließ seinen Schreiber ob des verlorenen Siegels auspeitschen, vergaß Gunilda, so wie er die anderen Frauen vergaß. Doch Gunilda vergaß ihn nicht, hatte das Zusammensein doch Folgen, welche neun Monate später offenbar wurden. Zwillinge kamen zur Welt, Kunibert und Adalmar. Und obwohl sie wusste, dass beide Früchte des Gewaltakts waren, liebte sie die Kinder von Herzen, erzog sie mit aller Weisheit und als freie Männer. Doch ihr Mann, zurückgekehrt nach langem Kampf, verstieß die Bastarde, gab seinen ganzen Hass an den eigenen Sohn Widukind weiter, der schwor, niemals einer fremden Macht zu weichen und stets das Land der Sachsen, die Götter der Sachsen, die Freiheit der Sachsen zu verteidigen. Adalmar und Kunibert hingegen mussten bei der Familie eines Unfreien leben, von morgens bis abends hart arbeiten. Hunger hieß nun ihr Vater und Angst ihre Mutter. Doch während Kunibert lernte, durch Gewalt zu bestehen, steckte Adalmar alle Demütigungen ein. Und während sein Bruder sich mit fünfzehn Jahren, im Todesjahr seines Vaters, zwei Wegelagerern anschloss, sich einem Leben des Raubens, Mordens aber auch des Wohlergehens zuwandte und die Vergangenheit hinter sich ließ, betrachtete Adalmar oft den Ring, den ihm die Mutter gab, kurz bevor er auf ewig von ihr getrennt wurde.
"Er stammt von deinem Vater", sagte sie damals.
Und Adalmar holte Erkundigung ein, forschte nach seinen Wurzeln, wusste es irgendwann sicher, sein Vater war ein König. Als ein Missionar, das Evangelium des Christus, die Lehre des neuen, einzigen, wahren Gottes predigend, die armselige Hütte von Adalmars Pflegeeltern aufgrund ihrer Schäbigkeit schon hinter sich lassen und einem reichen Hofe zustrebten wollte, rannte ihm der Junge nach, wich ihm nicht mehr von der Seite, folgte ihm bis ins Frankenreich. Die neue Lehre ergriff Adalmars Seele. Der einzige und wahre Gott versprach Heil und ewiges Leben und absolute Gerechtigkeit. Und der Sohn eines Königs schloss daraus, sein Recht einzufordern. So zog er denn mit dem Ring als Unterpfand bis an Karls Hof, bis zu seinem Halbbruder.
Rasch verbreitete sich die Kunde von Pippins unbekanntem Nachkommen. Rasch erfuhr auch Karl davon und rasch handelte er. Schon sein Bruder Karlmann, mit dem er das Reich des Vaters teilen musste, bereitete ihm ständige Qual. Da kam ein weiterer Besitzanspruchsteller höchst ungelegen. Ohne dass Adalmar den jungen König je sah, hatte der bereits über sein Schicksal entschieden, ihn betäuben, binden, auf einem harten Wagen davonbringen, in einem finsteren Kerker anketten und abgeschottet von der Welt ein erbärmliches Dasein fristen lassen, streng bewacht von Männern, die seine Geschichte nicht kannten und ihn für verrückt hielten, da er sich als Bruder des Königs bezeichnete.
"Einen wie dich muss man ja wegsperren", riefen sie und lachten laut. "Auf den Bruder des Königs, möge er seinen Schmuck mit Würde tragen."
Adalmar schäumte dann immer vor Wut, zerrte an seinen Ketten, rüttelte an diesem grauenvollen Schmuck. Doch ändern konnte er nichts.
Noch ein Hinweis, zur besseren Verständlichkeit werden bei geografischen Angaben die heute gebräuchlichen Namen verwendet.
Pfeilschnell flog ein schneeweißes Pferd am Ufer der Weser entlang. Auf dem ungesattelten Rücken trug es einen braun gebrannten Jungen. Dessen Finger krallten sich in die wehende Mähne, deren vom Wind getragenes Haar sich mit den langen blonden Strähnen des Reiters mischte. Nackt bis zum Gürtel schmiegte er seinen schmalen Oberkörper eng an den Hals des Tieres. Seine schuhlosen Füße umklammerten die Flanken des Freundes. Die beiden, Tier und Mensch, schienen eins zu sein und untrennbar. Gemeinsam flogen sie dahin unter der goldenen Septembersonne, die ihre glitzernden Strahlen vom wolkenlosen Blau des Himmels schickte und das Braun des Jungen auf dem Fell des Pferdes wie einen von Schnee gesäumten Flecken Erde erscheinen ließ. Sanft wogendes Gras, hoch fliegende Schwalben, den Spätsommer besingende Grillen, all das malte ein Bild des Friedens, ein Bild des Glücks. Das Dorf war bereits hinter dicht stehenden Bäumen verschwunden. Nach der nächsten Biegung würden die Felder beginnen, deren reife Ähren genug Nahrung für den Winter bieten sollten.
Die Biegung war genommen, die Felder kamen in Sicht. Doch statt satter Ähren standen dort verkohlte Stoppel. Und verbrannter Geruch griff nach dem Jungen, ließ Falko, den Dreizehnjährigen, Sohn des Eno und der Gefion, nicht mehr los. Er durchdrang seinen Körper, als die Fremden sein Dorf anzündeten. Er schwebte im Wald, als er davonlief, zog bis in den letzten Winkel, in dem er sich tagelang versteckte. Der Geruch verschwand nicht, als das Feuer erlosch. Er blieb allgegenwärtig, so wie das Bild des sterbenden Bruders Beron und dessen letzte Worte. "Rette unseren Vater!"
Beron zeigte dabei nach Norden, dann fiel sein Arm zu Boden, wirbelte eine Staubwolke auf und blieb schlaff in der Asche liegen. Und Falko schwor es dem Bruder, schwor bei allen Göttern und allem, was ihm lieb und teuer war. Unter Aufbietung aller Kräfte trug er die Toten zusammen. Tränen verschleierten seinen Blick. Als er sie sah, seine kleine Schwester Birin, den todbringenden Pfeil noch im Rücken und von diesem gleichsam ans Herz der Mutter genagelt, versagten seine Beine. Auf Knien rutschend, brachte er sie zu den Anderen, übergab ihre Leiber den heiligen Flammen, befreite ihren Geist aus der nutzlos gewordenen Hülle. Dann jagte er los, so wie er vom Feld kam, ohne Nahrung, ohne Waffe, ohne Hemd, ohne Schuhe, aber gemeinsam mit seinem treuen Freund Gis, seinem Pferd. Er musste nur den Spuren folgen, den Pferdeabdrücken der Sieger und den Fußabdrücken der Verlierer. Er würde die Fremden finden. Er würde kämpfen. Er würde Eno, den Vater, befreien oder sterben. Und er jagte vorbei an den verkohlten Stoppeln, an der vernichteten Ernte, die jetzt gleichsam dort war, wo auch seine Mutter, seine Geschwister, sein Stamm waren, im Reich des Todes.
Читать дальше