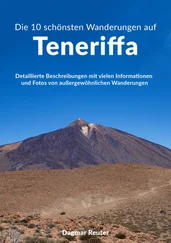Nein, ich stehe auf keinen Fall feindlich dem anderen Geschlecht gegenüber und habe Mitgefühl für Männer, die nicht mehr können, aber immer noch wollen müssen. Ich gebe zu, dass meine sich in diesem Bereich offenbarende Überlegenheit als Frau mir einen gewissen Spaß bereitet. Aber Objekt auch noch dann zu sein, wenn es mir schlecht geht und übel ist, ist grausam und unwürdig. Meinem Mann dies begreiflich zu machen, würde für mich Glück bedeuten und ich wäre imstande, ihn noch mehr zu lieben. Und, was damit unabdingbar verbunden ist, mit ihm öfters Sex haben wollen. Mal wieder richtig wild zu werden im Bett, wie ich das kenne, und wogegen ich im Prinzip nichts habe. Aber dazu muss vor allem der Alp weg, der sich auf meinem Brustkorb ausgebreitet hat.
Das Obige sind meist Überlegungen darüber, was ich so im Leben über den Sex mitbekam, denn ich kann mich über diesen Bereich nicht beklagen, mein Mann vielleicht eher. Aber auch hier will ich nicht schweigen, denn ich wünsche mir, dass mein Mann mehr Empfindsamkeit entwickelt, was meine diesbezüglichen Gelüste anbetrifft. Ich wünsche, dass er sich eine Antenne zulegt, die ihm signalisiert, ob es uns möglich ist, sich nah zu kommen, zu entspannen, oder ob ich in einer so miesen Stimmung bin, dass ich durch diese bedingt, gereizt reagiere und ihm wehtue, denn niemand mag abgewiesen werden. Darüber hinaus neigt ein Abgewiesener die Schuld dafür bei sich selbst zu suchen, dabei hat er nur zur falschen Zeit etwas aufs Tapet gebracht, was der andere, auch wenn er wollte, ihm nicht erfüllen kann, weil keiner kann geben, was er im Moment nicht hat. Ich möchte meinen Mann am liebsten nie abweisen. Aber mir ist bewusst, dass ich vorläufig kaum in der Lage sein werde, immer seinem Wunsch nach Sex zu entsprechen. Dafür wiegt all das, was in meinem Gefühl, in meiner Seele nicht im Lot ist, viel zu schwer. Es muss erst gerichtet werden. Diesem Ziel bin ich auch mit dieser Teilschrift näher gekommen.
Auch das mit dem neuen Ehebett, um das ich einen zweijährigen Kampf führen musste, hatte ich mir anders vorgestellt. Ich bin doch nicht ein Bettaccessoire und schon gar nicht eine ausgediente Matratze! Ich bin eine Frau. Um mich muss geworben werden, und zwar liebevoll geworben werden.
5. Mein Leben in Bildern
Vor mir liegt ein Stoß Alben. Ich blättere darin. Es fängt ganz stereotypisch an: Meine Großeltern. Mein Vater in Wehrmachtsuniform. Hochzeitsbild meiner Eltern. Ich als Kind mit meinen Eltern und Geschwistern, meine Einschulung, die Tüte so groß wie ich, Erstkomunionfeier. Unverhofft folgen die Fotos vom Begräbnis meiner Mutter, danach welche, die zum Teil lange vor meiner Geburt gemacht wurden und meine Altvorderen darstellen.
Die nächsten zeigen mich und meinen Verlobten, der seit 40 Jahren mein Ehemann ist, beim Zusammenkehren der Scherben und Papierschnipsel an unserem Polterabend, uns beide bei der Unterschrift unseres Ehevertrages beim Standesamt, als nächstes unser Hochzeitsfoto, ich sitzend, mein Mann stehend. Der Blumenstrauß aus roten und gelben Rosen viel üppiger als auf dem Standesamt, weißes Kleid, Schleier, mit Spitze gesäumte lange Schleppe. Kirche, Pfarrer, Gelöbnis, weiße Kutsche, Hochzeitsfeier, Walzer mit meinem Mann.
Überall sehe ich eine junge Frau, voller Hoffnung, Erwartung und Zuversicht auf die Dinge des kommenden Lebens. Und die kamen auch, jedenfalls laut der Bilder: Hausbau, Kinder, erstes Auto, Urlaub, Ausflüge, Bootsfahrten, Karnevalsfeier, Dorffeste, mein Mann mit seinem ersten Trecker. Die Männer auf den Photos meist in Macho-Posen, nicht selten mit Zigarette und Biergläsern in der Hand, die jungen Frauen immer, die älteren nicht immer lächelnd. Friede, Freude, Eierkuchen nebst vielen anderen Speisen, denn der materielle Überfluss war schon längst da. Der innere Druck, die seelische Not sind den Photos nicht zu entnehmen und ich schätze, ich bin nicht die einzige Person auf diesen Photos, die psychisch unzufrieden war.
Und immer wieder unsere Kinder: Im Steckkissen, im Himmelbett, auf dem Töpfchen, im Sandkasten, auf dem Schlitten im Schnee, beim St. Martinszug, unterm Tannenbaum, kostümiert zu Karnevalszeit.
Alles in allem spiegeln die Photos ein erfolgreiches bürgerliches Leben, festgehalten auf Hochglanzpapier. Dass ich in ihm von Anfang an die Rolle der Magd, des willenlosen Mädchens für alles übernommen hatte, geht aus den Photos nicht hervor. Ich dachte, ja, hoffte, ich war der Meinung, dass man mit Fügsamkeit das Glück herbei zwingen kann. Heute muss ich feststellen, es war ein tragischer Irrtum. Man hatte mich. Man hatte mich wie man ein Haus hat, ein Auto, ein Hobby. Was beschwere ich mich? Ich Carmen, hatte doch auch alles: Einen Mann, zwei Kinder, Haus, Hof, Einkommen, Freunde, Auto, Nachbarn, und vor allem eine robuste Gesundheit, um meinen Pflichten, wie auch dem, was ich für meine Pflicht hielt, gerecht werden zu können. Für all das bin ich dankbar, bloß: Es stellte mich nicht zufrieden, weil sich keiner vorstellen konnte, das ich es nötig hatte, gleichberechtigt zu sein. Ich selber hatte verdrängt, mir die Gleichberechtigung zu holen. Meine Lage war vielleicht vergleichbar mit der althergebrachten Überzeugung der Leute, dass zwei junge Menschen, die mit ihrem zwar naturgemäßen aber unverantwortlichem Verhalten ein Kind zeugten, nur vor den Altar zu treten brauchen und die Liebe, sobald geheiratet war, sich schon von alleine einstellt. Bloß mir fehlte nicht so sehr die Liebe, wie die Gleichberechtigung in der Ehe.
Mein Mann drängte nach vorn und ich lief mit. Diese Feststellung bedeutet nicht, dass ich etwa keine Kinder, kein Haus, keinen materiellen Wohlstand haben wollte. Aber mein Leben in der Ehe ist vergleichbar mit dem Schicksal des Babys, das man wickelt, ohne es danach zu fragen, ob es gewickelt werden will. Es ist vergleichbar mit dem psychisch Kranken, den man in eine Gummizelle sperrt, auf dass er sich keine Beulen zuzieht. Mit dem willenlosen Alten, den man immer noch mit Medikamenten und Nahrung versorgt, ohne Rücksicht darauf, ob er weiterhin leben möchte oder inzwischen nur noch einen Wunsch hat: Sobald wie möglich zu sterben.
Ich blättere weiter in den Alben und sehe unser erstes Kind, eine Tochter, in einem Körbchen auf einer Wiese inmitten der Sumpfdotterblumen platziert. Die Tochter mit Kuscheltier am Kinderwagen unseres Sohnes einige Jahre später. Und fast überall ich, die lachende Carmen, das selbst entmündigte Werkzeug zur Erfüllung der Wünsche anderer, der damals überhaupt nicht bewusst war, was mit ihr geschah und wohin die Reise gehen wird. Carmen oder das Lächeln inmitten einer üppigen Mähne von langen, gelockten, roten Haaren. Unter dieser Oberfläche eine hungrige, schreiende Seele.
Heute ist mir bewusst, welch eine Not man hinter Lachen verbergen kann. Ungeachtet dieser Erkenntnis und meines dauerhaften seelischen Tiefs, lache ich immer noch viel. Neckisch sprach mich neulich ein Mann in der Stadt an: „Was strahlen Sie denn so?! Sie sind ja nicht die Sonne!“ Mir wurde schlagartig klar, dass ich genau das in meinem Leben hin und wieder sein wollte: Ein bisschen Sonne. Oder zumindest ein fahl schimmernder Stern.
Vielleicht war ich das auch für meinen Mann und meine Kinder. Allein, sie hatten es mich nie spüren lassen.
6. Die Notizen
Ich habe immer noch den Ordner mit meinen Notizen aus vielen Jahren vor mir liegen. Ein Terminkalender des Jahres 2009 ist darunter, Hefte, Schreibblöcke, einzelne Blätter. Die Notizen an sich sind verstörend. So sehr sie mir im Augenblick ihrer Niederschrift eine Erleichterung verschafften, so wertlos erscheinen sie mir in der Gegenwart. Ja, immer, wenn der Druck übermächtig war, und ich nicht trinken wollte, habe ich ihn mittels Kugelschreiber zu entschärfen versucht und es half, daran erinnere ich mich sehr gut. Heute jedoch sind mir diese Zeilen nur ein hilfloses Winseln.
Читать дальше