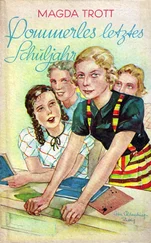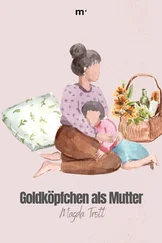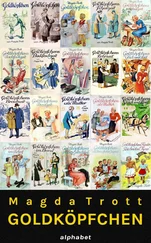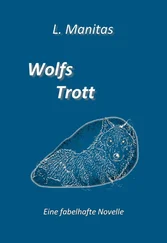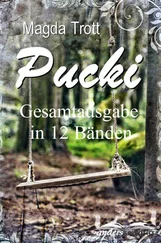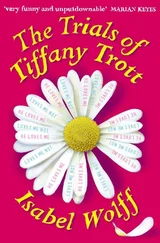»Nun wirf du doch mal!«
Anita Schleifer schleuderte geziert die Apfelschale über die linke Schulter. – Da lag ein deutliches »S«.
»Na also«, sagte Bärbel mit teuflischer Schadenfreude, »wenn man sich den Anfangsbuchstaben seines Vatersnamen wirft, bleibt man ledig.«
»Ach, hast du ’ne Ahnung«, entgegnete Anita ein wenig verächtlich und wandte sich an den roten Domino: »Darf ich Sie bitten, Herr Rittergutsbesitzer, mich zu den Erfrischungen zu führen.«
Um drei Uhr morgens war Schluß des Festes. Die Jugend bestürmte zwar Herrn Wagner leidenschaftlich, er möge doch noch ein Stündchen zugeben. Aber der Apothekenbesitzer erklärte mit eiserner Energie, es sei nun genug.
Beim Abschiednehmen küßte Wilhelm Wolf Bärbels beide Hände.
»Auf Wiedersehen, mein gnädiges Fräulein. Treffen wir uns morgen nachmittag wieder in der Konditorei?«
»Nein«, sagte Bärbel, »ich habe mich bereits mit drei anderen Herren verabredet, – es mangelt mir an der Zeit.«
»Wie soll ich das ertragen?«
»Verabreden Sie sich doch mit Anita.«
»Warum tun Sie meinem Herzen so weh?«
»Das große Weh muß ein jeder erfahren, Herr Rittergutsbesitzer.«
Bärbel schlief trotz der gehabten Enttäuschung wundervoll. Beim Einschlafen dachte sie noch an die freundlichen Worte des jungen Provisors, der mit Bärbel viel getanzt hatte und der ihr so manchen harmlosen Witz erzählt hatte.
»Er heißt zwar Mittelmann, aber er ist doch besser als die anderen Männer.«
Das waren Goldköpfchens letzte Gedanken, dann schlummerte es süß und fest ein.
Am nächsten Morgen gab es in der Apotheke eine große Aufregung. Zuerst wurde von Herrn Schleifer geschickt und angefragt, ob man dort beim Aufräumen Anitas Brillantring gefunden hätte. Darauf stellte Apotheker Wagner fest, daß ihm aus dem Eßzimmer eine kleine, wertvolle Bronze fehlte, und schließlich schickte auch Herr Gebert, einer der geladenen Tänzer, hin, um anzufragen, ob er gestern sein Portemonnaie liegen gelassen habe.
Drei Stunden später erschien ein Kriminalbeamter, der streng vertraulich Herrn Wagner zu sprechen wünschte. Es stellte sich heraus, daß Herr Wolf ein gesuchter Hausdieb sei, der eigentlich Winkelstern hieße, und der von Ort zu Ort reise, sich in die Familien unter einem falschen Namen einführe, um dort Hausdiebstähle zu begehen.
Für Wagners war dieser Vorfall recht peinlich, zumal man den angeblichen Rittergutsbesitzer im Hotel nicht mehr erwischt hatte. Er war mit dem Frühzuge bereits aus Dillstadt abgefahren, und niemand wußte, wohin.
»Da hat uns unser Bärbel mal wieder etwas Nettes eingebrockt«, sagte Frau Wagner.
»Wir dürfen Goldköpfchen keine Schuld geben, liebe Frau, wir hätten diesen uns fremden Mann nicht in unser Haus bitten dürfen, auch wenn die Erkundigungen gut waren. Ich hatte von vornherein ein Mißtrauen gegen diesen Burschen.«
Man war zunächst bemüht, die Angelegenheit geheimzuhalten: aber der Hotelbesitzer, der selbst stark geschädigt worden war, trug die Sache im Ort herum, und so erfuhr auch Bärbel davon.
»Das ist stark«, sagte das junge Mädchen empört, »nun wird es nichts mit dem Schweineschlachten und dem großen Glück, – nun ist doch das große Weh da. – Ja, ja, man soll nur den Karten glauben, – Schwindel ist alles! Die dumme Kati weiß gar nichts!«
Maria Koch schöpfte wieder Hoffnung, zumal sie sich heute mit Joachim Wagner in der Konditorei traf; vielleicht hatte Bärbel recht, vielleicht logen die schmutzigen Blätter. Warum sollte gerade Kati die Gabe haben, in die Zukunft zu sehen?
Am ersten Januar schrieb Goldköpfchen ins Tagebuch ein: »Glück im Unglück, – noch habe ich Gerhard Wiese den Abschiedsbrief nicht geschrieben, und ich werde es auch nicht tun. Er hat bestimmt noch keine Bronze geklaut, – er ist ein Ehrenmann! Und an Karl Schilling werde ich auch heute noch schreiben.«
Dann saß sie wieder bei Harald Wendelin und ließ sich von ihm wohl zum zehnten Male »Frauenliebe und Leben« spielen.
Die Weihnachtsferien waren vorüber, Goldköpfchen war wieder nach Dresden zurückgekehrt. Beim Abschied hatten die Eltern ihr Töchterlein ermahnt, im letzten Vierteljahr recht fleißig zu sein, damit Bärbel nicht etwa in der Obertertia sitzenbleibe.
»Ich hoffe ja nicht, Vati, aber mit des Schicksals Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten.«
»Das werden Sie sich selbst nicht antun, Bärbel«, sagte Harald Wendelin, »es ist doch recht peinlich, wenn die Mitschülerinnen weiter kommen und man selbst mit jüngeren wieder von vorn anfangen muß.«
»Gestehen Sie es mir ehrlich, Herr Wendelin, sind Sie niemals sitzengeblieben?«
»Nein, Bärbel, das gab es für mich nicht. Ich wußte, daß meine Mutter ums tägliche Brot stark zu kämpfen hatte, ich habe frühzeitig den Ernst des Lebens kennengelernt, ich konnte die schmale Tasche meiner Mutter nicht mehr belasten. Sie starb mir viel zu früh, ich kam zu Verwandten, und die sahen streng darauf, daß ich die Klassenziele erreichte.«
»Dann haben Sie eigentlich keine sonnige Kindheit gehabt.«
»So glücklich wie Sie, liebes Bärbel, war ich in meiner Jugend freilich nicht, denn mir fehlte das Elternhaus.«
»Nun, ich bin ja jetzt auch im Großelternhaus, aber auch da ist es hübsch, daß man mich zu Ostern in die Untersekunda schiebt.«
Bärbel war mit der besten Absicht nach Dresden zurückgekehrt und stürzte sich auch in den ersten Tagen voller Eifer auf die Arbeit.
Aber der Winter war diesmal so besonders schön und lang. Die Eisbahn lockte, und mancher Seufzer kam über die Lippen Goldköpfchens, wenn es vom Fenster aus die Glücklichen sah, die gleich nach Tisch mit den blitzenden Schlittschuhen zur Eisbahn eilen konnten.
Frau Lindberg sorgte selbst dafür, daß Bärbel in diesem sportlichen Vergnügen nicht beeinträchtigt wurde. So verging kaum ein Tag, an dem sie sich nicht mit ihren Mitschülerinnen auf dem Eise tummelte und sich eifrig bemühte, kunstvolle Bogen zu ziehen.
Es blieb natürlich nicht aus, daß sich auf dem Eise die Gymnasiasten des Kant-Gymnasiums mit den Schülerinnen der Obertertia oft trafen. Da aber Bärbel in ihrer offenen Art daheim allen diesen Flirt skrupellos erzählte, lächelte Frau Lindberg nachsichtig dazu und wußte in geschickter Weise bis in die Tiefen dieses Mädchenherzens zu dringen, ohne daß es Bärbel zum Bewußtsein kam, daß sie ein klein wenig ausgehorcht wurde.
Erst ihre um zwei Jahre ältere Schulgenossin, Herta Brodowin, machte Goldköpfchen darauf aufmerksam, daß Schweigen in vielen Fällen besser sei als Reden. Weder Bärbel noch Edith hatten Sympathien für die siebzehnjährige Mitschülerin, von der man allerlei munkelte. Aber man hatte auch wieder Respekt vor der Welterfahrenen und lauschte gern ihren interessanten Erzählungen.
»Jugend und Alter passen nicht zusammen«, meinte Herta, »man versteht uns heute nicht mehr. Wir sind nicht so altmodisch, wie unsere Mütter es waren. Wir haben das Recht auf unsere Jugend, wir müssen kämpfen um unsere Freiheit, und ich schlage vor, einen Klub zu gründen, in dem wir uns Treue und Verschwiegenheit bis in den Tod geloben.«
Der Plan Hertas fand begeisterte Aufnahme. Auch Bärbel hatte so viel von Jungmädchenklubs gehört, daß sie sich freute, Mitglied einer solchen Vereinigung zu werden.
Der plötzlich gefaßte Plan wurde mehr und mehr besprochen, und schließlich stimmte die ganze Obertertia einstimmig zu, es müsse solch ein Klub gegründet werden.
Herta Brodowin riß die Führung an sich.
»Wir suchen uns ein Lokal oder ein Zimmer, kommen dort alle acht Tage zusammen, besprechen das Notwendige, haben unsere Statuten. Auf diese Weise können wir etwas erreichen.«
»Einen Namen muß dieser Klub aber haben.«
Читать дальше