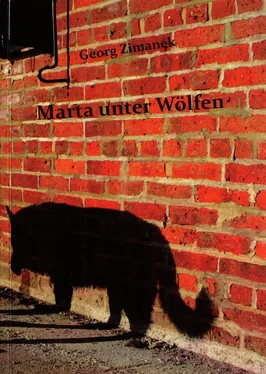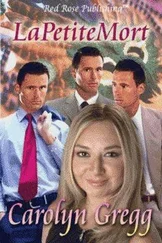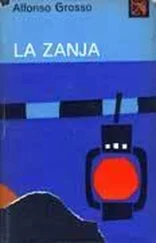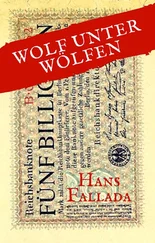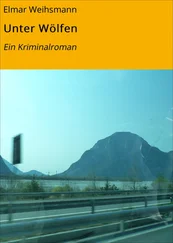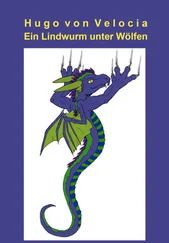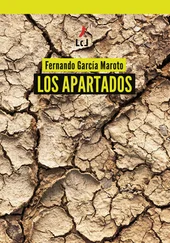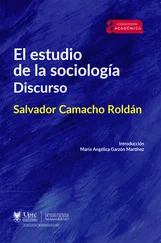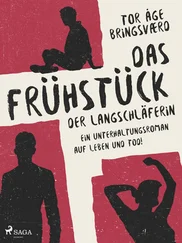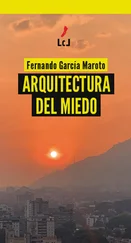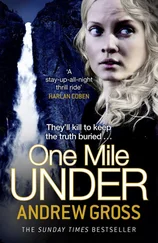Magarete löste sich, tief Luft holend von ihrem Mann und hängte sich bei ihm ein. Sie bekam nicht mit, dass er bis über beide Ohren rot anlief.
»Komm, lass uns reingehen.« Leise fügte sie hinzu: »Ach Fritzi, ich wünsche mir für uns auch so etwas kleines Rosiges. Weißt du, so so sehr, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Annemarie erzählte mir mal, sie hatte nur einmal mit Artur geschlafen, fast wie nebenbei, in der Wäschekammer von dem Lazarett, weißt du, wo er krank lag, und war gleich ein Treffer und wir beide üben schon so lange.«
Fritz sagte gar nichts dazu, er konnte ja auch nicht zugeben, dass es nicht an ihm lag, dass noch immer keine eigenen Kinder auf dem Großenhof lachten und spielten.
Denn just in diesem Moment wurde Fritz Heinrich zum ersten Mal Vater einer kleinen zuckersüßen Tochter namens Marta.
Fritz Heinrich war zwar Preuße, aber stammte bei weitem nicht aus Masuren.
Bis zu seinem vierundzwanzigsten Lebensjahr wohnte er nämlich in Berlin Treptow, in der Graetzstraße 11, in dem Wohn- und Geschäftshaus seines Vaters Otto Heinrich.
Otto besaß dort einen Zigarrenhandel und Kolonialwarenverkauf mit insgesamt drei Angestellten.
1901 überschrieb er seinem ältesten Sohn Heinz den gesamten Besitz in Berlin, hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen, da er schwer unter Lungenasthma litt. Er zahlte dem mittleren Sohn Artur und jüngstem Sohn Fritz das Erbe aus, notarisch festgelegt. Beide erhielten eine Entschädigung von je sechzigtausend Reichsmark und lebenslanges Wohnrecht in ihren ehemaligen Kinderzimmern des Elternhauses.
Gegen erheblichen Widerstand von Ruth Heinrich erwarb der Kaufmann Otto Heinrich im Sommer 1901 gemeinsam mit seinem Sohn Fritz vierhundertfünfzig Kilometer entfernt von Berlin auf der Neuansiedlung Alt Usczany in Ostpreußen, Kreis Johannisburg, eine 60 Hektar große Aufsiedlung für gerade mal fünfzehntausend Reichsmark, bestehend aus 18 Hektar Fichtenwald, 1,4 Hektar Hoffläche, 20,6 Hektar Wiese und 19 Hektar Ackerland. Außerdem wurde das Fischereirecht grundbuchmäßig eingetragen und ging automatisch auf die Erben über. Allerdings durfte es nicht als Handelsobjekt genutzt werden.
Beide, Vater und Sohn, ließen dort ein zweistöckiges massives Wohnhaus mit Pfannendach sowie Kuh- und Pferdestall im Karree mit noch größeren Abmaßen bauen. Es blieb das einzige Steinhaus außer der Zweiklassenschule und dem kleinen Spritzenhaus im Ort. Alle anderen Wohngebäude, die entlang der genau einen Kilometer langen Dorfstraße standen, waren aus Holz mit rotem Pfannendach oder Schilf gedeckt.
1905 lernte der bereits achtundzwanzig Jahre alte Fritz auf dem Erntedankfest in Usczany, seit ein paar Monaten amtlich auf Grünheide umbenannt, die hübsche zwei Jahre jüngere Magarete Krosta aus Schast Ausbau kennen. Der dort einzeln stehende Hof wurde von allen nur »Schlösschen« genannt.
Noch vor Weihnachten heirateten beide kurzerhand. Sie feierten ausgelassen drei Tage lang mit den Berlinern und den Einwohnern von ganz Grünheide.
Fritz blieb, auch wenn er eine Einheimische heiratete, immer noch der »reiche Neue« im Ort. Allerdings ging es mit dem Hof deutlich aufwärts, denn mit Magarete kam auch bäuerliche Schläue auf das Anwesen.
Fritz, wie auch sein Vater Otto, hatten von Landwirtschaft so gut wie keine Ahnung. Herbert Krosta aber, der Vater von Magarete, brachte mit seinem Wissen den Hof richtig auf Trab. Angebaut wurden Roggen mit guten Erträgen, Sommerweizen für den eigenen Bedarf, Gerste und Hafer als Pferde- und Viehfutter und auch Rüben und Steckrüben. Am wichtigsten aber blieben die Heuernte und der Kartoffelanbau. Nicht nur als Viehfutter und Saatgut wurden die herrlich schmeckenden Speisekartoffeln bei den Heinrichs geschätzt, nein, ein großer Teil wurde auch in Johannisburg verkauft. Die Knollen setzten dann ihre Reise mit der Bahn fort bis ins Reich: Berlin – Leipzig – Ruhrgebiet. Das meiste Heu jedoch ging per Bahn nach Arys zum größten Armeestandort im Deutschen Reich.
In den Heinrichställen gab es Schweine, Kühe, Bullen, Hühner, Gänse und Enten in großer Zahl. Neuerdings begann man auch noch sehr erfolgreich mit der Pferdezucht, alles unter den kundigen Augen von Herbert Krosta.
Sie galten bald als die reichsten Großbauern in der ganzen Gegend, weniger aus Neid denn aus Anerkennung, die sich die Familie mit Fleiß und Fürsorge, auch gegenüber den Nachbarn, hart erarbeitet hatte.
Ruth Heinrich blieb nur in den Sommermonaten auf dem »Heinrich der Großenhof«, wie er von Wiartel bis Turoscheln anerkennend in aller Munde genannt wurde. Im Winter wohnte sie in Berlin bei ihren Kindern und half im Kolonialwarenladen an der Kasse aus. Dort fühlte Ruth sich wirklich zu Hause und nicht da drüben in der »Wildnis«, wo Die sich noch mit der Zeitung die Scheiße vom Hintern wischten.
1913 wurde Otto Heinrich trotz seiner achtzig Jahre zum Dorfschulzen in Grünheide gewählt. Sein Asthma war so gut wie weggeblasen. Er organisierte siebzig Kilometer Drainageleitung an den Wiesen und baute gegenüber seinem Wohnhaus ein Insthaus zur Unterbringung für Lohnarbeiter in der Erntezeit.
Am Sonnabend, dem 1. August 1915, flüchteten Otto, Ruth und Magarete mit wenig Hab und Gut vom Großenhof nach Berlin, denn die russische Kriegswalze brach plündernd und mordend in die masurischen Grenzdörfer ein. Frederike und Herbert Krosta gingen zurück nach Schlösschen. Ottos Sohn Fritz wurde schon zu Kriegsbeginn 1914 für Kaiserreich und Vaterland eingezogen. Otto kam nie wieder nach Grünheide, er verstarb bei einem Verkehrsunfall, fast vor seiner eigenen Haustür in Berlin.
Vom 26. bis 30. August 1915 besiegte Fritz, als Lanzer der 8. Armee unter dem Oberbefehlshaber General Hindenburg, die vielfach überlegene Narew-Armee, die nach Ostpreußen eingedrungen war, fast vollständig. Der Kriegsschauplatz ging in die Geschichte als Schlacht bei Tannenberg ein.
Fritz überstand die Kämpfe unverletzt und ließ sich auf Antrag UK, unabkömmlich, stellen, um sich um seinen liebgewonnenen Bauernhof in Grünheide kümmern zu können. Er und seine Frau bauten mit Hilfe von Zuschüssen vom Staat und zinsgünstigen Krediten den von den Russen abgetragenen und dann verwüsteten Hof im Dorf größer und schöner als je zuvor wieder auf.
Zur gleichen Zeit gelangte Artur Heinrich, im Weltkrieg durch einen Bauchschuss verletzt, den er sich bei Feindberührung in den Ardennen einfing, in einem Lazarettzug nach Stettin. Er wurde in das Theresienstift eingeliefert, wo Ärzte und Schwestern lange Zeit um sein Leben kämpften. Dabei gewann er die Hilfsschwester Annemarie besonders lieb, die ihn pflegte und so manche Nacht an seinem Bett wachte.
Er heiratete Schwester Annemarie Lippa im Juni 1918, noch vor Kriegsende.
Bei der Trauung, die im Theresienstift stattfand, kam sein Bruder Fritz mit seiner Ehefrau Magarete zu einem längeren Besuch. Beide durften Trauzeugen sein. Mit großer Freude erfuhren sie, dass Annemarie Heinrich geb. Lippa in der Stadt Johannisburg, ganz in der Nähe von ihrem Hof in Grünheide, wohnte.
Artur blieb ein Pflegefall. Die Heilung seiner Wunden machte große Probleme und er wurde auf Wunsch seiner Frau endlich ins Lazarett nach Allenstein verlegt.
Trotzdem fuhr Annemarie nur noch unregelmäßig auf Besuch zu ihrem Mann. Ihr Vater kam aus dem verlorenen Krieg nicht zurück und sie musste ihrer betagten Mutter in der Pension helfen. Annemarie hatte schlichtweg keine Zeit für ihren kranken Mann.
In den Krisenzeiten Anfang der 20er Jahre besuchten nur noch wenige Gäste den »Goldenen Anker«. Das verdiente Geld reichte nicht zum Leben und nicht zum Sterben. Hauptsächlich Übernachtungsgäste blieben aus, einzig gesoffen wurde noch reichlich. Zum Glück brachte ihr Fritz Heinrich einmal in der Woche frische Milch, Eier, Salzfleisch und Brot. Alles von zuhause vom eigenen Hof, um seiner Schwägerin das Leben in Johannisburg etwas zu erleichtern.
Читать дальше