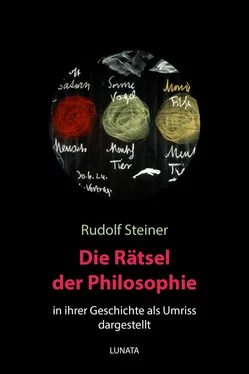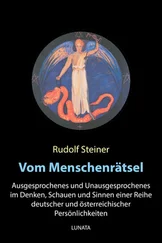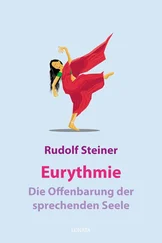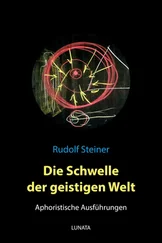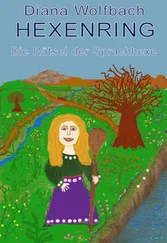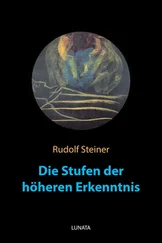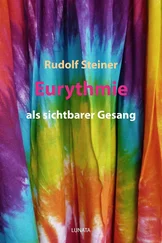Verliert sich Locke im Sinnesdunkel, so David Hume (1711-1776) im Innern der selbstbewussten Seele, deren Erlebnisse ihm nicht von Kräften einer Weltordnung, sondern von der Macht der menschlichen Gewöhnung beherrscht scheinen. Warum spricht man davon, dass ein Vorgang in der Natur Ursache, ein anderer Wirkung sei? so fragt Hume. Der Mensch sieht, wie die Sonne den Stein bescheint; er nimmt dann wahr, dass der Stein warm geworden ist. Er sieht diese beiden Vorgänge oft aufeinander folgen.
Deswegen gewöhnt er sich, sie als zusammengehörig zu denken. Er macht den Sonnenschein zur Ursache, die Erwärmung des Steines zur Wirkung. Die Denkgewöhnung verknüpft die Wahrnehmungen, nicht aber gibt es außerhalb in einer wirklichen Welt etwas, was sich als ein solcher Zusammenhang selbst offenbart.
Der Mensch sieht auf einen Gedanken seiner Seele eine Bewegung seines Leibes folgen; er gewöhnt sich, zu denken, der Gedanke sei die Ursache, die Bewegung die Wirkung. Denkgewohnheiten, nichts weiter meint Hume liegen den Aussagen des Menschen über die Weltvorgänge zugrunde. Durch Denkgewohnheiten kann die selbstbewusste Seele zu Richtlinien für das Leben kommen; sie kann aber in diesen ihren Gewohnheiten nichts finden zum Gestalten eines Weltbildes, das für die Wesenheit außer der Seele eine Bedeutung hätte. So bleibt für Humes Weltanschauung alles, was der Mensch sich an Vorstellungen bildet über die Sinnes- und Verstandesbeobachtung hinaus, ein bloßer Glaubensinhalt; es kann nie ein Wissen werden. Über das Schicksal der selbstbewussten Menschenseele, über ihr Verhältnis zu einer anderen als der Sinneswelt kann es nicht Wissenschaft, sondern nur Glauben geben.
Leibniz‹ Weltanschauungsbild erfuhr eine in die Breite gehende, verstandesmäßige Ausbildung durch Christian Wolff (geb. 1679 in Breslau, Professor in Halle). Wolff ist der Meinung, es lasse sich eine Wissenschaft begründen, welche durch reines Denken dasjenige erkennt, was möglich ist, was zur Existenz berufen ist, weil es dem Denken widerspruchsfrei erscheint, und so bewiesen werden kann. Auf diesem Wege begründet Wolff eine Welt-, Seelen- Gotteswissenschaft. Es beruht diese Weltanschauung auf der Voraussetzung, dass die selbstbewusste Menschenseele in sich Gedanken bilden könne, die gültig sind für dasjenige, was ganz und gar außerhalb ihrer selbst liegt. Hier liegt das Rätsel, das sich dann Kant aufgegeben fühlte: Wie sind durch die Seele zustandegebrachte Erkenntnisse möglich, die doch Geltung haben sollen für Weltwesen, die außerhalb der Seele liegen? In der Weltanschauungsentwicklung seit dem fünfzehnten, dem sechzehnten Jahrhundert drückt sich das Bestreben aus, die selbstbewusste Seele auf sich so zu stellen, dass sie sich als berechtigt anerkennen könne, über die Rätsel der Welt gültige Vorstellungen zu bilden. Aus dem Bewusstsein der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts heraus empfindet Lessing (1729-1781) dieses Bestreben als den tiefsten Impuls der menschlichen Sehnsucht. Wenn man ihn hört, so hört man mit ihm viele Persönlichkeiten, welche in diesem Sehnen den Grundcharakter dieses Zeitalters offenbaren. Die Verwandlung der religiösen Offenbarungswahrheiten in Vernunftwahrheiten, das strebt Lessing an. Sein Ziel ist in den mannigfaltigen Wendungen und Ausblicken, welche sein Denken nehmen muss, doch deutlich erkennbar. Lessing fühlt sich mit seinem selbstbewussten Ich in einer Entwicklungsepoche der Menschheit, welche durch die Kraft des Selbstbewusstseins erlangen soll, was ihr vorher von außen durch Offenbarung zugeflossen ist. Was in der Geschichte vorangegangen ist, wird damit für Lessing zum Vorbereitungsprozess für den Zeitpunkt, in dem sich das Selbstbewusstsein des Menschen allein auf sich stellt. So wird ihm die Geschichte zu einer »Erziehung des Menschengeschlechtes«. Und dies ist auch der Titel seines auf seiner Höhe geschriebenen Aufsatzes, in dem er das Wesen der Menschenseele nicht auf ein Erdenleben beschränkt wissen will, sondern es wiederholte Erdenleben durchmachen lässt. Die Seele lebt durch Zwischenzeiten getrennte Leben in den Perioden der Menschheitsentwicklung, nimmt in jeder Periode auf, was diese ihr geben kann, und verkörpert sich wieder in einer folgenden Periode, um da sich weiterzuentwickeln. Sie trägt also selbst aus einem Menschheitszeitalter die Früchte desselben in die folgenden hinüber und wird so durch die Geschichte »erzogen«. In Lessings Anschauung wird das Ich also über das Einzelleben hinaus erweitert; es wird eingewurzelt in eine geistig wirksame Welt, die hinter der Sinneswelt liegt.
Damit steht Lessing auf dem Boden einer Weltanschauung, welche dem selbstbewussten Ich es durch dessen eigene Natur fühlbar machen will, wie das, was in ihm wirkt, nicht in dem sinnlichen Einzelleben sich restlos zum Ausdruck bringt.
In anderer Art, doch mit demselben Impuls suchte Herder (1744-1803) zu einem Weltbild zu kommen. Er wendet den Blick auf das gesamte physische und geistige Universum. Er sucht gewissermaßen den Plan dieses Universums. Den Zusammengang und Zusammenklang der Naturerscheinungen, das Aufdämmern und Aufleuchten der Sprache und der Poesie, den Fortgang des geschichtlichen Werdens: alles das lässt Herder auf seine Seele wirken, durchdringt es mit oft genialischen Gedanken, um zu einem Ziele zu kommen. In aller Außenwelt so kann man sagen, stellt sich für Herder dieses Ziel dar drängt sich etwas zum Dasein, was zuletzt in der selbstbewussten Seele offenbar erscheint.
Diese selbstbewusste Seele enthüllt sich, indem sie sich im Universum gegründet fühlt, nur den Weg, den ihre eigenen Kräfte in ihr genommen haben, bevor sie Selbstbewusstsein erlangt hat. Die Seele darf sich nach Herders Anschauung in dem Weltall wurzelnd fühlen, denn sie erkennt in dem ganzen natürlichen und geistigen Zusammenhang des Universums einen Vorgang, der zu ihr führen musste, wie die Kindheit zum reifen Menschenleben im persönlichen Dasein führen muss. Es ist ein umfassendes Bild dieses seines Weltgedankens, das Herder in seinen »Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit« zur Darstellung bringt. Es ist der Versuch, das Naturbild im Einklang mit dem Geistesbilde so zu denken, dass in diesem Naturbilde auch ein Platz ist für die selbstbewusste Menschenseele. Man darf nicht außer acht lassen, dass in Herders Weltanschauung das Ringen sich zeigt, zugleich mit der neueren naturwissenschaftlichen Vorstellungsart und mit den Forderungen der selbstbewussten Seele sich auseinanderzusetzen. Herder stand vor den modernen Weltanschauungsforderungen wie Aristoteles vor den griechischen. Wie sich die beiden in verschiedener Art zu dem ihnen von ihrem Zeitalter gegebenen Bilde der Natur verhalten mussten, das gibt ihren Anschauungen die charakteristische Färbung.
Wie Herder im Gegensatz zu anderen seiner Zeitgenossen sich zu Spinoza stellt, wirft Licht auf seine Stellung in der Weltanschauungsentwicklung Diese Stellung tritt in ihrer Bedeutung hervor, wenn man sie vergleicht mit derjenigen Friedrich Heinrich Jacobis (1743-1819). Jacobi findet in Spinozas Weltbild dasjenige, wozu der menschliche Verstand kommen muss, wenn er die Wege verfolgt, welche ihm durch seine Kräfte vorgezeichnet sind. Es erschöpft dieses Weltbild den Umfang dessen, was der Mensch über die Welt wissen kann. Über die Natur der Seele, über den göttlichen Weltgrund, über den Zusammenhang der Seele mit diesem kann aber dieses Wissen nichts entscheiden. Diese Gebiete erschließen sich dem Menschen nur, wenn er sich einer Glaubenserkenntnis hingibt, die auf einer besonderen Seelenfähigkeit beruht. Das Wissen muss daher, im Sinne Jacobis, notwendig atheistisch sein.
Es kann in seinem Gedankenbau streng notwendige Gesetzmäßigkeit, nicht aber göttliche Weltordnung haben. So wird für Jacobi der Spinozismus die einzig mögliche wissenschaftliche Vorstellungsart; aber er sieht in diesem zugleich einen Beweis für die Tatsache, dass diese Vorstellungsart den Zusammenhang mit der geistigen Welt nicht finden kann. Herder verteidigt 1787 Spinoza gegen den Vorwurf des Atheismus. Er kann das. Denn er schreckt nicht davor zurück, das Erleben des Menschen in dem göttlichen Urwesen auf seine Art ähnlich zu empfinden wie Spinoza. Nur spricht Herder dieses Erleben auf andere Art aus als Spinoza. Dieser baut ein reines Gedankengebäude auf; Herder sucht seine Weltanschauung nicht bloß durch Denken, sondern durch die ganze Fülle des menschlichen Seelenlebens zu gewinnen. Für ihn ist ein schroffer Gegensatz von Glauben und Wissen dann nicht vorhanden wenn die Seele sich klar wird über die Art, wie sie sich selbst erlebt. Man spricht in seinem Sinne, wenn man das seelische Erleben so ausdrückt: Wenn der Glaube sich auf seine Gründe in der Seele besinnt, so kommt er zu Vorstellungen, welche nicht ungewisser sind als diejenigen, welche durch das bloße Denken gewonnen werden. Herder nimmt alles, was die Seele in sich finden kann, in geläuterter Gestalt als Kräfte hin, die ein Weltbild liefern können. So ist seine Vorstellung des göttlichen Weltengrundes reicher, gesättigter als diejenige Spinozas; aber sie setzt das menschliche Ich zu diesem Weltgrunde in ein Verhältnis, das bei Spinoza nur als Ergebnis des Denkens auftritt.
Читать дальше