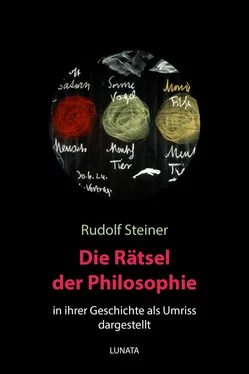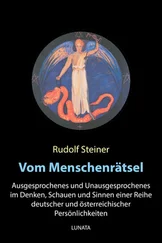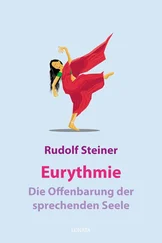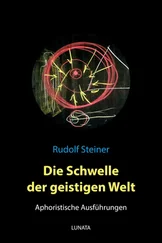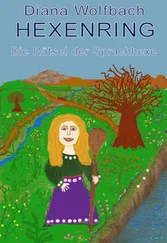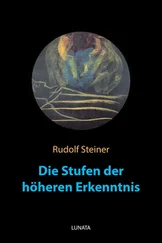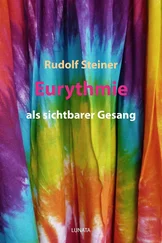Im Gegensatz zu Bacon von Verulam, der auf die Bausteine verwies, treten Descartes (Cartesius) und Spinoza an den Bauplan heran. Descartes ist geboren 1596 und 1650 gestorben. Bei ihm ist der Ausgangspunkt seines Weltanschauungsstrebens bedeutsam. Er stellt sich unbefangen fragend der Welt gegenüber, die ihm über ihre Rätsel mancherlei darbietet, teils durch die religiöse Offenbarung, teils durch die Beobachtung der Sinne. Er betrachtet nun weder das eine noch das andere nur so, dass er es einfach hinnimmt und als Wahrheit anerkennt, was es ihm bringt; nein, er setzt ihm das »Ich« entgegen, das aller Offenbarung und aller Wahrnehmung seinen Zweifel aus dem eigenen Entschluss entgegensetzt. Es ist dies eine Tatsache des neueren Weltanschauungsstrebens von vielsagender Bedeutung. Die Seele des Denkers inmitten der Welt lässt nichts auf sich Eindruck machen, sondern setzt allem sich mit dem Zweifel entgegen, der nur in ihr selber Bestand haben kann. Und nun erfasst sich diese Seele in ihrem eigenen Tun: Ich zweifle, das heißt, ich denke. Also, mag es sich mit der ganzen Welt wie immer verhalten, an meinem zweifelnden Denken wird mir klar, dass ich bin. So kommt Cartesius zu seinem Cogito ergo sum: Ich denke, also bin ich. Das Ich erkämpft sich bei ihm die Berechtigung, das eigene Sein anerkennen zu dürfen durch den radikalen Zweifel an der ganzen Welt. Aus dieser Wurzel heraus holt Descartes das Weitere seiner Weltanschauung. Im »Ich« hat er das Dasein zu erfassen gesucht. Was mit diesem »Ich« zusammen sein Dasein rechtfertigen kann, das darf als Wahrheit gelten. Das Ich findet ihm angeboren die Idee Gottes. Diese Idee stellt sich in dem Ich so wahr, so deutlich dar, als das Ich sich selber darstellt. Doch ist sie so erhaben, so gewaltig, dass sie das Ich nicht durch sich selbst haben kann, also kommt sie von einer äußeren Wirklichkeit, der sie entspricht. An die Wirklichkeit der Außenwelt glaubt Descartes nicht deshalb, weil sich diese Außenwelt als wirklich darstellt, sondern weil das Ich an sich und dann weiter an Gott glauben muss, Gott aber nur als wahrhaftig gedacht werden kann. Denn es wäre unwahrhaftig von ihm, dem Menschen eine wirkliche Außenwelt vorzustellen, wenn diese nicht wirklich wäre.
So, wie Descartes zur Anerkennung der Wirklichkeit des Ich kommt, ist nur möglich durch ein Denken, das sich im engsten Sinne auf dieses Ich richtet, um einen Stützpunkt des Erkennens zu finden.
Das heißt, diese Möglichkeit ist nur durch eine innere Tätigkeit, niemals aber durch eine Wahrnehmung von außen möglich. Alle Wahrnehmung, die von außen kommt, gibt nur Eigenschaften der Ausdehnung.
So kommt Descartes dazu, zwei Substanzen in der Welt anzuerkennen: die eine, welcher die Ausdehnung eigen ist, und die andere, welcher das Denken eigen ist und in der die Menschenseele wurzelt. Die Tiere, welche im Sinne des Descartes nicht in innerer, auf sich gestützter Tätigkeit sich erfassen können, sind demnach bloße Wesen der Ausdehnung, Automaten, Maschinen. Auch der menschliche Leib ist eine bloße Maschine. Die Seele ist mit dieser Maschine verbunden. Wird der Leib durch Abnutzung und dergleichen unbrauchbar, so verlässt ihn die Seele, um in ihrem Element weiter zu leben.
Descartes steht schon in einer Zeit, in welcher ein neuer Impuls im Weltanschauungsleben sich erkennen lässt. Die Epoche vom Beginn der christlichen Zeitrechnung bis ungefähr zu Scotus Erigena verläuft in der Art, dass das Gedankenerleben von einer Kraft durchpulst ist, welche wie ein mächtiger Anstoß in die Geistesentwicklung hereintritt. Der in Griechenland erwachte Gedanke wird von dieser Kraft überleuchtet. Im äußeren Fortgang des menschlichen Seelenlebens drückt sich das in den religiösen Bewegungen und dadurch aus, dass die jungen Volkskräfte West- und Mitteleuropas die Wirkungen des älteren Gedankenerlebens aufnehmen. Sie durchdringen dieses Erleben mit jüngeren elementareren Impulsen und bilden es dadurch um. Es zeigt sich darin einer der Fortschritte der Menschheit, welche dadurch bewirkt werden, dass ältere vergeistigte Strömungen der Geistesentwicklung, die ihre Lebenskraft, nicht aber ihre Geisteskraft erschöpft haben, fortgesetzt werden von jungen Kräften, die aus der Natur des Menschentums auftauchen. Man wird in solchen Vorgängen die wesentlichen Gesetze der Menschheitsentwicklung erkennen dürfen. Sie beruhen auf Verjüngungsprozessen des geistigen Lebens.
Die errungenen Geisteskräfte können sich nur weiter entfalten, wenn sie in junge natürliche Menschheitskräfte eingepflanzt werden. Die ersten acht Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung stellen ein Fortwirken des Gedankenerlebens in der Menschenseele so dar, dass wie in einem tief Verborgenen das Heraufkommen neuer Kräfte noch ruht, die bildend auf die Weltanschauungsentwicklung wirken wollen. In Descartes zeigen sich diese Kräfte bereits in einem hohen Grade wirksam. In dem Zeitalter zwischen Scotus Erigena und (ungefähr) dem fünfzehnten Jahrhundert dringt der Gedanke in seiner Eigenkraft wieder hervor, die er in der vorangehenden Epoche nicht offenbar entfaltet hat. Doch tritt er von einer ganz anderen Seite hervor als im griechischen Zeitalter. Bei den griechischen Denkern wird er als Wahrnehmung erlebt; vom achten bis zum fünfzehnten Jahrhundert kommt er aus den Tiefen der Seele herauf; der Mensch fühlt: In mir erzeugt sich der Gedanke. Bei den griechischen Denkern erzeugt sich noch unmittelbar ein Verhältnis des Gedankens zu den Naturvorgängen; in dem angedeuteten Zeitalter steht der Gedanke als Erzeugnis des Selbstbewusstseins da. Der Denker empfindet, dass er die Berechtigung des Gedankens erweisen müsse. So fühlen die Nominalisten, Realisten; so fühlt auch Thomas von Aquino, der das Gedankenerleben in der religiösen Offenbarung verankert.
Das fünfzehnte, sechzehnte Jahrhundert stellen einen neuen Impuls vor die Seelen hin. Langsam bereitet sich das vor, und langsam lebt es sich ein. In der menschlichen Seelenorganisation vollzieht sich eine Umwandlung. Auf dem Gebiete des Weltanschauungslebens bringt sich diese Umwandlung dadurch zum Ausdrucke, dass der Gedanke nun nicht als Wahrnehmung empfunden werden kann, sondern als Erzeugnis des Selbstbewusstseins. Es ist diese Umwandlung in der menschlichen Seelenorganisation auf allen Gebieten der Menschheitsentwicklung zu beobachten. In der Renaissance der Kunst und Wissenschaft und des europäischen Lebens, sowie in den reformatorischen Religionsbewegungen tritt sie zutage. Man wird sie finden können, wenn man die Kunst Dantes und Shakespeares nach ihren Untergründen in der menschlichen Seelenentwicklung erforscht. Hier kann dies alles nur angedeutet werden; denn diese Ausführungen wollen innerhalb des Fortganges der gedanklichen Weltanschauungsentwicklung bleiben.
Wie ein anderes Symptom dieser Umwandlung der menschlichen Seelenorganisation erscheint das Heraufkommen der neueren naturwissenschaftlichen Vorstellungsart. Man vergleiche doch den Zustand des Denkens über die Natur, wie er durch Kopernikus, Galilei, Kepler entsteht, mit dem, was vorangegangen ist. Dieser naturwissenschaftlichen Vorstellung entspricht die Stimmung der Menschenseele im Beginne des neueren Zeitalters im sechzehnten Jahrhundert. Die Natur wird von jetzt an so angesehen, dass die Sinnesbeobachtung über sie zum alleinigen Zeugen gemacht wird. Bacon ist die eine, Galilei die andere Persönlichkeit, in denen dies deutlich zutage tritt. Das Naturbild soll nicht mehr so gemalt werden, dass in demselben der Gedanke als von der Natur geoffenbarte Macht empfunden wird. Aus dem Naturbilde verschwindet allmählich immer mehr, was nur als ein Erzeugnis des Selbstbewusstseins empfunden wird. So stehen sich die Schöpfungen des Selbstbewusstseins und die Naturbeobachtung immer schroffer, immer mehr durch einen Abgrund getrennt gegenüber. Mit Descartes kündigt sich die Umwandlung der Seelenorganisation an, welche das Naturbild und die Schöpfungen des Selbstbewusstseins auseinanderzieht. Vom sechzehnten Jahrhundert ab beginnt ein neuer Charakter im Weltanschauungsleben sich geltend zu machen. Nachdem in den vorangegangenen Jahrhunderten der Gedanke so auftrat, dass er als Erzeugnis des Selbstbewusstseins seine Rechtfertigung aus dem Weltbild verlangte, erweist er sich seit dem sechzehnten Jahrhundert klar und deutlich im Selbstbewusstsein auf sich allein gestellt. Er hatte vorher noch in dem Naturbilde selbst eine Stütze für seine Rechtfertigung erblicken können; nunmehr tritt an ihn die Aufgabe heran, aus seiner eigenen Kraft heraus sich Gültigkeit zu schaffen. Die Denker der nun folgenden Zeit empfinden, wie in dem Gedankenerleben selbst etwas gesucht werden müsse, das dieses Erleben als berechtigten Schöpfer eines Weltanschauungsbildes erweist.
Читать дальше