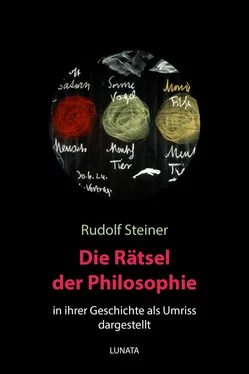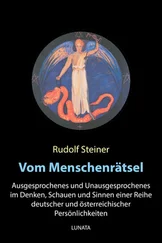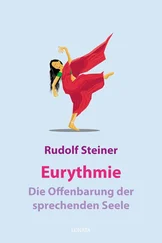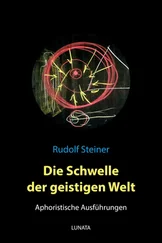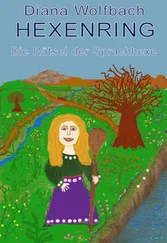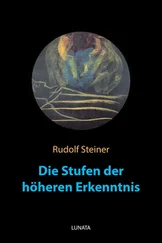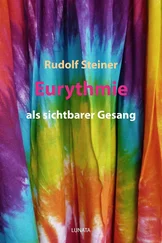Rudolf Steiner - Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt
Здесь есть возможность читать онлайн «Rudolf Steiner - Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik, gibt einen Überblick über die Entstehung des abendländischen Denkens. Ausgehend vom mythischen Bewusstsein der vorsokratischen Antike über die Epoche des Christentums bis hin zum Aufbruch in der Neuzeit und einer Hinwendung zur Natur, den markanten Umbrüchen Ende des 18. Jahrhunderts und den weltanschaulichen Diskrepanzen im 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert findet eine Rückbesinnung zum Geistigen statt und somit eine Rückkehr zum Ursprung.
Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Man kann an einzelnen bedeutsamen Erscheinungen diese Entwicklung betrachten. Man sieht dann auf europäischem Boden platonische und ältere Vorstellungsarten damit ringen, zu begreifen, was die Religionen verkünden, oder auch es bekämpfen. Bedeutende Denker suchen, was die Religion offenbart, auch gerechtfertigt vor den alten Weltanschauungen darzustellen. So kommt zustande, was die Geschichte als Gnosis bezeichnet, in einer mehr christlichen oder mehr heidnischen Färbung.
Persönlichkeiten, welche für die Gnosis in Betracht kommen, sind Valentinus, Basilides, Marcion. Ihre Gedankenschöpfung ist eine umfassende Weltentwicklungsvorstellung. Das Erkennen, die Gnosis, mündet, wenn es sich aus dem Gedanklichen ins Übergedankliche erhebt, in die Vorstellung einer höchsten weltschöpferischen Wesenheit. Weit erhaben über alles, was als Welt von dem Menschen wahrgenommen wird, ist diese Wesenheit. Und weit erhaben sind auch noch die Wesenheiten, welche sie aus sich hervorgehen lässt, die Äonen. Doch bilden diese eine absteigende Entwicklungsreihe, so dass ein Äon als ein unvollkommenerer immer aus einem vollkommeneren hervorgeht. Als ein solcher Äon auf einer späteren Entwicklungsstufe ist der Schöpfer der dem Menschen wahrnehmbaren Welt anzusehen, der auch der Mensch selbst zugehört. Mit dieser Welt kann sich nun ein Äon des höchsten Vollkommenheitsgrades verbinden. Ein Äon, der in einer rein geistigen, vollkommenen Welt verblieben und da sich im besten Sinne weiterentwickelt hat, während andere Äonen Unvollkommenes und zuletzt die sinnliche Welt mit dem Menschen hervorgebracht haben. So ist für die Gnosis die Verbindung zweier Welten denkbar, welche verschiedene Entwicklungswege durchgemacht haben, und von denen dann in einem Zeitpunkte die unvollkommene von der vollkommenen zu neuer Entwicklung nach dem Vollkommenen zu angeregt wird. Die dem Christentum zugeneigten Gnostiker sahen in dem Christus Jesus jenen vollkommenen Äon, der mit der Erdenwelt sich verbunden hat.
Mehr auf dogmatisch-christlichem Boden standen Persönlichkeiten wie Clemens von Alexandrien (gest. etwa 211 n. Chr.) und Origenes (geb. etwa 183 n. Chr.). Clemens nimmt die griechischen Weltanschauungen wie eine Vorbereitung der christlichen Offenbarung und benützt sie als ein Instrument, um die christlichen Impulse auszudrücken und zu verteidigen. In ähnlicher Art verfährt Origenes.
Wie zusammenfließend in einem umfassenden Vorstellungsstrom findet sich das von den religiösen Impulsen inspirierte Gedankenleben in den Schriften des Areopagiten Dionysius. Diese Schriften werden vom Jahr 533 n. Chr. an erwähnt, sind wohl nicht viel früher verfasst, gehen aber in ihren Grundzügen, nicht in den Einzelheiten, auf früheres Denken dieses Zeitalters zurück. Man kann den Inhalt in der folgenden Art skizzieren: Wenn die Seele sich allem entringt, was sie als Seiendes wahrnehmen und denken kann, wenn sie auch hinausgeht über alles, was sie als Nichtseiendes zu denken vermag, so kann sie das Gebiet der überseienden, verborgenen Gotteswesenheit geistig erahnen. In dieser ist das Urseiende mit der Urgüte und der Urschönheit vereinigt. Von dieser ursprünglichen Dreiheit ausgehend, schaut die Seele absteigend eine Rangordnung von Wesen, die in hierarchischer Ordnung bis zum Menschen gehen.
Scotus Erigena übernimmt im neunten Jahrhunderte diese Weltanschauung und baut sie in seiner Art aus. Für ihn stellt sich die Welt als eine Entwicklung in vier »Naturformen« dar. Die erste ist die »schaffende und nicht geschaffene Natur«. In ihr ist der rein geistige Urgrund der Welt enthalten, aus dem sich die »schaffende und geschaffene Natur« entwickelt. Das ist eine Summe von rein geistigen Wesenheiten und Kräften, die durch ihre Tätigkeit erst die »geschaffene und nicht schaffende Natur« hervorbringen, zu welcher die Sinnenwelt und der Mensch gehören. Diese entwickeln sich so, dass sie aufgenommen werden in die »nicht geschaffene und nicht schaffende Natur«, innerhalb welcher die Tatsachen der Erlösung, die religiösen Gnadenmittel usw. wirken.
In den Weltanschauungen der Gnostiker, des Dionysius, des Scotus Erigena fühlt die Menschenseele ihre Wurzel in einem Weltengrund, auf den sie sich nicht durch die Kraft des Gedankens stellt, sondern von dem sie die Gedankenwelt als Gabe empfangen will. In der Eigenkraft des Gedankens fühlt sich die Seele nicht sicher; doch strebt sie danach, ihr Verhältnis zu dem Weltgrunde im Gedanken zu erleben. Sie lässt in sich den Gedanken, der bei den griechischen Denkern von seiner eigenen Kraft lebte, von einer anderen Kraft beleben, die sie aus den religiösen Impulsen holt. Es führt der Gedanke in diesem Zeitalter gewissermaßen ein Dasein, in dem seine eigene Kraft schlummert. So darf man sich auch das Bildervorstellen denken in den Jahrhunderten, die der Geburt des Gedankens vorangegangen sind. Das Bildvorstellen hatte wohl eine uralte Blüte, ähnlich wie das Gedankenerleben in Griechenland; dann sog es seine Kraft aus anderen Impulsen, und erst als es durch diesen Zwischenzustand hindurchgegangen war, verwandelte es sich in das Gedankenerleben. Es ist ein Zwischenzustand des Gedankenwachstums, der sich in den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung darstellt.
In Asien, wo des Aristoteles Anschauungen Verbreitung fanden, entsteht das Bestreben, die semitischen Religionsimpulse in den Ideen des griechischen Denkers zum Ausdrucke zu bringen. Das verpflanzt sich dann auf europäischen Boden und tritt ein in das europäische Geistesleben durch Denker wie Averroes, den großen Aristoteliker (1126-1198), Maimonides (1135-1204) und andere. Bei Averroes findet man die Ansicht, dass das Vorhandensein einer besonderen Gedankenwelt in der Persönlichkeit des Menschen ein Irrtum sei. Es gibt nur eine einige Gedankenwelt in dem göttlichen Urwesen. Wie sich ein Licht in vielen Spiegeln abbilden kann, so offenbart sich die eine Gedankenwelt in den vielen Menschen. Es findet zwar während des menschlichen Erdenlebens eine Fortbildung der Gedankenwelt statt; doch ist diese in Wahrheit nur ein Vorgang in dem geistigen einigenden Urgrunde. Stirbt der Mensch, so hört einfach die individuelle Offenbarung durch ihn auf. Sein Gedankenleben ist nur mehr in dem einen Gedankenleben vorhanden. Diese Weltanschauung lässt das griechische Gedankenerleben so fortwirken, dass sie dieses in dem einheitlichen göttlichen Weltengrund verankert. Sie macht den Eindruck, als ob in ihr zum Ausdruck käme, dass die sich entwickelnde Menschenseele in sich nicht die ureigene Kraft des Gedankens fühlte; deshalb verlegt sie diese Kraft in eine außermenschliche Weltenmacht.
Die Weltanschauungen im Mittelalter
Wie eine Vorverkündigung zeigt sich ein neues Element, welches das Gedankenleben selbst aus sich hervorbringt bei Augustinus (354-430), um dann wieder unbemerkbar weiter zu strömen in dem es überdeckenden religiösen Vorstellen, und erst im späteren Mittelalter deutlicher hervorzutreten. Bei Augustinus ist das Neue wie eine Rückerinnerung an das griechische Gedankenleben. Er blickt um sich und in sich und sagt sich: Mag alles nur Ungewisses und Täuschung geben, was sonst die Welt offenbart, an einem ist nicht zu zweifeln: an der Gewissheit des seelischen Erlebens selbst. Das wird mir durch keine Wahrnehmung zuteil, die mich täuschen kann; in diesem bin ich selbst darinnen; es ist, denn ich bin dabei, indem ihm sein Sein zugeschrieben wird.
Man kann in diesen Vorstellungen etwas Neues gegenüber dem griechischen Gedankenleben erblicken, trotzdem sie zunächst einer Rückerinnerung an dasselbe gleichen. Das griechische Denken deutet auf die Seele; bei Augustinus wird auf den Mittelpunkt des Seelenlebens gewiesen. Die griechischen Denker betrachten die Seele in ihrem Verhältnis zur Welt; bei Augustinus stellt sich dem Seelenleben etwas in demselben gegenüber und betrachtet dieses Seelenleben als eine besondere, in sich geschlossene Welt. Man kann den Mittelpunkt des Seelenlebens das »Ich« des Menschen nennen. Den griechischen Denkern wird das Verhältnis der Seele zur Welt zum Rätsel; den neueren Denkern das Verhältnis des »Ich« zur Seele. Bei Augustinus kündigt sich das erst an; die folgenden Weltanschauungsbestrebungen haben noch zu viel zu tun, um Weltanschauung und Religion in Einklang zu bringen, als dass das Neue, das jetzt in das Geistesleben hereingetreten ist, ihnen schon deutlich zum Bewusstsein käme. Und doch lebt in der Folgezeit, den Seelen mehr oder weniger unbewusst, das Bestreben, die Welträtsel so zu betrachten, wie es das neue Element fordert. Bei Denkern wie Anselm von Canterbury (1033-1109) und Thomas von Aquino (1227-1274) tritt das noch so hervor, dass sie dem auf sich selbst gestützten menschlichen Denken zwar die Fähigkeit zuschreiben, die Weltvorgänge bis zu einem gewissen Grade zu erforschen, dass sie diese Fähigkeit aber begrenzen. Für sie gibt es eine höhere geistige Wirklichkeit, zu welcher das sich selbst überlassene Denken niemals kommen kann, sondern die ihm auf religiöse Art geoffenbart werden muss. Der Mensch wurzelt im Sinne des Thomas von Aquino mit seinem Seelenleben in der Weltwirklichkeit; doch kann dieses Seelenleben aus sich selbst heraus diese Wirklichkeit in ihrem vollen Umfange nicht erkennen. Der Mensch könnte nicht wissen, wie sein Wesen in dem Gange der Welt drinnen steht, wenn nicht das Geistwesen, zu dem sein Erkennen nicht dringt, sich zu ihm neigte und ihm auf dem Offenbarungswege mitteilte, was der nur auf ihre eigene Kraft bauenden Erkenntnis verborgen bleiben muss. Von dieser Voraussetzung aus baut Thomas von Aquino sein Weltbild auf. Es hat zwei Teile, den einen, der aus den Wahrheiten besteht, welche sich dem eigenen Gedankenerleben über den natürlichen Verlauf der Dinge erschließen; dieser Teil mündet in einen anderen, in welchem sich das befindet, was durch Bibel und religiöse Offenbarung an die Menschenseele herangekommen ist. Es muss also in die Seele etwas dringen, was ihrem Eigenleben nicht erreichbar ist, wenn sie in ihrem vollen Wesen sich erfühlen will. Thomas von Aquino macht sich ganz vertraut mit der Weltanschauung des Aristoteles. Dieser wird ihm wie sein Meister im Gedankenleben. Thomas ist damit die hervorragendste, aber doch nur eine der zahlreichen Persönlichkeiten des Mittelalters, welche ganz auf dem Gedankenbau des Aristoteles den eigenen aufführen. Aristoteles wird für Jahrhunderte »der Meister derer, die da wissen«, wie Dante die Verehrung für Aristoteles im Mittelalter ausdrückt. Thomas von Aquino hat das Bestreben, im aristotelischer Art zu begreifen, was menschlich begreifbar ist. So wird ihm Aristoteles‹ Weltanschauung zum Führer bis zu jener Grenze, bis zu der das menschliche Seelenleben mit seinen eigenen Kräften dringen kann; jenseits dieser Grenzen liegt, was im Sinne des Thomas die griechische Weltanschauung nicht erreichen konnte. Für Thomas von Aquino bedarf also das menschliche Denken eines anderen Lichtes, von dem es erleuchtet werden muss. Er findet dieses Licht in der Offenbarung. Wie immer sich die folgenden Denker nun auch zur Offenbarung stellten: in griechischer Art konnten sie nicht mehr das Gedankenleben hinnehmen. Es genügt ihnen nicht, dass das Denken die Welt begreift; sie setzen voraus, es müsse eine Möglichkeit geben, dem Denken selbst eine es stützende Unterlage zu geben. Das Bestreben entsteht, das Verhältnis des Menschen zu seinem Seelenleben zu ergründen. Der Mensch sieht sich also als ein Wesen an, das in seinem Seelenleben vorhanden ist. Wenn man dieses »Etwas« das »Ich« nennt, so kann man sagen: In der neueren Zeit wird innerhalb des Seelenlebens das Bewusstsein vom »Ich« rege, wie im griechischen Weltanschauungsleben der Gedanke geboren wurde. Welch verschiedene Formen auch die Weltanschauungsbestrebungen in diesem Zeitalter annehmen um die Erforschung der Ich-Wesenheit drehen sich doch alle. Nur tritt diese Tatsache nicht überall klar in das Bewusstsein der Denker. Diese glauben zumeist, ganz anderen Fragen hingegeben zu sein. Man könnte davon sprechen, dass das »Rätsel des Ich« in den mannigfaltigsten Maskierungen auftritt. Zuweilen lebt es in den Weltanschauungen der Denker auf so verborgene Art, dass die Behauptung, es handele sich bei der einen oder der anderen Ansicht um dieses Rätsel, wie eine willkürliche oder erzwungene Meinung sich darstellt. Im neunzehnten Jahrhundert kommt das Ringen mit dem »Ich-Rätsel« am intensivsten zum Ausdruck, und die Weltanschauungen der Gegenwart leben mitten in diesem Ringen darinnen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.