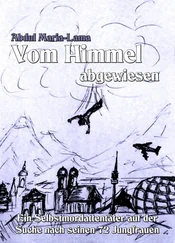Ich wollte anders sein, als ich mich fühlte. Cool und galant wie die „tollen“ Typen, die in den Clubs hübsche Mädchen antanzten und eine nach der anderen abschleppten, während ich zusah und innerlich ethische Debatten führte, mich über jede kratzige Haarspange echauffierte, die man im Tumult ins Gesicht bekam. Wie etwa sollte man einen Menschen gleichzeitig sexuell attraktiv finden und sich mit ihm intellektuell auf gleicher Höhe unterhalten können beziehungsweise ihn für sein Wesen schätzen? Welcher Seite ließ sich der Sexualtrieb überhaupt zuordnen? Eher dem Verstand oder den Emotionen – oder ist er gar eine dritte Kraft? Beeinflussten sich diese Kräfte, konnten sie sich sogar für länger dominieren? Die Hochfreude am platonisch Schönen hatte allem Anschein nach auch ihre hinderliche Seite. „Rangehn”, wie es Nina Hagen im gleichnamigen Lied besingt, sei die Parole, so impfte mir ein Freund ein, doch entsprach gerade dies so gar nicht meinem Naturell.
Wie groß war der Wunsch, auf einem Foto einmal inmitten der Party-versierten coolen Gleichaltrigen zu sein! Fan eines Fußballclubs zu sein! Oder mit freiem Oberkörper am Strand Volleyball zu spielen! Oder über banale Witze lachen zu können! Oder dem Verzehr von Bier Genuss abzugewinnen! „Warum bin ich nicht einfach so, wie ich es mir wünsche?“ Neben diesen Satz malte ich in meinem Tagebuch ein riesiges Fragezeichen über vier Zeilen. Um das für mein wahres Wesen so Fremde, gleichwohl für mein falsches Selbst so Wünschenswerte zu erreichen, versuchte ich, meinen Freundeskreis zu verjüngen. Schon mein Leben lang hatte ich mir gewünscht, was andere den „besten Freund” oder die „beste Freundin” nannten. Dieser vielbesungene Mensch, der immer bliebe und das Schönste sei, was es gibt, auch wenn die ganze Welt zusammenbricht, so die allseitige Prophezeiung.
Nicht ich selbst, sondern andere waren also der Maßstab dafür, wie ich leben wollte. Und wenn man sich in allem anders wünscht, dann ist das Gegenteil von dem, wie man ist, das Ideal des stilisierten Normalen (Abstriche erfolgten zum Glück dort, wo ich andere ebenso wenig für normal hielt, etwa bei Menschen, die mir erzählten, wo es die besten Frauen gebe, wie viele sie auf einmal gehabt hätten und eine Auflistung der Nationalitäten folgen ließen). Wie ein Chamäleon versuchte ich mich anzupassen und ließ mich von Menschen beraten, die mein Ideal repräsentierten, mochte dies bei der Einrichtung meiner Wohnung oder bei der Auswahl meiner Kleidung sein. Heute bin ich erschrocken über mich selbst, doch zum damaligen Zeitpunkt hatte das falsche Selbst mein wahres Ich so weit verleugnet, dass ich mich sogar in meinem Freundeskreis umschaute, wessen Leben ich kopieren könnte. Ich war Feuer und Flamme für Menschen, die „meinen“ Traum realisierten, und wie erbost war ich, wenn andere sich kritisch über diese Menschen äußerten.
Dieser Identitätsdiebstahl war ohne mein Wissen vonstattengegangen. Auch kam ich mir gar nicht angepasst vor – bis der Hahn zweimal krähte und mir zwei Menschen unabhängig voneinander den Spiegel vorhielten und am Fundament meines Kartenhauses rüttelten. Simple Aussagen wie „Du musst doch wissen, was Dir gefällt, Phillip!“ irritierten mich und machten mich bisweilen ärgerlich. Oder „Hör auf, an andere zu denken und Verantwortung für deren Gefühle zu übernehmen!“ Je unnachgiebiger der Appell, nach eigenen Antworten zu suchen, umso mehr wusste ich, dass sie recht hatten und ich das Leben anderer nicht weiter kopieren konnte. Ich musste es selbst wissen – doch wie? Stellte das Leben hier eine Frage an mich, oder war ich die Frage an das Leben? Vielleicht sollte die Herausforderung, hierauf eine Antwort zu finden, der Sinn meiner Existenz sein.
Der Grad der im Inneren empfundenen gelingenden Anpassung widersprach im Grunde diametral den nach außen sichtbaren Manifestationen Widerstand, Auseinandersetzung und Konfrontation. Was sich vielleicht nicht selten dahinter verbarg, war Angst. Angst vor Nähe und Bedacht auf Distanz als zentrale Merkmale narzisstischer und schizoider Menschen, denn sie dienen ihrem dünnhäutigen und chronisch misstrauischen Wesen als Selbstschutz und begründen sich letztlich in einer richtigen Einschätzung der eigenen Verwundbarkeit, sprich der Angst vor drohender Fragmentierung ihres Ichs, dem Gefühl auseinanderzufallen. „Eintracht im Innern, Friede nach außen“, heißt es in lateinischer Version auf dem Lübecker Holstentor, das früher auf den 50-DM-Scheinen abgebildet war. Wenn man stärker mit sich im Einklang ist, dann ist die Reaktion anderer zweitrangig. Oder umgekehrt: Je schlechter der Zugang zum emotionalen Zentrum, umso stärker die Kopflastigkeit und die Anpassung an kollektive Werte.
Der Versuch, neutral und ohne anzuecken durch die Welt zu gehen, verlangte von mir indes besondere Stärke oder war zum Scheitern verurteilt. Mit Pseudonymen und getrennten Rufnummern hatte ich in nur wenig Zeit ein Kontaktnetzwerk neben dem beruflichen aufgebaut. Doch in mir hörte ich Stimmen, die fragten, wie ich in meinem Alter ein so exzessives Nachtleben haben könne. Ob dies zu dem beruflichen Image passe? Konnte ich mit solchem Lebenswandel noch als Vorbild gelten und ein Team leiten? Akteur mehrerer Welten, versuchte ich mit horrendem Energieaufwand, diese parallel zu halten – ein unmögliches Unterfangen und Zeichen größter Lebensfremdheit. Wie naiv war es, zu glauben, in dieser kleinen Welt ließen sich menschliche Netzwerke perfekt trennen! Schnell bekam ich zu spüren, dass zu jedem meiner One-Night-Stands ein Mensch gehörte, ein fühlendes Wesen mit Emotionen, Verletzlichkeit und eventuell sogar der Hoffnung auf eine feste Beziehung, während ich schlicht nicht mehr an Einsamkeit leiden und Fürsorge erhalten wollte. Ab und an kam ich mir vor wie in einem Rollenspiel, und jede einzelne Rolle spielte ich mit Präzision und Empathie.
Doch wollte ich die andere Seite kennenlernen, musste ich lernen, mich emotionalen Schmerzen nicht weiter zu verschließen. Und so ließ ich im Spiel mit dem Feuer Zuneigung zu, kalkulierte allerdings, dass sie zeitlich begrenzt und somit meinem Sicherheitskonzept nicht hinderlich war. Nichtsdestotrotz war der Abschied schmerzhaft, drückte mich wie von mächtiger unsichtbarer Hand nieder und hinterließ neben einem Brief ein Lied, das ich wieder und wieder in meinem Leid hören wollte. Am selben Tag fand die jährliche Vertriebstagung statt. Erschöpft von einem Überangebot an Eindrücken, das ich prophylaktisch mit Baldriantabletten zu benebeln versucht hatte, sowie dem Karaoke bis tief in die Nacht und einer mehrfach medikamentös unterdrückten Erkältung, sollte mein Körper noch immer keine Erholung erhalten, obschon in kaum einer Ader noch Kraft floss.
Wie sehr freute ich mich auf meinen mehrmonatigen Besuch aus Deutschland, den ich erwartete. Besuch war für mich oft auch eine Weise, um zu verhindern, dass ich noch eingefahrener lebte. Denn Schrullen, wie ich sie bei Alleinstehenden zu oft beobachtete, wollte ich mir nicht zugestehen. Besuch hieß, ein Eindringen in den Elfenbeinturm bewusst zuzulassen. Doch in diesem Fall war es anders. Wie stark fühlte ich die Sympathie und die Energie nach, die seit dem ersten Moment der Begegnung vor einem Jahr floss! Obwohl meiner Erkältung mit Medikamenten nicht mehr beizukommen war, ging es nur eine Nacht später für einige Tage gemeinsam auf Reisen, und gegen Ende zu den Ausläufern des Himalaya auf über 3 300 Meter, wo wir auf einem sportlichen Rundgang in dünner Luft die lokalen Sehenswürdigkeiten erkundeten, sodass ich abends von paralysierenden Kopfschmerzen heimgesucht wurde, die mich im Sinne des Wortes bewegungsunfähig machten. Am nächsten Abend zurück in Shanghai, hörte ich meine innere Stimme immer kräftiger insistieren, ich solle nicht mehr ausgehen, doch irgendwo hatte ich noch letzte Kraftreserven. Von diesem Zeitpunkt an dauerte es nicht mehr lange, bis mein Gesicht dunkelgelbe Farbschattierungen bekam – und darüber hinaus meine engsten Freunde mir ihren abrupten Wegzug mitteilten, was mich emotional so sehr mitnahm, dass ich mich zum ersten Mal in meinem Leben krank meldete. Jahrelang war ich stolz gewesen, noch nie krank gewesen zu sein, ein Soldat am Arbeitsplatz. Dieser Nimbus ward Geschichte. In der Zwischenzeit hatte ich begonnen, Antibiotika einzunehmen – doch was war mit meinem Körper los? Tief in mir spürte ich, dass er mir die Folgsamkeit verweigerte, er nahm gleichsam die Kupplung raus, während ich weiterhin aufs Gaspedal trat: Als ich im Internet nach meinen Symptomen suchte und zahlreiche Krankheitsbilder durchforschte, sackte mein Kreislauf ab, zu stark war die Befürchtung einer Infektion aufgrund meines nachtaktiven Lebens (die allerdings – und das konnte ich mit Gewissheit sagen – unbegründet war). Doch mein Verstand trieb jede recherchierte Krankheit wie eine Sau durchs innere Dorf, ich reagierte immer aufgescheuchter, bis mir blümerant – bleu mourant – vor Augen wurde und ich mich schließlich, dem „ersterbenden Blau“ hingebend, kreidebleich und die Beine hoch, in einem gut besuchten Straßencafé auf den Boden legte.
Читать дальше