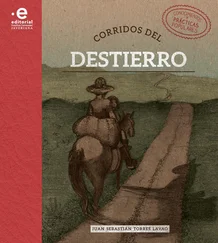Eine Stunde nach Jahresauftakt auf Samoa explodierte der Himmel über dem dreihundertachtundzwanzig Meter hohen Sky Tower in Auckland, jetzt, weiter westwärts, folgt Sydney mit einem Chor aus anderthalb Millionen Kehlen rund um den Hafen. Anderthalb Millionen, die die Sekunden bis Mitternacht einstimmig herunter zählen. Ich mittendrin, den Blick gen Himmel, ohne Gedanken, mit leerem Kopf, mit nichts als einer glitzernden Leinwand vor Augen. Der Funkenregen prasselt auf den Kleiderbügel hinab, auf den gewaltigen eleganten Rundbogen der Harbour Bridge, auf den Luna Park am Nordufer, auf die pittoresk sanierten Altstadthäuser der Rocks diesseits des Wassers, auf die engen Gassen abseits der Glastürme, auf die weißen erleuchteten Segel der Oper mit ihren mehr als einer Million Keramikkacheln, auf die flatternden Segel der schlanken mäandrierenden Yachten, auf die ausufernden Freudentänze der Ufersänger, die in Schatten beisammen kauern, schauern, aufgereiht wie die Vögel auf den Drahtseilen der Telegrafenmasten, dicht gedrängt und fest umklammert. Sieben Tonnen Feuerwerkskörper rasen in die Luft, eine Choreografie aus Blitz und Donner, und mehr als eine Milliarde Menschen sehen in aller Welt zu, mit dem kalt gestellten Sekt auf den Tischen vor den Fernsehbildschirmen. Millionen stehen hier beieinander beiderseits der Bucht, schauen ungläubig ins fragile Sekundenspektakel. Grelle, schnelle, hüpfende, tanzende, springende Fackeln, gigantische Glühwürmchen, die Palette aller Farben und Formen, Herzen am Himmel, Sterne und Fahnen, Kometen und Kronen, das ganze Universum. Und mit jedem Knall, mit jedem Lichtreflex harren die Menschenmassen für Sekundenbruchteile im Schein der Raketen. Der gesprengte Horizont, das zerrissene Dach über den Hochhäusern, das zuckende Echo der Leuchtfäden. Der Rhythmus des Donners, der Widerhall von den kühlen Wänden, das alte opulente Barock in der neuen Nüchternwelt, der Reigen der sterbenden Lichtkaskaden, die liebestollen rasenden Furien am südlichen Himmel, an dem jetzt mehr kein Platz mehr ist für das bleiche Kreuz des Südens. Eine letzte laute Salve, ein Krachen und Bersten, es folgt eine atemberaubende Stille, die Dunkelheit, die schwärzeste aller Finsternisse, ein Raunen, ein Rufen, eine Freude. Dann ist alles vorbei, und Schwefel wabert über das schwarze Hafenwasser. Macquaries Ausblick gehört jetzt mir allein.
Dieses Jahr wird ein gutes Jahr. Ich, Catherine, achtzehn Jahre alt und angehende Studentin der Wirtschaftswissenschaften, blond und blauäugig und zwischen Baum und Borke, ich werde ein Jahr lang um die Welt reisen und das kosten, was mir später vielleicht für immer verwehrt bleiben wird, weil man schwer von einem abgelegenen Kontinent loskommt, der einem Lohn und Brot und Bier und eine Schlafstätte bietet und der einmal eine ferne Strafkolonie war. Eine gewaltige Insel, groß genug für eine ganze Welt. Ich werde im Sommer fortgehen, im Sommer, der hier ein Winter ist, nach London. Von dort nach Paris, Madrid, Rom. Und nach Athen, ohne Jannis, nachsehen, ob die Griechen wirklich Gott und die Welt geschaffen haben. Und vielleicht werde ich nach Kopenhagen reisen, zur kleinen Meerjungfrau, dort am Kai sitzen und auf die Oper schauen, die nicht vom Dänen Jørn Utzon geschaffen wurde. Um herauszufinden, ob es stimmt, dass die Wikinger die Seefahrt von den Hellenen gelernt haben, Jahrhunderte nachdem die Griechen den Skandinaviern den aufrechten Gang beigebracht haben. Ich werde mir mein eigenes Bild von der Welt malen.
Der Regen gibt nach, endlich. Die Hitze aber bleibt. Die Hitze und die Luftfeuchtigkeit bleiben. Der Deutsche hat Regenwasser in einer Tonne gesammelt, gut so. Wir werden hier weder verhungern noch verdursten. Gott zeigt Erbarmen, und, ohne ketzerisch sein zu wollen, das ist er uns auch schuldig.
Eine große Tafel auf den Planken im Unterleib der Karavellen, die uns als Wegzehrung diente und doch nicht mehr war als ein Happen auf dem Weg zu den unwegsamen Wegen des Herrn. Natürlich würde der Proviant nur für die erste Etappe reichen. Fernãos Flotte segelte zu den Kanaren, wo wir am 26. September auf Teneriffa Vorräte aufnahmen, dann weiter zu den Kapverden, wo wir am 3. Oktober anlandeten. Von dort ging es über das weite offene Meer westwärts nach Brasilien. Am 20. November überquerten wir den Äquator. Wir hatten die Hälfte der Welt hinter uns gelassen, aber nicht den Horizont aus unseren Augen. Zugleich wuchsen die Spannungen zwischen Fernão und Juan de Cartagena, der als Vasall des Königs dessen Zahlmeister war und eigentlich der zweite Kommandeur dieser Expedition. Doch die beiden Sturköpfe gerieten immer wieder aneinander.
Ich bin kein Kapitän, doch auch in mir stieg das Unbehagen, als Fernão einen sehr südlichen Kurs einschlug, so aus der Passatzone segelte und dabei quälend viel Zeit verlor. Juan de Cartagena wetterte gegen diese Entscheidung auf das Heftigste. Sein Unmut, den er jetzt freimütig zu Tage brachte, bedeutete für den Portugiesen einen unwillkommenen Sturm in der Flaute. Fernão betrachtete Juan insgeheim von Beginn an nicht als persona conjunta und wertete dessen Äußerungen als Affront. Es kam, wie es kommen musste, es kam zum Eklat. Fernão nahm Juan de Cartagena den Wind aus den Segeln und ließ ihn kurzerhand festsetzen.
Nach all dem Getöse und Glamour und Glitzer der Ginza, nach all dem pyrotechnischen Paraden und dem ohrenbetäubenden Lärm sehnt sich Ayumi nach Ruhe und Frieden, nach Stille und der Abwesenheit aller schnellen Bewegungen, nach Sonne nach dem Neon, nach Offenheit nach der Enge der Häuserschluchten. Die Ginza strahlt auch ohne Silvesternächte heller als Las Vegas und der Times Square zusammen, doch die Flut an Reizen war für Ayumi zur Sintflut geworden, und nun sucht sie die Abgeschiedenheit in den östlichen Gärten.
Die größte Stadt der Welt ist ein dichter Wald aus Glas, Stein und Beton. Das Zentrum jedoch rund um den Kaiserpalast ist eine ebene grüne Oase, eine streng geordnete und dennoch bisweilen freundliche Lichtung der Meditation inmitten einer brausenden brodelnden Wüste zwischen Mächten, Märkten und Moden mit Menschenmassen, Menschen, die sich scheinbar zügel- und ziellos wie durch einen Ameisenhaufen bewegten. Zweimal im Jahr, zum Kaisergeburtstag am 23. Dezember und zu Neujahr am 2. Januar, werden die Pforten des Palastes geöffnet. Ayumi blickt über die weite Grünfläche, über die Bäume hinweg, die wie Zedern aussehen, Ayumi kennt sich mit Bäumen nicht so aus, auf die Häuserwand am Rasenrand, die aussieht, als beherberge sie nichts als Firmensitze, Banken und Büros. Ayumi kennt sich mit Häusern nicht so aus. Es sind Häuser aus Glas und Beton, rostrote, gelbe, graue, blaue Häuser, wie sie auch in Cincinatti oder Manchester stehen könnten.
Andere Städte haben ein Denkmal oder architektonische Kronjuwelen als ihre Prunkmitte, eine Kathedrale, ein Parlament, einen Triumphbogen. Dieses sterile urbane Monstrum hat das große Nichts als Zentrum auserkoren, das stille Auge inmitten eines Orkans. Eine Grünfläche, so groß wie ein Kleinstaat, und doch sind diese Gärten nicht der Central Park und auch kein Prachtfriedhof für Städte aus Patina mit toten Menschen, deren Ruhm das einzig Überirdische ist, was von ihnen bleibt. Anders als in New York liegen diese Anlagen wirklich mitten in der Stadt, und anders als in Manhattan ist dies keine reine Stätte zur Regeneration alltagsgeplagter Großstadtwesen. Und es ist eben auch keine Nekropole mit dem nanokristallinem Hydroxylapatit edler Verblichener, wie sie die schattigen Ecken von Städten wie Wien, Hamburg oder Paris ziert.
Die kalte Winterluft tut gut, und die Sonne von einem nackten blassblauen Himmel wärmt nur mäßig. Ayumi trägt eine Daunenjacke und Handschuhe, sie genießt die Schritte auf dem gefrorenen Grund, der immer noch grün ist, weil kein Schnee liegt. Und sie genießt ihr Alleinsein inmitten eines überdimensionierten Freiluftareals, so fern vom Schweiß in den Untergrundbahnen und den Essensgerüchen in Asakusa. Dort, zwischen dem alten und dem neuen Asakusa, ist Ayumi aufgewachsen, ein Einzelkind vom Ufer des breiten kurzen Sumida, lange bevor der sich in die Bucht ergießt. Rechts auf der anderen Flussseite der nüchterne Quader der Asahi-Brauerei mit dem weithin sichtbaren Flammenornament von Philippe Starck auf dem Dach. ein Gruß über die Ufer, links der mächtige buddhistische Kannon Tempel Sens?ji mit seinen leuchtend roten Säulenornamenten, den übermannshoghen Lampions und der schattigen Ladenzeile mit den Kitschsouvenirständen. Dazwischen die Nudelsuppenküchen und, erstmals überhaupt und erst seit ein paar Jahren, die fragilen Zelte, Plastiktüten und Decken der Obdachlosen unter den Brücken, wie es sich gehört, am Uferrand, also am Rand des Rands. Die hässlichen Aushängeschilder einer Wirtschaftskrise und der daraus folgenden Deflation.
Читать дальше