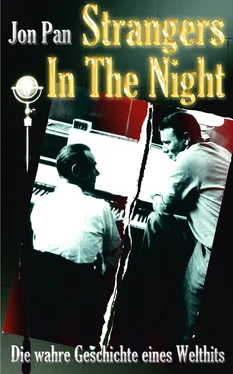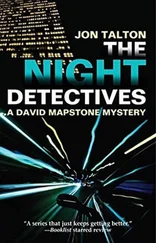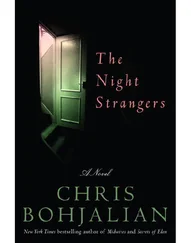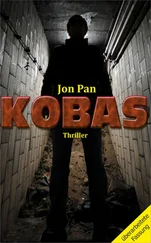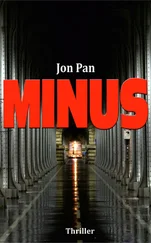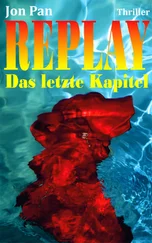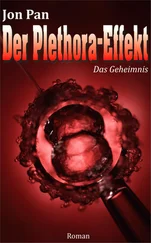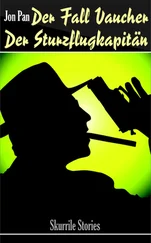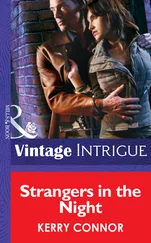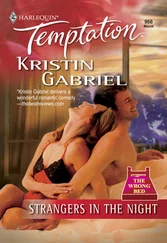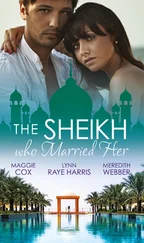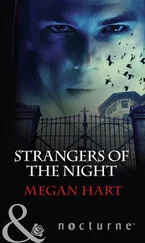»Und dann Hollywood«, fährt der Sprecher in dem Film über Kaempfert fort. »Er schrieb die Musik für einige große amerikanische Filme. So entstand zum Beispiel Strangers In The Night . Aber Hollywood lag ihm nicht. Der Leistungsdruck entsprach nicht seinem Arbeitsrhythmus.«
Nichts dergleichen! Kaempfert war einfach nicht in der Lage, Filmmusik à la Hollywood zu schreiben. Er verstand etwas vom Timing zur Synchronisation. Komponiert und arrangiert hat Rehbein.
Die amerikanische Musikbusiness-Maschine, in die sich Kaempfert von Deutschland aus mit geradezu famoser Treffsicherheit katapultiert hatte, funktionierte für ihn ab einem gewissen Punkt reibungslos. Kompositionen und Arrangements, die Kaempfert brachte, hatten bei der Schallplattenfirma Decca absolute Priorität. Es war die Aufgabe von Milt Gabler, dem damaligen Artist & Repertoire-Direktor des Unternehmens, Songs mit dem Etikett Kaempfert an die Spitze der Hitlisten zu bringen. Was auch gelang.
Wie viel zählte im Angesicht solcher Erfolge der Mann hinter Kaempfert, der die meisten dieser Songs komponiert und arrangiert hatte! Er machte sich auch nicht bemerkbar. Und Verträge, die existierten, wurden nicht eingehalten. Die Vernetzung breitete sich aus. Denn Rehbein und Kaempfert hingen in einer fast schon symbiotischen Art aneinander. Das prägte unaufhaltsam das Schicksal der Beteiligten. Der Welterfolg war eine Sache. Es gab aber auch eine menschliche Seite, eine Herausforderung, die schließlich nicht angenommen wurde.
Ist es die alte Geschichte der Diskrepanz zwischen Künstlertum und Kommerz?
Damit ließe sich zwar einiges erklären, doch wenn man ernsthaft in die Lebensgeschichte eines Menschen eintaucht, die wie bei Rehbein so eng mit dem Leben eines anderen Menschen verknüpft ist, kann vieles nicht mehr auseinander gehalten werden.
»Warum hat Rehbein das alles mit sich machen lassen?« Diese Frage wurde mir während der Arbeit an diesem Buch immer wieder gestellt. Eine Frage, die jedem Außenstehenden dazu sofort in den Sinn kommt. Schließlich leben wir in einer Welt, in der Cleverness und Geldverdienen einen hohen Stellenwert haben. Wieso lässt sich einer hemmungslos ausbeuten, dazu noch von seinem besten Freund?
Man kann bei vielen Künstlern eine Zwiespältigkeit entdecken: Auf der einen Seite wollen oder müssen sie sich bemerkbar machen, auf der anderen Seite wird viel dazu unternommen, um möglichst nicht aufgespürt zu werden.
Vielleicht wollte Rehbein nicht aufgespürt werden. Musik war seine ganze Welt. Alles andere hing bloß damit zusammen. Eine schlechte Voraussetzung fürs Geschäft mit der Unterhaltungsmusik! Die Kreativitätsräume sind dort zudem viel enger gesteckt als zum Beispiel in der so genannten Ernsten Musik. Oder besser: Die Unterhaltungsmusik verfügt mehrheitlich über keinerlei geistige Inhalte. Rehbein war aber ein geistiger Mensch, geistig im Sinn einer starken, intuitiven Begabung. Seine Musik war nie Geschäft, sondern Gefühl. Gerade das haben Leute aus Kaempferts Umfeld, die Millionen mit seiner Begabung verdienten, nie wirklich begriffen.
Jetzt haben natürlich Ausbeutung und Betrug in der Kunst eine lange Geschichte, sie sind so alt wie die Kunst selbst. Wolfgang Amadeus Mozart erhielt für die vollständige Partitur des Figaro 450 Gulden, Johann Sebastian Bachs Witwe lebte von Almosen und endete im Armenhaus, Franz Schubert nagte am Hungertuch, Carl Maria von Weber erhielt von seinem Verleger 120 Gulden für ein Klavierkonzert, eine Symphonie und sechs Sonaten, Johann Strauß verkaufte die Rechte seiner Blauen Donau für 15 Pfund. Die Liste ließe sich problemlos weiterführen. Künstler neigen eben dazu, sich mehr um Kunst als um Brot zu kümmern.
Es gab aber auch immer Gewinner, in der Klassik waren es Künstler wie Richard Wagner, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Christoph Willibald Gluck oder Giacomo Puccini. Um Wagner herauszugreifen, der es einfach verstand, sein Genie gewinnbringend einzusetzen, ungeniert und rücksichtslos, gewissermaßen als die perfekte Kombination von Kunst und Geschäft. Doch mit der romantischen Weltentrücktheit gekrönter Häupter, die allein durch ihre Abstammung – wie Ludwig der II. bei Wagner – Kunst im großen Stil unterstützen konnten, hat das Musikgeschäft längst nichts mehr zu tun.
Die Giganten heißen heute anders, und das war auch schon zu den Zeiten der großen Kampfert–Rehbein-Erfolge so. Es fehlte damals zwar die totale Medienvernetzung, trotzdem hatten einige wenige zu bestimmen, was dem Publikum vorgeführt werden sollte und was nicht.
Musik ist in den letzten Jahrzehnten zu einem Wirtschaftsfaktor geworden, der sich nicht mehr wegdenken lässt. Ein Unterschied zwischen E-Musik (Klassik) und U-Musik (Unterhaltungsmusik) existiert von der Vermarktung her nicht mehr. In der Klassik sind die meisten großen Komponisten verstorben und können daher nicht mitbestimmen (viele von ihnen konnten das ja auch nicht zu ihren Lebzeiten). Die Unterhaltungsmusik schafft sich ihre Namen, die immer kurzlebiger werden, direkt im Prozess der Vermarktung. Eine Kaempfert–Rehbein-Komposition wurde allerdings von verschiedenen Stars in ebenso verschiedenen Interpretationen gesungen, das heißt, diese Musik hat zumindest in diesem Sinn eine Verwandtschaft zur Klassik. Was zählte, war der Song, nicht das momentane Image eines Newcomers mit einer möglichst ausgefallenen Show.
Auf die Frage, ob denn ein Orchester einen im Original gesungenen Titel instrumental nachspielen sollte, antwortete Rehbein in seinem letzten Radiointerview: »Wenn ein Orchester gerne Misserfolg haben will, dann spielt es nicht nach. Was soll man denn machen! Wir müssen doch die großen Erfolge nachspielen.«
Rehbein meinte vermutlich nicht in erster Linie die großen Erfolge aus seiner Feder, sondern er drückte, wie es seine Art war, damit vor allem seine Achtung vor der Arbeit und dem Erfolg anderer aus.
Vielleicht lebte Rehbein auch eine Form von Verweigerung. Was nicht seinem Gefühl entsprach, wollte er nicht zur Kenntnis nehmen. Aus Gefühlen macht man kein Geschäft! Da blieb er sich konsequent treu, und es kostete ihn viel!
Nichts wäre nun aber oberflächlicher, als eine solche Haltung heldenhaft zu nennen. Der Held stirbt schlimmstenfalls im Kampf mit dem Bösen. Rehbein ließ sich aushöhlen, weil er nach außen stumm blieb, sich nicht wehrte, nicht selten sogar in eine Trotzhaltung überging. Das zeigt sich an einem banalen Beispiel aus dem Alltag. Als einmal eine Jazzsängerin bei Rehbeins zu Besuch war, bat Ruth ihren Mann, er solle sich doch selber ein Bier im Kühlschrank holen. Rehbein kam mit einem angebrochenen Sechserpack zurück, aus dem dann auch prompt eine der losen Flaschen auf den Glastisch fiel und zerbrach. Rehbeins Kommentar zu seiner Frau: »Du schickst mich nie mehr Bier holen!«
In solchen Dingen ließ er sich auf nichts ein und ignorierte, was nicht zu seiner Welt gehörte. Da er aber alles andere als gleichgültigen Durchschnitt verkörperte, zog er damit in jeder Phase seines Lebens so genannte Praktiker mit teilweise nicht minderer Begabung auf ihrem Gebiet an. Das war bei ihm schon im Krieg so und erreichte in der langjährigen Freundschaft mit Kaempfert den Höhepunkt.
Diese Teilung mag in einer idealen Konstellation ja funktionieren (wir werden uns später solche Verbindungen an den Beispielen George–Ira Gershwin und Duke Ellington –Billy Strayhorn näher anschauen), doch bei Rehbein–Kaempfert war, um Rehbein zu zitieren, »die Freundschaft einseitig«. Und eine solche Einseitigkeit wirkt auf die Dauer wie eine Krankheit.
Wir werden uns natürlich auch mit der Stellung der Unterhaltungsmusik beschäftigen müssen, die ja schon immer sehr eng an das jeweilig vorherrschende Lebensgefühl gebunden war. Gerade die Arbeit in einem doch stark von außen gesteuerten Medium prägte Rehbein mit. Für Leute ohne Einblick in diese Branche ist es schwer nachzuvollziehen, wie sehr der Macher von der Reaktion auf sein Werk abhängig ist. Dabei hat der kreative Aspekt meistens zurückzutreten, denn die Formel »nur was sich verkauft, ist gut« steht über allem. Gerade weil die Unterhaltungsmusik keine geistigen Inhalte transportiert, hängt sie allein von der Vermittlung einer möglichst eingängigen Stimmung ab.
Читать дальше