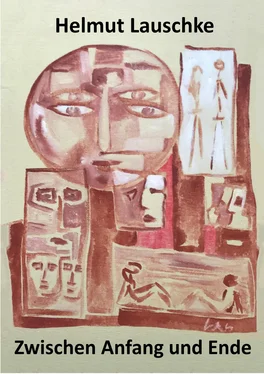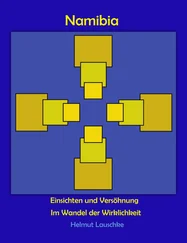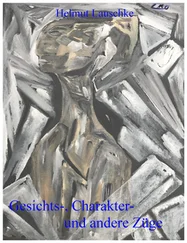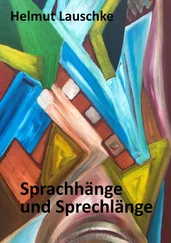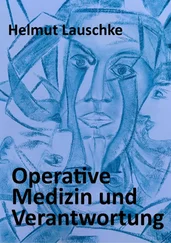Der Ausspruch des Breslauer Pfarrers Rudolf Kannengießer beschämte ihn. Eckhard Hieronymus dankte ihm für die Lektion, die aus der Weisheit eines unerschütterten Glaubens kam. Er empfand den Ausspruch als einen Leitsatz im Hinblick auf das Gefragtwerden am Tage des letzten Gerichts. Anna Friederike hörte das ‘Mea culpa’ und fragte den Vater, was er denn hätte, wofür er sich schuldig sprach. Eckhard Hieronymus nahm die Tochter an die Hand und sagte: „Schuldig bin ich, dass ich zu alledem geschwiegen habe, als es an der Zeit war, dagegen zu protestieren. Ich kann doch nicht unschuldig sein, dass ich nichts unternommen habe, weder geistig noch weltlich, als der Demagoge das Krankheitsbild des Größenwahnsinns zeichnete und bot.“ „Was hättest Du denn tun können?“, fragte Anna Friederike. „Das ist eine andere Sache. Aber ich habe gar nichts getan, habe es einfach laufen lassen. Es gab Menschen wie die Geschwister Scholl, die etwas gegen das Unrecht unternommen haben.“ „Und dafür hingerichtet wurden wie die Menschen des 20. Juli.“ „Wie dem auch sei, nun ist es zu spät. Auch ich habe am Schicksal, durch das wir nun zu gehen haben, meinen Teil der Schweigeschuld zu tragen.“
Er erzählte Anna Friederike, was Pfarrer Kannengießer sagte, als er sich von ihm verabschiedete, dass die Kirche kläglich versagt habe, als es um die Erfüllung des Auftrags ging, sich für die armen, wehrlosen und gequälten Menschen einzusetzen. Die Kirchenmänner hätten sich selbst zu ängstlichen Zuschauern degradiert, anstatt wie ein Paulus aufzustehen und die Nazi-Verbrechen an den Menschen laut und deutlich anzuprangern. Das Schweigen war ein schwerer Fehler. Sie ließen den Kornmarkt und den Reichenturm links liegen, gingen rechts über den Blumenmarkt auf das Hotel mit der Standortkommandantur zu und fragten an der Rezeption nach dem Obersturmführer. Der kam mit ernstem Gesicht die Treppe runter und sagte, dass die Russen Breslau mit Artillerie und geballten Panzerverbänden eingeschlossen hätten. Es sei eine Frage von Wochen oder Tagen, dass die Festung fällt.
Sie gingen zum Speiseraum und setzten sich an denselben Tisch, an dem sie vor zwei Tagen zusammen mit Luise Agnes gesessen hatten. Als Vorspeise wurde Hühnerbouillon mit Ei serviert. Der Obersturmführer bestellte gleich den Chablis vom 40er Jahrgang. Er fragte, während die Serviererin die Weingläser auf den Tisch stellte, die Flasche öffnete, das Glas des Gastgebers zum Probeschluck füllte, der es nach dem Probeschluck auf den Tisch stellte, wie das Gespräch unter den Kirchenbrüdern verlaufen sei. Eckhard Hieronymus sagte, dass es nichts gebracht hätte und der Superintendent im Amt von den Schwierigkeiten berichtete, die er aufgrund der Streichung einer Pfarrstelle aus Kostengründen habe, dass ein Pfarrer, der kurz vor seinem Ruhestand steht, das letzte Jahr noch durchhalten wolle, um sein Ruhegeld in voller Höhe zu beziehen. „Du siehst“, sagte der Namensvetter Reinhard Dorfbrunner im spöttischen Tonfall, „wieweit die Hilfsbereitschaft bei einem Kirchenmann geht, wenn er einem Amtsbruder helfen soll.“ Er lachte: „Sagen wir erstmal Prost! Das andere wird schon kommen, wenn auch ganz anders, als wir es gedacht haben. Denn wenn Breslau fällt, dann sind die Bolschewisten bald in Bautzen. Aber sag, hast du deinem heiligen Mitbruder nicht gesagt, dass du eine Familie mit einer hübschen Tochter hast?“ „Ich habe die Familie erwähnt, die Tochter hat er gesehen“, erwiderte Eckhard Hieronymus. Es fuhr dem Obersturmführer „der aufgeblasene Hosenkacker“ aus dem Mund, als er sich mit Messer und Gabel über den Schweinsbauch mit Sauerkraut und Salzkartoffeln hermachte und sich dazu reichlich scharfen Mostrich auf den Teller gelöffelt hatte.
„Versteh mich richtig“, sagte der Namensvetter, „ich meine nicht dich persönlich, denn du bist ein Dorfbrunner, ich meine es ganz allgemein, dass ihr Kirchenleute jedes Mal jämmerlich versagt, wenn man euch braucht.“ Eckhard Hieronymus schwieg, und sein Schweigen wurde als Ausdruck der Zustimmung verstanden. Sie stießen die Gläser auf das Wohl der Dorfbrunners und die guten Geister an, die sie zur Bewältigung der Zukunft brauchten, sich aber nicht greifen ließen. „Aus meiner philosophisch angehauchten Sicht wird es nicht einfach sein, den Schlamassel zu durchwaten und durchzustehen, der auf uns zukommt nach allem, was passiert ist“, meinte Reinhard, der Obersturmführer, mit ernster Miene.
Eckhard Hieronymus ging darauf ein und meinte, dass die Zukunft von den Taten abhänge, die begangen wurden, egal ob bewusst oder unbewusst. Jeder müsse sich selbst fragen, ob er das Richtige oder das Falsche getan hat, ob er ehrlich oder korrupt war. „Es wird die Frage nach dem Wissen und Gewissen sein, wie die Zukunft auf uns zukommen wird. Sie wird deshalb anders auf uns zukommen, als wir denken, dass sie auf uns zukommen soll, weil wir die Wahrheit nicht ertragen, sie wegdrücken und uns weiter belügen. Der Mörder wird nicht ungestraft davonkommen, wie auch der Schweiger nicht, der den Mord gesehen, aber nichts unternommen hat. Die Schuld des Schweigens ist eine gemeine und schwere Schuld, die zu verantworten ist. Sie wird weit in die Zukunft reichen, und die nächsten Generationen werden ihre Köpfe schütteln, dass so etwas möglich war. Wer sich noch schämen kann und Grund zum Schämen hat, der sollte sich jetzt schon schämen.
Wer sich nicht schämen kann oder schämen will, wenn er Grund zum Schämen hat, dem ist dann auch der letzte Rest an Menschlichkeit abzusprechen.“ „Mensch!“, unterbrach ihn der Obersturmführer, „fährst du aber schwere Geschütze auf. Die könnten wir jetzt gut in Breslau und an der ganzen Front gebrauchen, um den Feind zu stoppen. Meinst du nicht auch, dass Europa auf dem Prüfstand und damit auf dem Spiel steht, je tiefer die russischen Armeen ins deutsche Reichgebiet eindringen?“ „Da stimme ich dir zu“, sagte Eckhard Hieronymus, „dabei müssen wir uns fragen, wer den Krieg mit dem Riesenreich im Osten begonnen hat, an dem schon Napoleon, der in Moskau war, strauchelte und den Großteil seiner Armee mit Waffen durch Typhus verloren hat. Man hätte daraus lernen können, dass der russische Koloss vom Westen her zwar verwundbar, aber nicht zu erobern ist. Dafür sind die geographischen Dimensionen viel zu groß.“
„Dass du als Kirchenmann dich in der Kriegsstrategie profilierst, das habe von dir nicht erwartet. Ich meine aber, dass jeder bei seinen Leisten bleiben solle. Hast du nicht schon mit dem lieben Gott genug zu tun? Ich gebe zu, dass ich mit meinen Leisten auch nicht weiter komme, weil es an Panzern und anderem schlagkräftigen Kriegsgerät fehlt. Wir haben das Ziel nicht erreicht. Nun überrollt uns die Rote Armee mit ihren T34. Doch widerstandslos werden wir nicht von der Bühne verschwinden, das sind wir dem deutschen Boden und der deutschen Ehre schuldig.“ „Der deutschen Ehre sind wir vieles schuldig geblieben“, gab Eckhard Hieronymus zu bedenken und fragte, ob es sinnvoll sei, nun noch das Letzte mit den unersetzbaren Baudenkmälern in Schutt und Scherben zu schießen. Darauf bemerkte der Obersturmführer, dass der Krieg fürchterlich in seiner Einfachheit ist, in dem es ausschließlich auf den Sieg ankommt. Da nimmt keiner Rücksicht auf die Baudenkmäler, auch wenn sie aus historischer, architektonischer und künstlerischer Sicht unersetzbar sind. Man denke an die ägyptischen und griechischen Tempel, die zerstört wurden, an die Skulpturen, denen die Augen ausgestochen und die Arme, Nasen und Ohren abgeschlagen wurden.
Es war ein Mittagessen mit Diskussion zur Lage der verbluteten und verbrauchten Nation. Der Obersturmführer zielte auf den Untergang des Abendlandes hin, weil der bolschewistische Einfall in die Mitte Europas nicht aufzuhalten ist; Eckhard Hieronymus ging es um Gründe und Schuld, warum der Weg in die Katastrophe zu gehen war. Beide hatten in der Schule den „Phaidon“ gelesen. Sie kamen auf Sokrates zu sprechen, dass er zur Erhaltung Athens als Infanterist im Peloponnesischen Krieg bei Delion und Amphipolis kämpfte und nach den Kämpfen den Vorsitz im Rat der Rechtspartei übernahm und das aufgebrachte Volk zu beschwichtigen und davon abzuhalten versuchte, die Feldherren wegen der verlorenen Arginusenschlacht hinzurichten. Er erlebte den Niedergang und die Katastrophe Athens. „Weißt du“, fragte Eckhard Hieronymus den Namensvetter, „warum Sokrates kein Partei- oder Staatsführer sein wollte?“ Der Obersturmführer wusste es nicht; Eckhard Hieronymus zitierte aus der Apologie: „Niemand sei seines Lebens sicher, der einer Volksmasse offen und ehrlich begegnet. Deshalb müsse, wer ein Kämpfer für das Rechte sein und dabei kurze Zeit am Leben bleiben wolle, sich auf den Verkehr mit Einzelnen beschränken.“ Der Namensvetter lachte und sagte, dass der „Führer“ diesbezüglich doch Glück gehabt habe, worauf der andere Vetter ironisch wurde und sagte, dass Sokrates etwas anderes unter Offenheit und Ehrlichkeit verstand, wobei er die Toleranz anders denkenden Menschen gegenüber als unverzichtbar angesehen hatte.
Читать дальше